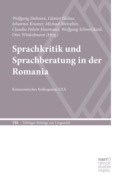Kitabı oku: «Sprachenlernen im Tandem», sayfa 6
Form und Exaktheit
Bedeutung und Fluss
aufgabenorientiert
prozedural.
Nach seinem Befund variieren die Systeme des Sprecherwechsels deutlich in diesen verschiedenen Kontexten. Während im prozeduralen Unterrichtskontext z.B. die lehrerseitigen Monologe ohne Sprecherwechsel einen großen Anteil ausmachen, sind im Kontext, der sich an Bedeutung und Fluss orientiert, zahlreiche Sequenzen mit Sprecherwechsel zu sehen. Des Weiteren lässt sich in dieser Studie feststellen, dass die Organisation des Sprecherwechsels im Fremdsprachenunterricht nicht ausschließlich der Steuerung der Lehrperson unterliegt. Die Lerner leisten lokal und kreativ auch einen Beitrag zur Gestaltung des Sprecherwechsels.
Ein besonderes Thema, das in der Kommunikation mit nicht kompetenten Sprechern häufig behandelt wird, ist die Reparatur. Während die Reparaturhandlungen in nicht-institutionellen MS-NMS-Konversationen eher spontan und interapersonal sind, verdeutlicht die konversationsanalytische Zweitspracherwerbsforschung, wie die Reparatursequenzen im Fremdsprachenunterricht systematisch organisiert werden.
Jung (1999) untersucht Reparatursequenzen anhand von Videodaten (60 Minuten) aus einem Fremdsprachenunterricht (Englisch als Fremdsprache) an einer amerikanischen Universität für Erwachsene aus Afrika, Ostasien und Südamerika. Der Fokus des aufgenommenen Unterrichts liegt darin, das Hörverständnis und die Sprechfähigkeit der Lerner zu fördern und damit ihre kommunikative Kompetenz voranzutreiben. Die empirische Untersuchung mit konversationsanalytischer Methode zeigt, dass die „participation frameworks“ (Jung 1999: 167) eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Reparatursequenzen im Fremdsprachenunterricht spielen. Jung (1999) unterscheidet dabei „learner role-playing activities“ von „teacher-fronted activities“ und beschreibt die Organisation der Reparatursequenzen in dem jeweiligen Kontext. In „learner role-playing activities“, in denen die Lerner Dialoge in Form vom Rollenspiel durchführen, manifestieren sich verschiedene Variationen der Reparatursequenzen, wie selbstinitiiert und selbstdurchgeführt, selbstinitiiert und fremddurchgeführt, fremdinitiiert und fremddurchgeführt. Dagegen zeichnen sich „teacher-fronted activities“, in denen die Lehrperson den Lernern Fragen stellen, durch fremdinitiierte und fremddurchgeführte Reparatursequenzen aus.
Angeregt von Jung (1999) und Kasper (1986), die ausführen, dass die Organisation der Reparatursequenzen nicht monolithisch, sondern im Zusammenhang mit dem pädagogischen Fokus steht, führt Seedhouse (2004) eine weitere empirische Studie mit konversationsanalytischer Methode an. Konkret analysiert er die Gestaltung der Reparatursequenzen in drei fremdsprachenunterrichtlichen Kontexten, die jeweils Form und Exaktheit, Bedeutung und Fluss und aufgabenorientierte Interaktion als ihre pädagogischen Ziele setzen. Anhand seiner Daten beschreibt er die Reparatursequenzen im Fremdsprachenunterricht unter den folgenden vier Gesichtspunkten:
typische Beteiligten bei der Reparatur
typische Trajektorien der Reparatur
typische Typen der Reparatur
typischer Fokus der Reparatur (d.h. was ist reparierbar) (Seedhouse 2004: 142).
Seine Untersuchung bestätigt, dass es zwischen dem pädagogischen Fokus und der Organisation der Reparaturen eine reflexive Beziehung gibt. Ändert sich der pädagogische Fokus, kommt eine veränderte Reparaturgestaltung vor.
Ein Blick auf die Forschungslage zeigt, dass die konversationsanalytische Methodologie ein hilfreiches Instrumentarium bietet, um die Interaktionsorganisation im Fremdsprachenunterricht zu rekonstruieren und die enge Verknüpfung von sozialer Interaktion und Spracherwerb zu erfassen. Zur Bedeutung der Konversationsanalyse für die Fremdspracherwerbsforschung schreibt Schwab (2009):
Die konversationsanalytische Methodologie kann also keine unmittelbaren Antworten auf die in der Psycholinguistik gestellten Fragen nach Lernen/Erwerben als individuell-kognitivem Prozess geben. Sie kann aber helfen, fremdsprachliches Lernen/Erwerben zu erklären, indem das Bild von Spracherwerb um eine sozial-interaktive Ebene erweitert wird. (Schwab 2009: 109)
2.2 Zu den Daten
Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine empirische Untersuchung der chinesisch-deutschen Tandeminteraktion mit konversationsanalytischer Methode. Im Folgenden werde ich darauf eingehen, wie die Daten erhoben wurden. Außerdem werde ich relevante Angaben zu den Probanden machen. Schließlich wird die Aufbereitung der Daten für meine Forschung erläutert.
2.2.1 Datenerhebung
Am Anfang aller Gesprächsaufnahmen im chinesisch-deutschen Tandem fand ich in meinem Freundeskreis in Freiburg vier Tandempaare, die bereit waren, an meinem Forschungsprojekt teilzunehmen. Außerdem vermittelte ich einer chinesischen Studentin, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen gerade in Freiburg angekommen war, auf ihren Wunsch hin eine deutsche Tandempartnerin. Mit ihrem Einverständnis wurde sie auch in meine Forschung aufgenommen. Darüber hinaus versuchte ich auch, potenzielle Probanden durch Aushänge in der Universität und Ankündigungen im Sozialnetzwerk (wie Facebook) oder Internetplattform (wie Verband der chinesischen Studierenden in Freiburg) zu finden. Da hat sich aber nichts ergeben. Es gelang mir also, insgesamt fünf Tandempaare zu Zwecken der Untersuchung zu gewinnen.
Für die Auswahl der Probanden setzte ich hauptsächlich zwei Kriterien. Erstens sollten die Teilnehmer die Grundvoraussetzung der Tandemidee erfüllen. Der eine spricht Chinesisch als Muttersprache und lernt Deutsch. Der andere soll ein deutscher Muttersprachler sein, der Chinesisch lernt. Sie versuchen, einander beim Sprachenlernen zu helfen. Zweitens war es wichtig, dass sie sich regelmäßig und möglichst länger als vier Monate treffen.
Von meiner Seite aus wurden Unterstützungen bezüglich des Sprachenlernens bereitgestellt, sowohl für die Chinesisch lernenden deutschen Probanden als auch für die Deutsch lernenden chinesischen Probanden. Je nach ihrem individuellen Bedarf bot ich z.B. Hilfe bei ihren Übersetzungsaufgaben, Textkorrekturen u.a. an.
Bei der Durchführung der Aufnahmen wurde ein kleiner Aufnahmeapparat benutzt. Die Tandempartner trafen sich normalerweise in der Universität, im Café oder zu Hause. Der Apparat wurde auf den Tisch zwischen die beiden Teilnehmern gelegt. Zumeist war ich bei den Aufnahmen der Tandemgespräche anwesend, da ich dadurch einen genauen Blick in den Interaktionsverlauf gewinnen konnte. Diese Methode wird in der sozialwissenschaftlichen Feldforschung als teilnehmende Beobachtung bezeichnet. Sie zielt darauf ab, Erkenntnisse über das Handeln und das Verhalten der Teilnehmer zu gewinnen. Dadurch werden für die Forscher relevante Aspekte des Handelns oder des Verhaltens in der real ablaufenden Situation zugänglich. Es gibt auch Daten, die die Probanden selber mit dem Aufnahmeapparat erhoben haben und mir aushändigten. Diese Daten machen aber im Gesamtkorpus einen relativ kleinen Anteil aus.
Im Laufe der Aufnahmen brach ein Tandempaar schon nach ungefähr drei Monaten die Tandemgespräche ab. Bei einem anderen halfen die beiden Teilnehmer einander hauptsächlich bei schriftlichen Hausaufgaben. Mündliche Gespräche zu Alltagsthemen waren in ihrer Tandeminteraktion kaum zu beobachten. Die beiden Gruppen wurden schließlich nicht in die konversationsorientierte Analyse aufgenommen. Die Gesamtdaten der Tandemgespräche für die vorliegende Arbeit lassen sich tabellarisch wie folgt aufzeigen:
| Probanden | Aufnahmen | Zeitraum |
| Li & Lukas | ca.16 Stunden | 08. 2012–02. 2013 |
| Ting & Linda | ca.14 Stunden | 10. 2012–06. 2013 |
| Le & Max | ca. 5 Stunden | 01. 2013–07. 2013 |
| Summe | ca. 35 Stunden |
* Aus Gründen der Anonymität sind alle Namen geändert.
Am Schluß der Aufnahmen führte ich Interviews mit den chinesischen Lernern durch. Dabei wurde vorwiegend nach ihrem jeweiligen persönlichen Hintergrund bezüglich des Sprachenlernens und ihren eigenen Meinungen zum Tandem gefragt. An verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit stütze ich mich bei der Darstellung auf Angaben aus den aufgezeichneten Interviews.
2.2.2 Zu den Probanden
Am Beispiel von drei Fallbeispielen soll in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, wie die Interaktionen für das Sprachenlernen im chinesisch-deutschen Tandem im Einzelnen ablaufen. Als Hintergrund zur Gesprächsanalyse möchte ich hier einige relevante Informationen über die jeweiligen Probanden zusammenstellen.
Tandempaar 1: Li & Lukas
(1) Li:
Li ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen 25 Jahre alt und studiert in Deutschland im zweiten Jahr Wirtschaft in der Sprache Englisch. Gleichzeitig besucht sie einen Deutschkurs im Sprachlehrinstitut der Universität. Nachdem sie ein Bachelorstudium im Fach Anglistik in Peking erfolgreich abgeschlossen hatte, begann sie mit einem Masterstudium im Fach Wirtschaft in Deutschland. Bevor sie nach Deutschland gekommen war, hatte sie die deutsche Sprache zwei Monate lang gelernt. In Freiburg geht sie zweimal pro Woche zum Deutschkurs. Ihren Tandempartner lernte sie über ihren Freund kennen. Sie trafen sich durchschnittlich zweimal pro Woche im Semester, entweder in der Wohnung oder in einem Café. Außerdem wurde Li zweimal von ihrem Tandempartner zur Gruppearbeit mit deutschen Studierenden eingeladen. Sie wohnt in einer WG mit drei deutschen, zwei amerikanischen und einem chinesischen Mitbewohnern. In ihrer Freizeit arbeitet sie in einem Hotel, wo die Arbeitssprache Deutsch ist.
(2) Lukas:
Lukas ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen 25 Jahre alt und studiert Sinologie als Hauptfach im zweiten Jahr in Deutschland. Während des Studiums absolvierte er ein Austauschsemester in China. In den Semesterferien war er mehrmals in China, um seine chinesische Freundin zu besuchen. Allmählich kann er fließend Chinesisch sprechen.
Tandempaar 2: Le & Max
(1) Le:
Le ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen 22 Jahre alt und studiert im dritten Semester des Masterstudiums im Fach Germanistik. Nachdem sie ein Bachelorstudium der Germanistik in China erfolgreich abgeschlossen hatte, begann sie mit dem Masterstudium in Deutschland. Während des Bachelorstudiums absolvierte sie zwei Austauschsemester in Deutschland. Sie hat in meinem Korpus ein relativ hohes Sprachniveau auf Deutsch. Ihr Tandempartner Max wurde von ihrer früheren deutschen Tandempartnerin vermittelt, als sie ihr Studium abgebrochen hatte und in eine andere Stadt umgezogen war. Sie traf sich mit ihrem Tandempartner in der Regel einmal pro Woche, entweder in der Universität oder in ihrer WG. Außerdem arbeitet Le während des Studiums in Deutschland in einem Minijob, und zwar durchschnittlich anderthalb Tage pro Woche in einem Restaurant, wo die Arbeitssprache Deutsch ist.
(2) Max:
Max ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen 25 Jahre alt und studiert im zweiten Semester des Bachelorstudiums das Fach Sinologie. Vorher beendete er sein Bachelorstudium im Fach Betriebswirtschaftslehre erfolgreich. Er kommt aus Süddeutschland und spricht mit einem deutlichen Akzent.
Tandempaar 3: Ting & Linda
(1) Ting:
Ting ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen 22 Jahre alt und studiert Jura im zweiten Semester des Masterstudiums in Deutschland. Nachdem sie ihr Bachelorstudium im Fach Jura erfolgreich abgeschlossen hatte, machte sie einen dreimonatigen Deutschkurs in China. Danach kam sie nach Deutschland. Da ihr Sprachniveau damals für ein Studium in Deutschland noch nicht ausreichte, besuchte sie ein Jahr lang Sprachkurse in Deutschland. Anschließend fing sie ihr Masterstudium im Fach Jura an einer Universität in Deutschland an. Ihre Tandempartnerin lernte sie durch mich kennen. Schon nach dem ersten Treffen freundeten sie sich an. Durchschnittlich treffen sie sich einmal pro Woche in einem Café in der Universität. Neben Gesprächen helfen sie einander bei Hausaufgaben. Ting bittet Linda häufig, ihre Seminararbeit zu korrigieren oder Texte in ihrem Lehrbuch zu erklären.
(2) Linda:
Linda ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen 25 Jahre alt und studiert Sinologie als Hauptfach im letzten Semester des Magisters. Als ich die Datenerhebung abschloss, begann sie mit ihrer Promotion im Fach Sinologie. Da ihr Nebenfach Jura ist, vermittelte ich sie der chinesischen Jurastudentin Ting. Ting suchte nämlich eine Muttersprachlerin, die ihr bei ihrem Studium helfen könnte, während Linda auf der Suche nach einer chinesischen Tandempartnerin war. Während ihres Sinologiestudiums absolvierte Linda zwei Austauschsemester in China. Chinesisch kann sie schon fließend sprechen. Das erste Treffen mit Ting wurde von ihr als „Liebe auf den ersten Blick“ bezeichnet. Beim Tandemtreffen spricht sie mit Ting über viele verschiedene Themen aus Alltag und Studium. Außerdem bringt sie auch ihre Texte mit. Während sie ihre chinesischen Texte vorliest, korrigiert Ting ihre Aussprache und erklärt auch Textstellen, die Linda nicht versteht.
2.2.3 Die Aufbereitung der Daten
Wie in Kapitel 2.1.1 dargelegt, unterscheidet sich die Konversationsanalyse von vielen Forschungsmethoden in der Sprach- und Sozialwissenschaft darin, dass sie nicht von zu überprüfenden Hypothesen ausgeht. Erst aus der Beschäftigung mit den Datenmaterialien für den Untersuchungsgegenstand ergeben sich die Fragestellungen der Forschung. Das heißt, die Untersuchung mit konversationsanalytischer Methode ist ein reflexiver Prozess, der sich im Rahmen des Untersuchungsgegenstandes zwischen Daten und Fragestellungen alternierend bewegt.
Der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Frage nach dem Interaktionsprozess für das Sprachenlernen im Tandem. Was passiert, wenn sich zwei Tandempartner treffen? Wie interagieren sie miteinander? Wie verläuft der Lernprozess in Tandeminteraktionen? Um die Fragestellungen der Forschung in diesem Rahmen zu entwickeln und zu konkretisieren, versuchte ich zuerst, durch intensives Einhören in alle Aufnahmen zu Kategorien zu kommen, die in der chinesisch-deutschen Tandeminteraktion relevant sind. Mit Protokollen bzw. ersten Transkripten von mehreren interessanten Stellen stellte ich schließlich fest, dass die Gespräche im Tandem sowohl Merkmale der unterrichtlichen als auch der alltäglichen Interaktion enthalten. Einerseits kann die Tandeminteraktion mit dem Ziel – Sprachenlernen mit Unterstützung des muttersprachlichen Gesprächspartners – häufig als Lehr-Lern-Aktivität wie im institutionellen Fremdsprachenunterricht betrachtet werden. Andererseits zeichnet sie sich aber durch deutlich alltägliche kommunikative Eigenschaften aus.
Besonders beachtenswert sind außerdem die konversationellen Erzählungen, die die chinesischen Lerner produzieren. Dabei tauchen interessante Phänomene auf, die in der bisherigen Erzählforschung kaum thematisiert werden. Beispielsweise beenden die Probanden in meinen Daten die Erzählungen, indem sie das Gesprächsthema zur landeskundlichen Diskussion oder zur sprachlichen Bearbeitung weiterführen. In konversationellen Erzählungen unter Muttersprachlern ist das nicht zu finden.
Aufgrund dieser Beobachtungen entschied ich mich für drei Hauptkategorien meiner empirischen Analyse. Erstens geht es um das Tandemgespräch als eine besondere kommunikative Gattung, die zwischen Unterrichtsinteraktion und Alltagsgespräch liegt. Mit konversationsanalytischer Methode möchte ich den Wechselmechanismus zwischen der Lehr-Lern-Sequenz und dem Alltagsgespräch beleuchten und damit die relevanten Gattungsmerkmale des Tandems herausarbeiten. Zweitens geht es um konversationelle Erzählungen der chinesischen Lerner. Konkret möchte ich anhand meiner Daten die mündliche Erzählfähigkeit der chinesischen Studierenden analysieren. Da die Erzählungen im Tandem interaktiv hervorgebracht werden, spielt die Rolle der muttersprachlichen Gesprächspartner auch eine wichtige Rolle. Deshalb stehen drittens die Beiträge der muttersprachlichen Laienlehrpersonen im Mittelpunkt meiner Analyse.
Da in der Regel eigentlich nur ein Teil der Gesprächsdaten für die Untersuchung der vorliegenden Kategorien von Interesse ist, ist die Transkripition der Gespräche von Anfang bis Ende forschungspraktisch unökonomisch. Deshalb wurde eine Auswahl der relevanten Gesprächsteile durchgeführt. Ich hörte dafür die aufgezeichneten Tandemgespräche in meinem Korpus zum Teil mehrmals und fertigte parallel Protokolle an, um angesprochene Themen, den Wechsel zwischen der Lehr-Lern-Sequenz und dem Alltagsgespräch und weitere Auffälligkeiten zu dokumentieren. Danach erfolgte auf Grundlage dieser Orientierungsprotokolle die Auswahl der relevanten Teile. Schließlich transkribierte ich die ausgewählten Gesprächsausschnitte nach dem gesprächsanalytischen Transkriptionssystem 2 (GAT 2).
Bei der Datenaufbereitung in Form der Transkription wurde darauf geachtet, dass sie möglichst alle Merkmale der gesprochenen Sprache (z.B. Dehnungen, Verzörgerungen, Pausen) genau wiedergibt. Die den Transkriptionen zugrunde liegende Transkriptionskonvention sieht im Einzelnen wie folgt aus:
| ? | hoch steigend |
| , | mittel steigend |
| – | gleichbleibend |
| ; | mittel fallend |
| . | tief fallend |
| = | schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Sprecherbeiträge |
| [ ] | Überlappungen und Simultansprechen |
| (.) | Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer |
| (-) | kurze geschätzte Pause von ca. 0.2–0.5 Sek. Dauer |
| (--) | mittlere geschätzte Pause v. ca. 0.5–0.8 Sek. Dauer |
| (---) | längere geschätzte Pause von ca. 0.8–1.0 Sek. Dauer |
| (0.5) | gemessene Pausen |
| : | Dehnung, Längung, um ca. 0.2–0.5 Sek. |
| :: | Dehnung, Längung, um ca. 0.5–0.8 Sek. |
| ::: | Dehnung, Längung, um ca. 0.8–1.0 Sek. |
| °h/h° | Ein- bzw. Ausatmen |
| und_äh | Verschleifungen innerhalb von Einheiten |
| äh öh äm | Verzögerungssignale, sog. "gefüllte Pausen" |
| hm ja | Rezipienzsignale |
| akZENT | Fokusakzent |
| haha hehe hihi | silbisches Lachen |
| ((lacht)) | Beschreibung des Lachens |
| <<lachend> > | Lachpartikeln in der Rede, mit Reichweite |
| <<erstaunt> > | interpretierende Kommentare mit Reichweite |
| ( ) | unverständliche Passage ohne weitere Angaben |
| ↑ | kleinerer Tonhöhensprung nach oben |
| ↓ | kleinerer Tonhöhensprung nach unten |
Die chinesische Sprache, die in meinen Daten enthalten ist, wurde zuerst ins Chinesische in Form der Schriftzeichen transkribiert. Anschließend gab ich direkt in der Zeile darunter die wörtliche Übersetzung an, die manchmal von korrekten deutschen Formulierung abweicht. In der dritten Zeile geht es um die sinngemäße deutsche Übersetzung.
3 Tandemgespräch: eine besondere kommunikative Gattung
3.1 Das Konzept: kommunikative Gattung
Der Begriff „kommunikative Gattung“ wurde von dem Soziologen Thomas Luckmann geprägt. Nach Luckmann (1986: 201) „gibt es wohl in allen Gesellschaften kommunikative Handlungen, in denen sich der Handelnde schon im Entwurf an einem Gesamtmuster orientiert, als dem Mittel, das seinen Zwecken dient.“ Im kommunikativen Handeln bilden sich also Formen aus. Sie werden in der Gesellschaft eingebettet und stehen wiederum den Handelnden zur Verfügung. Als Muster bieten sie einen Orientierungsrahmen, in dem sich die Handelnden solcher verfestigten Formen bedienen. Luckmann (1986: 201) weist weiter darauf hin, dass „solches Gesamtmuster weitgehend die Auswahl der verschiedenen Elemente aus dem kommunikativen ‚Code‘ bestimmt, und der Verlauf der Handlung hinsichtlich jener Elemente, die vom Gesamtmuster bestimmt sind, verhältnismäßig gut voraussagbar ist“. Die formalisierten Muster sind mit der Zeit Teile des gesellschaftlichen Wissensvorrats geworden. Sie stellen Lösungen eines wiederkehrenden Problems bereit (Günthner/Knoblauch1997: 282).
Die Entwicklung der Theorie und Methodologie kommunikativer Gattungen ist auf die Soziologie zurückzuführen. In den 1970er Jahren wurde der Sinn- und Handlungsbegriff von Max Weber durch Schütz (Schütz/Luckmann 1975) weiterentwickelt, indem er den Fokus vom subjektiven Sinn auf dessen Abbildung in sozialen Handlungen verschob. Dies gab entscheidende Impulse für die Ethnomethodologie und Konversationsanalyse und weitergehend für die pragmatisch orientierte Sprachwissenschaft (Auer 1999: 115). In diesem Zusammenhang baut Luckmann, ein bedeutender Vertreter der Wissenssoziologie, sein Konzept „kommunikative Gattung“ auf Vološinov (1929/1975) und Bachtin (1959/1986) auf. Vološinov (1929/1975) und Bachtin (1959/1986) vertreten die Meinung, dass Sprache eng mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit verknüpft ist und ihren eigentlichen Sitz in sozialen Situationen hat. Sprache realisiert sich in Interaktionen, indem man sich in kommunikativen Situationen der in der Gesellschaft verfestigten Gattungen bedient.
Sprache, Gesellschaft, Kultur
Für Luckmann (1986) ist die Sprache konstitutiv bei der Vermittlung gesellschaftlichen Wissens und dem Aufbau der sozialen Wirklichkeit. Dies beschreibt er folgendermaßen:
Intersubjektiv verbindliche Erfahrungsschemata, auf elementaren Typisierungen der Wirklichkeit aufbauend und in verschiedene Handlungsschemata einfügbar, bilden somit eine grundlegende Schicht gesellschaftlich approbierten handlungsorientierenden Wissens. (Luckmann 1986: 199)
Das Gesamtinventar kommunikativer Gattungen bezeichnet Luckmann (1986: 206) als den „kommunikativen Haushalt“. Zugleich betont er, dass der Begriff des „kommunikativen Haushalts“ ein rein analytischer Begriff ist, dem kein „reales kulturelles Objekt“ entspricht. Gattungen sind historisch gewachsen und sedimentiert. Mit der diachronischen Veränderung des kommunikativen Haushalts einer gegebenen Gesellschaft verändern sich auch die Gattungen.
Luckmann (1986: 202) vergleicht kommunikative Gattungen mit gesellschaftlichen Institutionen. Während gesellschaftliche Institutionen als Orientierungsrahmen für die Lösungen der Probleme im gesellschaftlichen Leben gelten, dienen kommunikative Gattungen dazu, spezifische kommunikative Probleme zu lösen. Im Hinblick auf den wichtigen Stellenwert kommunikativer Gattungen in der Gesellschaft unterstreichen Günthner/Knoblauch (1997) die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit dieser verfestigten kommunikativen Vorgänge für die Handelnden, damit sie die sozialen Aufgaben lösen können.
Außerdem sind Gattungen kulturelle Produkte. Sie sind offen für kulturelle Differenzen. Günthner/Knoblauch (1995) weisen auf Unterschiede kommunikativer Gattungen in verschiedenen Kulturen hin:
If we take communicative genres as socially constructed solutions which organize, routinize, and standardize the dealing with particular communicative problems, it seems quite obvious that different cultures may construct different solutions for specific communicative problems. Moreover, whereas in one culture there may be generic ways of handling particular communicative activities in another culture interactants may use spontaneous forms instead. Thus, the repertoire of communicative genres vary from culture to culture as well as from one epoch to another. (Günthner/Knoblauch 1995: 6)
Die kulturellen Unterschiede kommunikativer Gattungen betreffen sowohl den Gebrauch (Argumentationsstrukturen, Kontextualisierungshinweise oder Rezipientenaktivitäten) als auch die kommunikative Funktion. Günthner (1993) thematisiert z.B. die kleine Gattung „Sprichwort“ in ihrer kontrastiven Studie über chinesische und deutsche Diskursstrategien.
Kotthoff (1995) betrachtet kommunikative Gattungen aus ethnolinguistischer Perspektive. Ihr Untersuchungsgegenstand besteht aus drei verschiedenen Genres der Argumentation und des Angriffes im ländlichen Georgien, wo solche mündliche Gattungen als gesellige Veranstaltungen gelten. Konkret illustriert sie mit Hilfe der konversationsanalytischen Methode die Struktur der jeweiligen Gattung (gašaireba, galeskseba, kapioba) und interpretiert sie im Zusammenhang mit dem kommunikativen und sozialen Kontext, in den sie eingebettet ist. Ihr Befund ergibt, dass alle untersuchten Gattungen eine verfestigte Organisation (vor allem bezüglich ihrer linearen Strukturen und der Reime) aufzeigen. Mittels verschiedener rhetorischer Strategien (wie Kontraste, Wiederholungen, Übertreibungen, Zitate) werden die Gattungen hervorgebracht. Zugleich hat aber jede Gattung ihren eigenen Entfaltungsraum, wo sie sich frei gestalten kann. Die Unterschiede der untersuchten Gattungen lassen sich vorwiegend bei der Improvisation, der Dialogizität und der Musikalität bei der Organisation der Gattungsstruktur beobachten. Das mündlich vorgetragene galeskseba basiert z.B. auf einem schriftlichen Skript und zeichnet sich im Vergleich zu den anderen durch eine eher monologische Form aus. Bezogen auf die Musikalität ist kapioba dasjenige, welches immer mit einer Melodie kombiniert wird und von einer deutlich überdurchschnittlichen Kreativität gekennzeichnet ist. Im Hinblick auf die soziale Bedeutung solcher Gattungen, die Interaktion zwischen den Darstellern und den Zuschauern ermöglichen, dienen sie nach Kotthoff (1995) dazu, die gesellschaftlichen Bindungen und das soziale Gleichgewicht herzustellen. Jedoch erleben solche kulturell geprägten, kommunikativen Gattungen in der heutigen medienorientierten Gesellschaft einen Wandel. Die Bewahrung der untersuchten Gattungen bzw. ihrer sozialen Funktion im ländlichen Georgien ist auf die Abgeschlossenheit der kleinen Gemeinden zurückzuführen.
Kommunikative Gattungen und spontane kommunikative Handlungen
Ferner weist Luckmann (1986) auf den Unterschied zwischen kommunikativen Gattungen und spontanen kommunikativen Handlungen hin. Während es sich in kommunikativen Gattungen um historisch kulturell eingebettete Gesamtmuster handelt, baut der Handelnde in spontanen kommunikativen Aktionen schrittweise sein Handlungsmuster auf, um sein Ziel zu erreichen. Ausgehend von seiner Absicht wählt er sprachliche kommunikative Mittel aus seinem eigenen Wissensvorrat und bildet damit nach Grammatikregeln (Syntax, Phonologie, Morphologie, Semantik) Sätze für die kommunikative Interaktion in den jeweiligen Situationen. Zuweilen setzt der Handelnde stilistische Mittel und rhetorische Verfahren ein, je nach seiner Fähigkeit, seinem Bildungsniveau und der kommunikativen Situation. Die spontanen kommunikativen Handlungen werden nicht nach einem Gesamtmuster durchgeführt, sondern sind aus einer Mischung von bestimmten Routinen und strategischen Entwürfen geprägt.
Funktionen kommunikativer Gattungen
Die Gundfunktion kommunikativer Gattungen besteht nach Günthner/Knoblauch (1997: 283) darin, dass Orientierungsrahmen gebildet werden, auf die sich Interagierende sowohl bei der Produktion kommunikativer Handlungen als auch bei der Rezeption beziehen. Die Handelnden orientieren sich damit an einem vorgeprägten Muster. Der Interaktionsablauf wird dabei mehr oder minder gesteuert und die Kommunikation dadurch erleichtert.
Kommunikative Gattungen haben eine weitere Funktion. Sie spielen eine Rolle für den sozialen Kontext, in dem sie Verwendung finden. Gattungen sind wesentliche kommunikative Verfahren zur interaktiven Konstruktion gesellschaftlicher Kontexte. Mit kommunikativen Gattungen kann man z.B. „eine soziale Beziehung zwischen den Interagierenden konstruieren“, „Wissensgefälle etablieren“, „Gemeinsamkeit von Normen (beispielsweise im Klatsch) bestätigen“ oder einen Bezug zur sozialen Situation herstellen (Günthner/Knoblauch 1997: 284).
Andererseits haben kommunikative Gattungen eine reflexive Beziehung zu den sozialen Kontexten. Sie sind nicht einseitig den sozialen Kontexten unterworfen und von ihnen bestimmt. Die Herstellung institutioneller Kontexte stellt auch eine Funktion kommunikativer Gattungen dar (Günthner/Knoblauch 1997: 284). Mit der Verwendung kommunikativer Gattungen wie z.B. Bewerbungsgespräch, Referat oder Verkaufsgespräch stellen die Kommunikationsteilnehmer entsprechende soziale Kontexte her. Diese Kontexte wiederum spielen eine Rolle bei der Interpretation der Interaktion.
Kommunikative Gattung und ähnliche sprachwissenschaftliche Begriffe
Im Hinblick auf die Untersuchung verfestigter sprachlicher Handlungstypen hat sich im deutschsprachigen Raum der Begriff „sprachliche Handlungsmuster“ (Ehlich/Rehbein 1979) etabliert. Inhaltlich und terminologisch sind „sprachliche Handlungsmuster“ nahe dem Begriff „kommunikative Gattung“ (Luckmann 1986). Nach Ehlich/Rehbein (1979) ist es mit der Gesellschaft verbunden. Darunter versteht man nämlich „gesellschaftlich produzierte und reproduzierte Handlungsformen“ (Ehlich/Rehbein 1979: 250). Somit gelten „sprachliche Handlungsmuster“ als die verfügbare Handlungsvorgabe und regeln die Durchführung eines Handlungstyps. Trotz der begrifflichen Nähe unterscheiden sie sich jedoch von der kommunikativen Gattung. Dazu schreibt Birkner (2001):
Im Unterschied zum Gattungskonzept bedienen sich Handelnde festgefügter, auf spezifische Zwecke begründeter Handlungsmuster und wählen Muster nicht, wie es Luckmann betont, als Orientierungen aus, die für die Lösung gesellschaftlicher Probleme geschaffen wurden und einen relativen Handlungsspielraum bieten. Kommunikative Gattungen existieren nicht außerhalb ihrer sprachlichen Realisierung, sie werden in der Interaktion erworben, tradiert und verändert. Handlungsmuster sind darüber hinaus theoretischer bestimmt, in ihren Ablaufstrukturen viel stärker festgelegt und werden in der linguistischen Analyse als vorhersagbar behandelt. (Birkner 2001: 41)
In Zusammenhang mit der diskursanalytischen Forschung über sprachliche Handlungstypen ist der von Levinson (1979) geprägte Begriff „activity type“ erwähnenswert. Mit „activity type“ unterstreicht Levinson (1979) die enge Verbindung zwischen der sprachlichen Bedeutung und den menschlichen Handlungen. Er charakterisiert „activity type“ als zielgerichtetes, sozial konstituiertes, abgrenzbares und hinsichtlich u.a. der Beteiligten, des Settings und der erlaubten Beiträge beschränktes kommunikatives Ereignis (Levinson 1979: 368). Das deckt sich mit dem Konzept kommunikativer Gattung. Aber trotzdem gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen „activity type“ und „kommunikativer Gattung“. Nach Birkner (2001: 40–41) ist der Zweck von Gattungen die Lösung gesellschaftlicher Probleme, während das Ziel des „activity type“ in den rationellen Plänen individuell Handelnder angesiedelt ist.