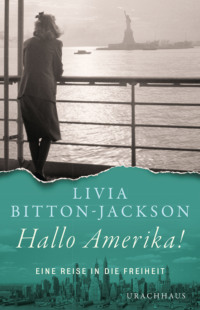Kitabı oku: «Hallo Amerika!», sayfa 3
Können Märchen wahr werden?
Heute um elf haben Mutter und ich einen Termin bei der HIAS, wo wir unsere Betreuerin kennenlernen werden. Tante Celia, die in einer Krawattenfabrik arbeitet und dort Baumwollfutter in Seidenschlipse näht, nimmt sich den Tag frei, um uns in der Brighton-Linie nach Manhattan zu begleiten, wo unser Treffen mit der Betreuerin stattfinden soll.
Bei dieser Fahrt kann Tante Celia uns die Nutzung der New Yorker U-Bahn erklären – wie man für fünf Cent ein »Token« kauft, wie man dieses in den Schlitz am Drehkreuz steckt, dessen Arme nach vorne dreht und dabei durchgeht.
Sie warnt Mami: »Pass bloß auf, dass du schnell genug bist. Wenn du trödelst, sind deine fünf Cent futsch. Dann musst du ein neues Token besorgen und alles nochmal machen.« Da Mami total besorgt aussieht, fügt sie aufmunternd hinzu: »Keine Angst, Laurika, du schaffst das schon. Schau mir zu. Ich gehe als Erste durch.«
Geschafft! Sowohl Mutter als auch ich überwinden das U-Bahn-Drehkreuz ohne Probleme. Es ist Vormittag und die Brighton-Linie ist leer; wir drei sind zunächst die Einzigen im Wagen. Erst als wir uns Manhattan nähern, steigen weitere Passagiere ein. Sie nehmen schweigend Platz, starren ausdrucklos vor sich hin und verlassen die Bahn ebenso wortlos. Sie grüßen beim Einsteigen weder uns noch jemand anderen, wechseln während der Fahrt kein Wort miteinander und verabschieden sich auch nicht. Es gibt keinerlei Blickkontakt zwischen den Passagieren. Sie verhalten sich, als würden sie einer Geheimgesellschaft mit Schweigegelübde angehören oder sich gegenseitig als Feinde betrachten. Keine Ahnung, warum.
»In Europa reden die Menschen im Zug miteinander. Warum begrüßt man hier nicht mal den, der neben einem sitzt?«, frage ich Tante Celia im Flüsterton.
»Du musst nicht flüstern«, meint Tante Celia. »Keiner hier versteht Ungarisch. Anfangs fand ich das auch komisch: kein Hallo, kein Guten Tag, kein Guten Abend, und zwar nicht nur in der U-Bahn, sondern auch im Bus oder in den Geschäften. Wenn du Hallo oder Guten Tag sagst, sehen sie dich an, als seist du krank. Aber man lernt eben schnell. Jetzt, nach zwei Jahren, erinnere ich mich gar nicht mehr daran, dass ich die Leute an öffentlichen Orten gegrüßt habe.«
»Aber das kommt mir so unfreundlich vor. Sind die Amerikaner ein unfreundliches Volk?«
»Nein, aber das gehört eben zu ihrer Kultur. Du wirst dich schon daran gewöhnen.«
Mutter sieht sich die Kleider der Frauen an. Was trägt man hier, was ist die neueste Mode?
»Die Röcke sind hier viel länger«, stellt sie fest. »Und die Farben sind insgesamt eher dunkel. Ich sehe viel Braun, Grau und auch Schwarz. Verrückt, oder? Ich dachte, es wäre genau andersherum. Europa soll doch so konservativ sein, und nicht Amerika!«
Eine halbe Stunde brauchen wir bis zu unserem Ziel. Von der U-Bahn-Station zur HIAS sind es dann noch einmal fünf Minuten zu Fuß. Obwohl wir etwas zu früh dran sind, führt uns die Rezeptionistin sofort in einen der Büroräume. Tante Celia muss im Gang warten.
»Laura und Elvira Friedman sind da.«
Eine untersetzte Frau mittleren Alters sitzt hinter einem massiven Mahagonischreibtisch.
»Ich bin Mrs. Ryder, Ihre Betreuerin«, sagt sie mit tiefer, ausdrucksloser Stimme, während sie vor sich auf dem Tisch einen Aktenstapel durchsucht.
Ganz offenbar haben Mutter und ich schon einen eigenen Ordner. Als Mrs. Ryder ihn schließlich gefunden und kurz überflogen hat, erklärt sie uns ihre Funktion als Betreuerin: Sie stellt unsere Verbindung zur HIAS dar, organisiert die hier angebotenen Hilfsleistungen und wird uns bei der Suche nach Wohnung, Arbeit und medizinischer Versorgung unterstützen.
»Haben Sie Fragen?«
»Ja. Darf ich für meine Mutter übersetzen und sehen, ob sie etwas wissen möchte?«
Mrs. Ryder nickt, und nachdem sich Mami meine Zusammenfassung auf Ungarisch angehört hat, ruft sie: »Medizinische Versorgung? Das ist sehr gut. Wir brauchen einen Arzt, der sich um deine ständigen Magenschmerzen und deine Appetitlosigkeit kümmert.«
»Wir haben hier eine Liste mit Ärzten, die schon für die HIAS gearbeitet haben«, meint Mrs. Ryder. »Schauen wir mal, ob es einen in Ihrer Nähe gibt. Hier habe ich einen. Dr. Alexander Hirschfield, ein Praktischer Arzt mit dem Schwerpunkt innere Medizin. Seine Praxis ist in der Thirteenth Avenue in Brooklyn, das ist nicht allzu weit von Ihnen entfernt. Soll ich für Sie einen Termin vereinbaren?« Sie nimmt den Hörer ab.
»Ja, gern. Danke. Das wäre sehr freundlich.«
»Dr. Hirschfield hätte am Nachmittag Zeit für Sie.« Mrs. Ryder legt ihre Hand auf die Sprechmuschel des Telefons. »Um 14 Uhr – soll ich Sie anmelden?«
Ich nicke eifrig, und sie notiert den Termin auf einem Blatt Papier.
Mutter und ich sind unendlich dankbar. Aber so gern ich diesem Gefühl auch Ausdruck verleihen möchte, ist mein Englisch ist doch viel zu beschränkt. Ich kann nur noch ein weiteres Mal »Danke« sagen.
»Danke«, sagt auch Mutter, als wir zur Tür hinausgehen.
Wieder daheim angekommen, können wir schnell etwas zu Mittag essen. Da sich Tante Celia freigenommen hat, begleitet sie mich zum Arzt. Der Weg ist recht kompliziert und man muss zwei Busse nehmen, um zur Thirteenth Avenue und Fifth Street im Bereich Borough Park zu gelangen.
Leider verspäten wir uns um eine halbe Stunde. Und es ist mir furchtbar peinlich, für eine angemessene Entschuldigung nicht genug Englisch zu können, also nicht erklären zu können, dass ich erst vor zwei Tagen in Amerika angekommen bin und Tante Celia die Fahrtdauer wohl falsch eingeschätzt hat … ebenso wie die Warte- und Umsteigezeit. Dabei entgeht mir, dass sich Dr. Alex Hirschfield für diese Entschuldigung gar nicht interessiert.
Was mir außerdem entgeht, sind – wie Tante Celia es später formuliert – »ein merkwürdig verträumter Blick des Doktors bei Aufnahme der Krankengeschichte, als sei um ihn herum Nebel« sowie »das selige Lächeln, das ihm nach der Untersuchung im Gesicht stand«.
»Nach einer Untersuchung, die ewig gedauert hat! Er ist mondsüchtig, der arme Tropf!« Tante Celia blinzelt mir zu. Ungeachtet meiner Proteste zieht sie mich den ganzen Heimweg über damit auf, dass ich ohne jede Rücksicht »einen netten, harmlosen Arzt verhext« hätte. Als wir dann ankommen, stürmt sie geradewegs in die Wohnung und berichtet Mutter und Onkel Martin, bei mir sei vom Medizinischen her alles unter Kontrolle, wobei man »dasselbe nicht von diesem armen Arzt sagen kann, der hoffnungslos krank ist – liebeskrank«.
»Unsinn!«, rufe ich betreten. »Dr. Hirschfield ist einfach ein Arzt, der sich um seine Patienten kümmert. Mein Magengeschwür macht sich bemerkbar, und es wird ein paar Tests geben. Was soll er denn machen? Ein blutendes Magengeschwür ignorieren? In München war ich damit zwei Monate im Krankenhaus!«
Aber nichts von dem, was ich sage, scheint diese drei irgendwie zu beeindrucken. Sie hören einfach nicht auf, mich zu hänseln.
Am Abend klingelt das Telefon, und fast schon ausgelassen verkündet Tante Celia: »Elli. Für dich. Es ist Dr. Hirschfield!«
»Hab ich’s nicht gesagt? Ist er jetzt mondsüchtig oder nicht?«, meint Celia hämisch, als ich später auflege.
»Was gibt’s denn da zu lachen?«, frage ich. »Er wollte wissen, wie es mir geht, und hat gesagt, ich soll morgen in die Praxis kommen. Die Tests müssen so schnell wie möglich durchgeführt werden.«
Am Dienstag muss mich Tante Celia nicht zu Dr. Hirschfields Praxis begleiten. Es ist im Gegenteil so, dass ich einen kürzeren Weg ausfindig mache und diesmal bereits vor dem vereinbarten Termin da bin.
Ein breites Grinsen überzieht das Gesicht des Arztes, als er mich unter den Patienten im Wartezimmer entdeckt.
»Ah, Miss Friedman, Sie sind pünktlich!«, ruft er freudig, und auf seiner linken Wange erkenne ich ein Grübchen. »Bitte, kommen Sie ins Sprechzimmer.«
Dr. Hirschfield freut sich wie ein Kind, mich zu sehen. Sein Glück scheint keine Grenzen zu kennen. Als würde ich über ein Radarsystem verfügen, nehme ich unmittelbar nach Betreten des Sprechzimmers seine Ausstrahlung wahr und lasse mich von seiner Begeisterung anstecken.
Die medizinische Untersuchung verwandelt sich in eine emotionale Begegnung. Dr. Hirschfield möchte »alles« über mich wissen, über mein Leben, und speziell über meine Erlebnisse während des Holocausts.
»In welchem Konzentrationslager waren sie?«, fragt er, und seine tiefblauen Augen leuchten ausdrucksvoll. Ich erkenne darin Mitgefühl und Schmerz. Außerdem noch etwas, das ich nicht recht benennen kann.
»Zuerst in Auschwitz und dann …«
»Auschwitz!«, unterbricht er laut. »Verzeihen Sie … aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der in Auschwitz war!« Er nimmt meine Hand, und die Tränen schießen ihm in die Augen. »Mein armes Kind. Ich möchte Ihnen etwas sagen, das ich noch niemandem erzählt habe. Ich bin in Deutschland geboren und … sowohl mein Vater als auch meine Mutter sind in Auschwitz ums Leben gekommen. Und Sie … Sie waren dort und sind der Hölle entkommen, die meine Eltern verschlungen hat – mein Engel. Ich werde der HIAS auf ewig danken, dass sie Sie zu mir gebracht hat.«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bis ins Mark erschüttert mich dieser Ansturm der Gefühle – seiner ebenso wie meiner.
»Ich verspreche, dass ich Sie wieder gesund machen werde. Wie ein Bruder kümmere ich mich um Sie. Ich möchte Sie für alles entschädigen, was Sie durchmachen mussten – wenn Sie mich lassen.« Sein Blick ist eine einzige Bitte. »Wenn Sie mich nur lassen.«
»Dr. Hirschfield …«
Ich habe einen Frosch im Hals und drohe zu ersticken. Ich kann nicht atmen. keinen einzigen Ton kann ich von mir geben.
»Sagen Sie doch bitte Alex zu mir. Okay, Elli?«
Ich hole tief Luft.
»Ja«, krächze ich, und erneut droht ein Schwall Tränen meine Worte zu ertränken. »Ich sage gern ›Alex‹. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Wissen Sie, ich fürchte mich ein bisschen … habe ein bisschen Angst. Angst vor Amerika. Es gibt so vieles, das ich nicht verstehe. Ich brauche einen Freund. Danke für das Angebot – ist Angebot das richtige Wort? Danke für das Angebot, mein Freund zu sein.«
»Mein armes Kind. Ihr Freund zu sein, würde mich glücklich machen, Elli – wenn Sie mich lassen. Etwas Schöneres gibt es nicht! Mein Engel, ich muss jetzt weitermachen. Die anderen Patienten warten. Hier ist eine Liste mit den Tests, die Sie machen müssen. Ich vereinbare die Termine und richte mir die Arbeit hier so ein, dass ich Sie begleiten und überall mit dabei sein kann.«
»Wann werden die Tests sein? Wissen Sie, Herr Doktor … ich meine, Alex. In den nächsten zehn oder elf Tagen feiern wir das jüdische Pessachfest …«
»Selbstverständlich. Wir machen sie dann eben nach Pessach. Das muss sowieso erst alles organisiert werden. Auf Wiedersehen und bis bald – mein Engel!«
Alex umarmt mich fest, aber doch zärtlich und wohlwollend – und liebevoll. Die Umarmung eines Freundes. Oder eines Vaters?
Ich fühle mich wie Aschenputtel in den Armen des Prinzen. Ist Dr. Hirschfield vielleicht mein Prinz? Kann das sein? Passiert mir das hier tatsächlich?
Sind Märchen in Amerika die Wirklichkeit?
Vorbereitungen für Pessach
»Einfach ein perfektes Timing«, sagt Onkel Martin. »Wir feiern eure Ankunft in Amerika, dem Land der Freiheit, zusammen mit Pessach, dem Fest der Freiheit. Was für ein schöner Zufall!«
Ich bin durch diese Symbolik aufgeregt und gerührt zugleich. Obwohl das Judentum Omen ablehnt, sie als Aberglaube einstuft und deshalb verbietet, habe ich, wie ich zugeben muss, Zufälle immer als geheime Botschaften betrachtet. Deshalb scheint mir auch jetzt der Umstand, dass wir so kurz vor dem jüdischen Feiertag der Freiheit angekommen sind, ein gutes Omen für unsere Zukunft in Amerika zu sein.
Es ist aber wie eine Ironie des Schicksals, dass die Tage vor Pessach für eine jüdische Hausfrau die reine Sklaverei sind. Noch vor dem Kochen und Backen der Feiertagsspeisen, und speziell derer für das Hauptereignis, den Seder-Abend, muss die Wohnung von allem befreit werden, was an gesäuertem Brot und sonstigen Essensresten vorhanden ist. Wegen der drastischen Säuberungsaktionen meiner Mutter waren die Tage vor Pessach seit jeher furchtbar für mich.
Jetzt ist es Tante Celia, die eifrig mit dem Frühjahrsputz und Millionen anderer Festtagsvorbereitungen beschäftigt ist. Sie kommt um sechs aus der Fabrik heim und stürzt sich sofort in die Hausarbeit.
»Warum können wir dir nicht zur Hand gehen?«, fragt Mutter zum x-ten Mal. »Elli und ich fühlen uns so nutzlos, wenn wir nur dastehen und dir bei der Arbeit zusehen. Warum gibst du uns nicht irgendetwas zu tun?«
»Auf keinen Fall!« Celia fuchtelt abwehrend mit den Armen. »Auf keinen Fall! Ihr seid hier Gäste. Ich habt euch noch gar nicht von der Reise erholt. Ihr seid erst drei Tage hier. Ruht euch erstmal aus. Später könnt ihr dann noch genug arbeiten.«
»Vier Tage«, korrigiert Mutter ihre jüngere Schwester. »Wir sind seit vier Tagen hier und haben uns genug ausgeruht. Höchste Zeit, dass wir auch etwas tun«, protestiert Mutter, während sie hilflos dabei zusieht, wie Tante Celia den kleinen Teppich im Flur zusammenrollt, zum Fenster trägt, ihn über dem Sims wieder ausrollt und dann, in jeder Hand einen Tennisschläger, energisch ausklopft. Dann greift sie zum Putzeimer und spritzt Seifenwasser auf den Linoleumboden, während meine Mutter und ich zurücktreten, um nicht im Weg zu sein und Tantchens Wisch-Aktion den nötigen Raum zu geben.
»Aber das ist doch absurd!«, ruft Mutter. »Wie können wir ruhig dastehen, während du dich nach einem harten Tag in der Fabrik auch noch hier krumm schuftest? Du musst Elli und mich auch etwas machen lassen.«
»Ihr kennt die Wohnung nicht und wisst weder, wo alles ist, noch, was zu tun ist und wie. Es ist einfacher, wenn ich es selbst mache«, erklärt Tante Celia, während der Wischmopp in ihren Händen die Seifenlauge auf dem Boden verteilt. »Warum setzt ihr euch nicht auf die Wohnzimmercouch, bis Martin heimkommt? Dann essen wir zu Abend. Vielleicht reden wir im Anschluss über eine Mithilfe eurerseits.«
Mutter, die nicht daran gewöhnt ist, den Anweisungen ihrer jüngeren Schwester zu folgen – wie übrigens auch von niemandem sonst –, geht grummelnd ins Wohnzimmer, und ich folge ihr.
»Tante Celia«, beginne ich nach dem Abendessen das Gespräch in der Hoffnung, Mutters Argumenten zuvorzukommen und eine Konfrontation dieser beiden willensstarken Frauen zu vermeiden. »Wir wissen, dass du uns von der Hausarbeit entbinden willst, damit wir uns wohlfühlen. Dabei würden wir uns noch wohler fühlen, wenn wir dir helfen könnten.«
»Gut formuliert«, lobt mich mein Onkel. »Meine liebe Nichte, ich denke, du solltest eine Diplomatenlaufbahn anstreben. Aber Spaß beiseite: Celia, warum gibst du Laura und Elli keine Aufgabe, wenn sie dir schon helfen wollen?«
Meine Tante gibt nach. »Okay, ihr fleißigen Lieschen. Ihr könnt für mich die Einkäufe erledigen. Wenn ich abends heimkomme, sind die Geschäfte am Kings Highway schon zu. Das wäre wirklich eine große Hilfe. Ich mache eine Liste mit Lebensmitteln, Brot, Obst und Gemüse, sowie ein paar Dingen für den Haushalt. Die Geschäfte dafür sind alle auf dieser Seite des Kings Highway, außer dem Bäcker. Hinter der U-Bahn-Station gibt es eine Woolworth-Filiale, und dort findet ihr alles, was ich außerdem aufliste, also Nähgarn, Schuhwichse und Zahnpasta.«
»Kennst du die englischen Ausdrücke dafür?«, fragt mich Mutter, nachdem sie Celias auf Ungarisch geschriebene Liste angesehen hat.
Ich werfe einen Blick auf den Zettel. »Ich hoffe. Wenn nicht, schlage ich im Wörterbuch nach.«
Aus der Besenkammer holt Tante Celia eine Apparatur aus Aluminium.
»Seht ihr das? Das ist mein Einkaufswagen. So könnt ihr ihn aufmachen und eure Taschen mit Obst, Gemüse und sonstigem verstauen. Ihr müsst die schweren Sachen also nicht in der Hand tragen.«
Meine superpraktische Mutter ist ganz begeistert von dem Einkaufswagen, auch weil man ihn flach zusammenlegen und deshalb leicht verstauen kann.
Nachdem Tante Celia und Onkel Martin am nächsten Morgen zur Arbeit gegangen sind, begeben Mutter und ich uns ganz abenteuerlustig auf Einkaufs-Expedition. Unsere gute Laune scheint ansteckend zu sein: Auf der Straße lächeln und winken die Leute uns zu. An den Obstständen staunen wir über das riesige Angebot an Früchten und Gemüse; das Lebensmittelgeschäft mit seiner reichhaltigen Auswahl an Nahrungsmitteln entpuppt sich als Paradies für Milchprodukte. Sogar Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker und Salz, die in Europa aus großen Säcken in braune Tüten abgefüllt und gewogen werden, befinden sich hier in kleinen, bunt bedruckten Packungen, die in frei zugänglichen Regalen ansprechend arrangiert sind.
In der Bäckerei erhalte ich eine Lektion fürs Leben.
»Wenn Sie wollen, dass Brot und Backwaren knusprig und frisch bleiben«, erklärt der Bäcker, »dürfen Sie sie nie in den Kühlschrank tun. Dort werden sie weich und geschmacklos. Tun Sie sie lieber ins Gefrierfach, solange sie frisch sind. Wenn Sie sie brauchen, werden Sie merken, dass sie schnell wieder aufgetaut und dann so frisch sind wie am Tag, an dem sie gebacken wurden.«
Woolworth, ein »Five-and-Dime«-Geschäft, in dem man so gut wie alles bekommt – vom Schnürsenkel bis zum Handkarren – und kleine Artikel nur einen Nickel, also fünf Cents, oder einen Dime, also zehn Cents, kosten, ist das Mekka der Neuankömmlinge. Wir kaufen einen Kamm, Nähgarn, Nadeln, Wolle zum Stricken, Zahnpasta, Schuhcreme, einen Handspiegel sowie ein kleines Näh-Set, das wir Tante Celia schenken wollen.
Beim Verlassen des Woolworth-Geschäfts erhält unsere gute Laune einen herben Rückschlag: Der Einkaufswagen, den wir draußen stehen gelassen haben und in dem all unsere Einkäufe waren, ist verschwunden! Wie ist das möglich? Vielleicht haben wir ihn im nächsten Hauseingang abgestellt. Dort ist er auch nicht. Vielleicht hat ihn jemand ins Geschäft gebracht. Wir laufen zum Filialleiter, um dort nachzufragen.
»Wo haben Sie den Einkaufswagen gelassen?«, fragt der Filialleiter ungläubig. »Vor dem Geschäft? Auf der Straße? Was haben Sie denn erwartet?«
Was wir erwartet haben? Na ja – ihn dort vorzufinden, wo er abgestellt wurde. Nicht erwartet haben wir, dass es in diesem reichen, offenherzigen Land gemeine Diebe gibt.
Aber anstatt sich am Abend über den Verlust aufzuregen, verwandelt Tante Celia die Niederlage mit ihrem Stegreif-Humor in eine Farce – und mildert damit unsere Zerknirschung.
»Darf ich vorstellen? Meine Familie aus Timbuktu!«, prustet sie los, als sie unsere traurige Geschichte hört. »Dies ist Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten – auch für unfähige Diebe. Das habt ihr heute bewiesen. Ihr habt ein paar amateurhafte Diebe sehr glücklich gemacht!«
»Als Neuankömmling gibt es viel zu lernen«, sagt Onkel Martin versöhnlich. »Ihr habt soeben eure erste Lektion erhalten: Niemals die eigenen Sachen unbeaufsichtigt lassen, nicht einmal für eine Sekunde. Es tut mir leid, dass ihr das in dieser Form lernen musstet, aber betrachtet es einfach als Kursgebühr.«
Alle Nachbarn, die von unserem Erlebnis hören, zeigen genau wie mein Onkel Mitgefühl und geben uns denselben Rat wie er. Ein paar Hausbewohner sind erst vor kurzem eingewandert und versuchen uns zu trösten. Sie versichern uns, dass wir bald genug Geld verdienen, um den Schaden zu begleichen, und die Sache irgendwann vielleicht ganz vergessen.
»Bald denken Sie gar nicht mehr daran«, prophezeit ein Nachbar.
»Aber vergessen Sie nicht die Lektion, die Sie gelernt haben«, ergänzt ein anderer.
Für mich gibt es noch eine zweite Lektion, wobei die nichts mit materiellem Verlust zu tun hat. Hier geht es eher um den Verlust von Vertrauen – um einen Rückschlag, der tief in mir eine bestimmte Saite zum Schwingen bringt. Ich hatte nicht damit gerechnet, in Amerika betrogen zu werden, noch dazu in der Stadt aus Papas Träumen.
Vor dem Beginn der Pessach-Woche ruft Alex an, um uns schöne Feiertage zu wünschen. Seine Stimme mit der ihr eigenen Wärme sorgt dafür, dass ich mich wieder besser fühle.
Pessach ist eigentlich ein fröhliches Fest. Tante Celias Wohnung ist blitzblank, und der Esstisch strahlt mit einem neu gekauften Edelstahlbesteck und weißem Melamingeschirr. Von ihren Silbersachen ist nur der alte Kandelaber »noch von daheim«, ausgegraben aus dem Kellerboden, wo er während der Nazi-Zeit versteckt lag.
Der Tisch ist für sieben Personen gedeckt. Zwei Gäste gesellen sich am Seder-Abend zu Onkel Martin, Tante Celia, Mutter, Bubi und mir, nämlich Margit Fried und Miklos Benedict, zwei einsame Überlebende. Margit, Celias »Lager-Schwester«, und Miklos, ein Nachbar von »daheim«, kennen sich noch nicht, und meine Tante hat die beiden mit geheimen Absichten eingeladen.
»Zieh dein marineblaues Seidenkleid an«, rät sie Margit. Das mit dem weißen Kragen. Das steht dir extrem gut. Miklos ist zu haben – und er mag gutaussehende Frauen.«
Margit, deren Mann und Sohn auf verschiedenen Schlachtfeldern ums Leben kamen, hat das blaue Seidenkleid an und ein höfliches, schüchternes Lächeln im Gesicht, als sie über den Tisch hinweg zu Miklos sieht, dessen Frau und drei Kinder in der Gaskammer von Auschwitz erstickt sind und der, tipptopp herausgeputzt mit blütenweißem Hemd und karierter Krawatte, etwas ungeschickt mit seinem Besteck hantiert.
Wir alle tragen unsere schönsten Sachen, und die Männer sehen geradezu blendend aus in ihren neuen, weißen Hemden, die Mutter als Beitrag zu den Festtagsvorbereitungen auf einer geliehenen Singer-Maschine genäht hat. Mein Herz ist wie eines dieser neuen Kristallgläser, die bis obenhin mit perlend-rotem Tokajerwein gefüllt sind. Glücklich betrachte ich meinen Bruder, den ich so viele Jahre nicht gesehen habe. Stolz lausche ich seinem gelehrten Vortrag der Haggada, also der Pessach-Erzählung, und voller Dankbarkeit denke ich an die noch zarte, junge Freundschaft mit Alex. Wie schön es wäre, wenn er heute bei uns sein könnte!
Der herrliche Geruch von Hühnersuppe dringt vermischt mit dem Duft des Truthahnbratens aus der Küche zu uns herein. Tante Celia ist eine hervorragende Köchin, und in freudiger Erwartung eines Essens an ihrem Tisch singt unsere kleine Runde die Lieder der Pessach-Haggada mit besonderer Inbrunst.
Der Seder-Abend ist ein bittersüßes Ereignis. Wie feiern unsere Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei und denken gleichzeitig an unsere jüngste Sklaverei in Deutschland. Wir singen lauthals von den Wundern, die uns am Roten Meer und in der Wüste Sinai gerettet haben, und beweinen schweigend unsere schmerzhaften Verluste in Auschwitz, Dachau und den über ganz Europa verteilten Arbeitslagern. Als Margit und Miklos sich über den Tisch hinweg ansehen, kann ich erkennen, wie sich in der Wiederspiegelung der beidseitigen Trauer ein gemeinsamer Funke bildet. Und mein Herz klopft aus Dankbarkeit für das Wunder des Überlebens. Für das Wunder des Lebens.
Unser erster Seder-Abend in Amerika – er ist definitiv ein fröhliches Fest.
Er ist definitiv ein gutes Omen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.