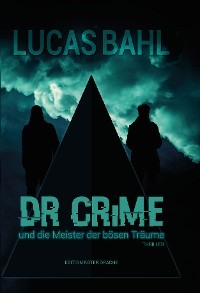Kitabı oku: «Dr Crime und die Meister der bösen Träume», sayfa 4
FOLGE 5
WAS BISHER GESCHAH
Dr Crıme sieht einem qualvollen Tod ins Auge.
Die zum Schmiedehammer degradierte Hush Puppy durchbrach meine Deckung.
In diesem Moment löste sich der Schuss.
Mit einem trockenen Plopp traf die 9 mm Kugel Robertos Bauch und trat – ein unschönes, fast faustgroßes Loch hinterlassend – am Rücken wieder aus. Wie in Zeitlupe schleuderte er die Smith & Wesson von sich, aber es war längst zu spät.
Befand sich trotz der Ladehemmung eine Patrone in der Kammer? Hatte sich der Sicherungshebel dank meiner Abwehr gelöst?
Ich wusste es nicht.
In diesem Augenblick gehörten diese Fragen zu den Dingen, die mich am wenigsten interessierten. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist mein gegenwärtiges Interesse daran bestenfalls akademischer Natur. Seinerzeit war ich einfach froh, dass meine Pistole irgendwann doch noch funktioniert hatte – wenn auch viel zu spät. Trotzdem bewies sie ihre im wahrsten Sinn des Wortes umwerfende Wirkung. Man spricht in solchen Zusammenhängen gerne von der mannstoppenden Durchschlagskraft einer Waffe. Meiner Ansicht nach deutet dieser Begriff noch nicht einmal die halbe Wahrheit an.
Ich kann mich zudem nicht mehr daran erinnern, wie es mir, kaum dass Roberto zu Boden gegangen war und langsam verblutete, mit meinen kaputten Händen gelungen war, ihm den Colt Python aus dem Hosenbund zu ziehen.
Jetzt war er paralysiert und schaute unter leise flatternden Lidern zu mir auf, während ich den Revolver mit den beiden pochenden, blutigen Fleischklumpen, die einmal meine Hände gewesen waren, umklammert hielt. Ich saß auf dem harten Vulkangestein und er lag vor mir und röchelte leise. Das durch den roten Staub gedämpfte Geräusch des Windes, mein unwillkürliches Gewimmer, das ich unmöglich abzustellen vermochte, und sein mit leisem Blubbern unterlegtes Geröchel waren die einzigen Geräusche, die in dem von rotbraunen Schlieren umwaberten Platz inmitten des schwarzen Labyrinths zu hören waren.
Wir starrten uns an.
Jedenfalls habe ich es so in Erinnerung, dass auch er mich während der letzten Minuten seines Lebens mit seinem Blick zu fixieren versuchte, während ich ihm, ebenfalls mehr tot als lebendig, beim Sterben zusah.
Leise sagte ich auf Deutsch:
„Wie süß ist es, zu träumen nach den Leiden
Den Traum, in Licht und Erde zu zerfallen,
Nichts mehr zu sein, von allem abzuscheiden,
Und wie ein Hauch der Nacht hinab zu wallen …“
„Was erzählst du da?“, keuchte Roberto.
„Georg Heym“, sagte ich.
„Was bedeutet das?“
So gut ist mein Spanisch nicht, dennoch ich tat mein Bestes und übersetzte die Verse.
„Du bist ein Dichter“, flüsterte er.
„Nicht ich“, sagte ich, „das ist …“, doch da war er bereits tot.
„Ein Falter kommt die Schlucht herab. Er ruht
Auf Blumen. Und er senkt sich müd
Der Wunde zu, dem großen Kelch von Blut,
Der wie die Sammetrose dunkel glüht.“
Ich sah zwar weit und breit keine einzige Blume, aber ich wollte keinesfalls den Schluss des Gedichtes ungesagt lassen, auch wenn er mich nicht mehr hören konnte. Das mag ein normal denkender, normal empfindender Mensch als abartig, als pervers empfinden, doch selbst bei einem so hochgradig brutalen und skrupellosen Typen, wie es Roberto gewesen war, der mich nur Minuten zuvor auf höchst grausame Weise zu Tode foltern wollte, fiel es mir schwer, ihn wortlos gehen zu lassen.
Ich glaube nicht an Gott. Aber an den Teufel. Ihm begegne ich Tag für Tag – nicht zuletzt in Gestalt von Leuten wie Roberto. Mir würde nie einfallen, für die Seele meines Opfers zu beten, wie es der ein oder andere Kollege tut. Zumindest wird dergleichen dann und wann erzählt. In dieser Situation, in der ich es purem Glück zu verdanken hatte, überhaupt überlebt zu haben, in der ich zu meiner Rettung nichts anderes beigetragen hatte, als so lange durchzuhalten, wie ich durchgehalten habe, ist es zudem unangebracht, von Roberto als Opfer zu reden.
Wir waren beide gleichermaßen Täter und Opfer.
Schon vor vielen Jahren entdeckte ich die wunderbare Kraft der Poesie. Doch letztlich ist es mir egal, ob die Verse, die ich zitiere, den Sterbenden den Übergang zum Tod erleichtern. Ich denke, es ist angemessen und ich weiß, dass es mir gefällt. Nur darauf kommt es an.
Wenn ich mir heute die Ereignisse auf Lanzarote wieder ins Gedächtnis rufe, sehe ich eine Parallele zu Leon Walters neuem Job. Ich habe schon viele Leute sterben sehen. Und meistens fielen mir passende Verse ein, die ich irgendwann einmal auswendig gelernt habe. Aber der exakte Augenblick, wann noch ein Funken Leben durch den Körper zuckt und wann genau der Tod eintritt, ist beim besten Willen allein mittels menschlicher Wahrnehmung nicht exakt zu bestimmen. Beim Todeszeitpunkt bleibt für unsere Wahrnehmung immer das Moment der Überraschung und der Unschärfe. Mit der Präzision einer Stoppuhr, die auf eine hundertstel Sekunde genau den Zieleinlauf eines Sprinters feststellen kann, mögen die Apparate der modernen Medizintechnik hierbei Abhilfe schaffen. Doch wann hat ein Auftragsmörder solche Technik zur Hand?
Was ich sagen will: Diese Unschärfe in der Wahrnehmung korreliert mit jener Unbestimmtheit, die im Forschungsgegenstand von Frau Professor Dr. Meltendonck ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Ihr Institut erforscht – unter der Hand finanziert durch Geldquellen, die der Meister angebohrt hat – den schmalen Bereich zwischen Wachsein und Schlaf. Die wenigen Augenblicke, die im subjektiven Empfinden genauso schlecht zu erfassen sind wie der Übergang vom Leben zum Tod. Das ist der Bereich, in dem die Grenze zwischen der harten alltäglichen Realität und der nebulösen, kaum fassbaren Welt der Träume verschwimmt. Und in denen sich die Fakten der Wirklichkeit mit denen der Einbildung und des Unbewussten so stark vermischen, dass sie nicht mehr voneinander unterschieden werden können.
Doch ich sollte mich hier nicht zu sehr in vagen Reflexionen verlieren, wenn es noch das Ende jener Lanzarote-Episode zu schildern gibt. Praktischerweise hatte sich Roberto die Nähe eines kreisrund im schwarzen Boden gähnenden Schlotes für sein Ableben ausgesucht. Ich stattete ihm einen stummen Dank ab, da er mich nicht dazu zwang, in meinem lädierten Zustand seine Leiche in der brütenden Hitze noch allzu weit schleppen zu müssen.
Es gibt wenige Plätze, die zum Entsorgen von Toten besser geeignet sind als die Magma-Kamine, die einem die ganze Zeit zuzuflüstern scheinen, dass sie bis in den Erdkern hinab reichen.
Roberto dort hinabzustoßen, war trotz der Umstände der einfachere Teil dieser Arbeit. Dabei hinterließ der über den schwarzen Vulkanboden geschleifte Körper eine dunkelrote blutige Spur, die sich am Ort, wo er zusammengebrochen war, zu einem Gebilde erweitert hatte, das mit einiger Phantasie tatsächlich wie eine Blüte auf schwarzem Grund aussah. Hier war sie: die Blume, die die Verse Heyms evoziert hatten. Ein temporäres Gemälde, mehr abstrakt als realistisch. Rasch versuchte ich es mithilfe meiner Füße, so gut es ging, mit Asche und Geröll auszulöschen. Das war alles andere als eine professionelle Spurenbeseitigung, aber mehr war nicht drin.
Ich schleppte die Tasche mit Robertos Geld zu dem Versteck, in dem ich bereits mein Geld vor neugierigen Blicken verborgen hatte. Dabei stellte ich fest, dass der von mir getötete Mr. X offensichtlich den besseren Geschäftssinn der verfeindeten Eheleute besessen hatte. Roberto war – soweit es mir ein rascher Blick in seine Tasche offenbarte – für kleineres Geld tätig geworden. Unwillkürlich kam mir der Gedanke, dass er sein Honorar womöglich auf mehrere Verstecke verteilt hatte. Doch ob er billiger zu haben gewesen war oder bereits zuvor ein anderes Depot angelegt hatte, gehörte zu den Unbekannten der seltsamen mörderischen Gleichung, in die ich mich verstrickt hatte.
Meine Hush Puppy wollte ich nach diesen Ereignissen nicht mehr behalten und entsorgte sie zusammen mit der Leiche in dem Schlot. Die kostbare Python dagegen verstaute ich zusammen mit dem Geld. Es sollten einige Jahre vergehen, bis ich wieder hierher kommen konnte, um alles wohlbehalten in dem Versteck vorzufinden und zu bergen.
Dass ich überhaupt in der Lage war, all dies in dem Zustand, in dem ich mich nach der Folter durch Roberto befand, noch zu erledigen, lässt sich nur durch die Aktivierung mir bisher unbekannter Kraftpotenziale erklären, über die mein Körper verfügte.
Dessen ungeachtet brauchte ich Hilfe. Und zwar dringend.
Es gelang mir zwar unter größten Mühen und unsäglichen Schmerzen, wenigstens den einen oder anderen Finger bewegen zu können, was mir zeigte, dass nicht alles in meinen Handgelenken zerschmettert worden war, aber ich sah mich außerstande, die Schmerzen noch sehr lange aushalten zu können. Als finalen Akt schaffte ich es noch, den am Rand des Felslabyrinths geparkten Wagen zu starten. Die normalerweise pechschwarze Asphaltstraße war von einem dünnen rötlich-braunen Staubfilm überzogen. Das half mir, um den Leihwagen kurz vor dem Dorf, von dem aus heutzutage die Touristen auf Dromedaren in den vulkanischen Naturpark geführt werden, zum Schleudern zu bringen und mit quietschenden Reifen und lautem Getöse in einer finalen Kollision gegen einen Felsen krachen zu lassen.
Das Ergebnis war ein veritabler Totalschaden. Die Leute, die mich wenig später aus dem Wrack zogen und nach Arrecife ins Krankenhaus brachten, sagten, dass es ein Wunder gewesen sei, dass ich diesen Unfall überhaupt überlebt hatte.
Man muss es Menschen des 21. Jahrhunderts erklären. Damals gab es kein ABS, keine Airbags, nicht einmal Sicherheitsgurte waren Standard, erst recht nicht in südlichen Ländern.
Jedenfalls erklärte der Aufprall hinreichend die Verletzungen und bösen Prellungen, die mir in der Mehrzahl Roberto zugefügt hatte. Diejenigen, die ich mir zusätzlich als Ergebnis des selbst inszenierten Crashs zugefügt hatte, waren in der Buchhaltung der erlittenen Schmerzen vernachlässigenswert.
Sie verstehen jetzt, warum ich eingangs angemerkt habe, dass Profis tunlichst die Auseinandersetzung untereinander vermeiden. Selbst der Überlebende verlässt ein solches Schlachtfeld nicht ohne schwere Blessuren.
Auch wenn dieser Vorfall mit dem aktuellen Fall nichts zu tun hat, erklärt er doch meine Vorsicht, als es zu meiner ersten persönlichen Begegnung mit dem Meister kam. Gegenseitiger Respekt ist ebenso wichtig wie klare Absprachen und noch ein ganzes Bündel weiterer Vorkehrungen und Maßnahmen. Wir wollten miteinander ins Geschäft kommen. Da empfiehlt es sich, so viel wie möglich vorab klar festzulegen. Das musste allerdings dergestalt geschehen, dass gemeinsame Feinde, sollten sie von dieser Absprache Kenntnis erhalten, keine Anhaltspunkte finden würden, die uns belasten könnten. Zu den Feinden zählen natürlich die nationalen und internationalen Ermittlungsbehörden.
Verträge unter international operierenden Kriminellen sind deshalb noch um ein Vielfaches komplexer und komplizierter als die in der normalen Geschäftswelt. Hier gibt es ein mehr oder weniger gut funktionierendes Regelwerk, an das sich alle Parteien halten sollten. Und tun sie das nicht, sorgt die magische Melange aus Geld und Gerichtsbarkeit für die Klärung der Streitfälle. In der anarchischen Gegenwelt des globalisierten Verbrechens diktiert in der Regel der Stärkere die Gesetze. Dessen ungeachtet gibt es einen grauen Bereich halblegalisierter Absprachen und Verträge. Das sogenannte Ehrenwort unter Gangstern, mündliche Absprachen – forget it! So arbeitet heute niemand mehr. Und auch früher war dies oft nur eine gut gepflegte, romantische Legende.
Eine internationale Riege fürstlich bezahlter, ausgebuffter Anwälte hat sich auf diesen Sektor spezialisiert. Schließlich geht es um sorgfältiges Verschleiern der wahren Absichten – sollte solch ein Vertrag trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal in die falschen Hände fallen – und gleichzeitig um hieb- und stichfeste Absprachen, an die sich Parteien binden, zu deren Geschäftsfeldern nicht zuletzt Betrug und Erpressung gehören. Erschwerend kommt hinzu, dass beim Verschleiern des eigentlichen Geschäftszwecks – etwa eines Auftragsmords oder des Überfalls auf einen Diamantenkurier – die Tat nicht so stark verschleiert wird, dass zum Schluss niemand mehr nachvollziehen kann, worum es eigentlich geht. Andererseits muss alles so formuliert werden, dass Außenstehende daraus nicht einmal ansatzweise etwas Verdächtiges ableiten können.
Moderne Verschlüsselungstechniken helfen dabei enorm und haben die Erarbeitung derartiger Dokumente deutlich erleichtert. Trotzdem ist die Verhandlung solcher Abmachungen eine der heikelsten Phasen solcher Geschäfte. In unseren Tagen werden diese Vereinbarungen nach dem Prinzip des doppelten Schlüssels abgesichert. Die beteiligten Parteien haben nur gemeinsam Zugriff auf den Klartext ihrer Vereinbarung. Fallen das Dokument und auch noch der Schlüssel eines der Beteiligten in unbefugte Hände, bleibt der Vertrag unlesbar. Erst wenn man sich auch des zweiten Schlüssels bemächtigen kann, besteht Zugriff auf den Klartext.
Theoretisch.
Praktisch sieht das Ganze aber so aus, dass noch ein dritter Schlüssel existiert, der in der Regel bei einer Anwaltskanzlei hinterlegt ist. Auch hier kann niemand allein damit etwas anfangen. Und wer ganz sicher gehen will, hinterlegt einen vierten an einer weiteren Stelle. Da die Partner häufig in verschiedenen Ländern oder Kontinenten operieren, müssten Ermittler einer internationalen Polizeiaktion exakt koordiniert an drei bis vier Stellen zeitgleich zugreifen. Und dann sollten sie auch genau wissen, wo diese kleinen Datenpakete versteckt sind. Dass sie sich nicht einfach auf irgendwelchen Rechnern, die darüber hinaus noch mit dem Internet verbunden sind, oder gar in der Datenwolke befinden, versteht sich von selbst. (Überhaupt: Der Begriff der „Cloud“ gehört verboten. Das ist die typische Vernebelungssprache der IT-Branche. Diese Wolke gibt es nicht. Es gibt nur Festplatten und Server.) Jedenfalls sähen die olympischen Goldmedaillengewinner im Synchronspringen gegen eine derartige Polizei-Aktion alt aus. Und wenn etwas mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, dann, dass es irgendwo auf dieser Welt eine Behörde gibt, die in der Lage wäre, derart präzise vorzugehen. Die kleinste Unwucht und die verschlüsselten Daten bleiben, was sie sind: Datensalat.
Burn after reading, aber eleganter.
Die Eleganz der Algorithmen auf der Basis zufällig errechneter, etliche hundert Stellen umfassender Primzahlen, fasziniert mich seit vielen Jahren.
Deshalb fand meine erste persönliche Begegnung mit dem Meister im Rahmen unseres angestrebten Geschäfts nicht heimlich auf dem verregneten Gelände einer einsamen, stillgelegten Kiesgrube statt oder im – dank Rauchverbot – ohnehin nicht mehr stilvoll verqualmten Hinterzimmer einer zwielichtigen Kaschemme, sondern im langweilig-funktional eingerichteten Besprechungsraum einer Kanzlei. Anwesend waren zwei Anwälte, der Meister und ich.
Gastgeber war ein guter Bekannter von mir aus Fürth, Thomas Jaeger. Seine Kanzlei beschäftigt sich nach außen mit Familien- und Arbeitsrecht und hat sich auf dem Gebiet teurer Scheidungen und hochdotierter Abfindungen einen guten Ruf erworben. Was neben mir nur wenige andere wissen, ist, dass er zusätzlich eine Nürnberger Dependance unterhält, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie ihre eigentliche Funktion – nämlich absolut abhör- und weitestgehend einbruchssicher zu sein – hinter einer durch und durch langweiligen, unauffälligen Fassade verbirgt. Man würde hinter der Tür bestenfalls eine schäbige Wohnung oder das ausgelagerte staubige Archiv einer Behörde vermuten. Das Arsenal an dort verbauter Sicherheitstechnik beginnt ein paar Zentimeter hinter den schäbigen Wänden, Türen und Fenstern, knapp unterhalb des Fußbodens und ein paar Millimeter tief in der Decke. Wir saßen gewissermaßen in einem faradayschen High-Tech-Käfig.
Der Meister wurde von Dr. Lisa Bingenheimer, einer jungen Frankfurter Korrespondenzanwältin begleitet, die für Simon, Randolph, Schuler & Hearst, eine Kanzlei aus New York, arbeitete. „Eigentlich bin ich ja gar nicht mehr als Anwältin tätig“, erzählte sie Thomas und mir in einer Verhandlungspause. „Ich habe wieder angefangen zu studieren.“
„Ach ja, und was?“, fragte ich.
„Kunstgeschichte.“
„Dann ist das, was Sie heute hier machen …“, sagte Thomas.
„… die absolute Ausnahme“, unterbrach sie ihn.
… die nur angenommen wurde, weil die Kohle stimmt, ergänzte ich in Gedanken.
„Wir wissen ja beide nicht, was konkret der Inhalt des Auftrags ist, über den wir hier verhandeln und wir wollen das auch gar nicht wissen, aber ich denke, wenn wir die Absprache der Liefer- und der Zahlungsfristen noch präzisieren können, sollte die Vereinbarung für alle Beteiligten akzeptabel sein“, nahm Thomas die Arbeit an den Details des Vertrages wieder auf.
Dr Crıme schwelgt in mehr oder weniger alten Erinnerungen und salbadert über seine Arbeit, doch was macht Leon?
FOLGE 6
WAS BISHER GESCHAH
Dr Crıme verhandelt über einen Vertrag.
DUB:
„Meine Damen. Jetzt brauche ich erst einmal ein Stückchen von dieser köstlichen Eierlikörtorte.“
„Nur zu, meine Liebe, Sie sind ja, wie wir alle, in einem Alter, wo einen Fragen nach Idealgewicht und Figur nicht mehr zu beschäftigen brauchen.“
„Sie können sich diese kleinen Bosheiten sparen, mein Herzchen. Ich weiß, dass ich mit meiner Traumfigur keinen Adonis mehr ins Bett locke.“
„Bitte! Wir wollen doch unsere Zeit nicht damit verschwenden, uns gegenseitig mit Nichtigkeiten zu necken – oder?“
„Ganz recht, meine Teure. Aber ich fürchte, zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht viel mehr feststellen, als dass wir es hier mit einem Idioten-Duo zu tun haben.“
„Einem selbstverliebten Idioten-Duo.“
„Es ist doch immer wieder erstaunlich, meine Damen, dass die Herren der Schöpfung, uns – den Inbegriff der holden Weiblichkeit – für maßlose Schwätzerinnen halten.“
„Ich stimme Ihnen zu. Wir haben es bei unseren beiden Exemplaren nicht nur mit zwei selten dämlichen, selbstverliebten Egomanen zu tun, sondern auch um Prototypen langweiliger, nur um sich selbst kreisender Dummschwafeler. Nur dass sie nicht miteinander schwafeln, sondern jeder für sich und es gibt niemanden, der ihnen zuhört außer sie selbst.“
„Nicht völlig korrekt: Erstens ist es falsch, dass niemand diesen Müll liest. Wir beispielsweise tun es. Zweitens: Die Dämlichkeit wird übertüncht von einer aufgesetzten Intellektualität. Selbstverliebt, nun das zeigt sich so offenkundig an der ausschließlichen Beschäftigung mit ihren ureigenen Egos. Und daraus ergibt sich, wie langweilig sie sind.“
„Genau, also wer will sich damit beschäftigen? Ich fürchte, wir muten uns hier zu viel des Unguten zu.“
„Da muss ich widersprechen. Wir haben längst bewiesen, dass wir in dieser Hinsicht extrem leidensfähig sind. Viel leidensfähiger, als dass uns diese kleinen Geschichten noch ernsthaft erschüttern könnten. Und außerdem …“
„Bevor Sie weitersprechen, werte Freundin! Jetzt und hier sollten wir auf alle Fälle verhindern, dass wir leiden. Lasst uns deshalb erst einmal was bestellen.“
„Herr Ober! Ein Stück Eierlikör-Torte. Meine Damen, was wollen Sie?“
Dr Crıme:
Nachdem die Eckpunkte besprochen waren, zogen sich die Juristen in ein Nebenzimmer zurück, um an den endgültigen Formulierungen zu feilen. Der Meister und ich standen auf und gingen zu den Fenstern, die zusätzlich durch abhörsichere und blickdichte stählerne Rollos geschützt waren. Die Scheiben bestanden aus schusssicherem Glas. Wir ließen die Rollos hochfahren und genossen die Aussicht aus der bis zum Boden reichenden Fensterfront. Etliche Stockwerke tiefer schob sich die übliche Blechlawine Richtung Plärrer. Unser Blick glitt über sie hinweg zur Nürnberger Altstadt und zur Silhouette der Burg. Wir bedienten uns bei den Leckereien, die vor unserem Treffen auf einem Tisch aufgebaut worden waren. Kleine Sandwiches, Gebäck und Obst, verteilt auf drei Etageren.
„Fehlt nur noch der cream tea“, sagte der Meister.
Ich nickte und dachte an die Aussicht, die ich vor kurzem von der Terrasse des Reid’s in Funchal auf Park, Hafen und Meer genossen hatte. Dort wurden cream tea und ähnliche Köstlichkeiten ebenfalls auf Etageren gereicht, während aus den geöffneten Fenstern des Hotels Monk’s Mood ertönte und zwar in einer der Umgebung angepassten, unaufdringlichen Version für betuchte ältere Gäste. Es war gerade diese glattgebügelte, weichgespült-weiße Fassung des Stücks gewesen, die mir auf Madeira die Stimmung eingetrübt hatte. Und ich hätte mir an diesem Nachmittag gewünscht, Coltrane hätte dem verhinderten bleichen Thelonius den Marsch geblasen.
Ich fand es für einen gebürtigen Amerikaner wie den Meister erstaunlich, dass er so etwas typisch Britisches wie cream tea erwähnte. Dessen ungeachtet stand mir der Sinn jedoch nicht nach Small Talk.
„Warum ich?“, fragte ich ihn stattdessen.
„Warum nicht? Du kannst das doch – oder?“
Wenn jemand mit einer Gegenfrage antwortet, bedeutet das normalerweise, dein Gegenüber denkt nicht im Traum daran, dich in die wahren oder vollständigen Hintergründe seiner Entscheidung einzuweihen; sind es aber direkt zwei Gegenfragen, dann wird dir darüber hinaus der Rat erteilt, dass du am besten einfach deinen Job machst, die Kohle kassierst und dich ansonsten aus allem anderen raushältst.
Doch das ist mir schon immer schwer gefallen.
„Deine Auftraggeber“, sagte ich, es war ein Schuss ins Blaue, „beschäftigen eine ganze Armee junger, hochmotivierter Spezialisten, die das genauso gut können wie ich und zudem den Vorteil bieten, wesentlich billiger zu sein, da sie ohnehin auf der Payroll stehen.“
„Erstens habe ich keine Auftraggeber außer meiner eigenen Firma und deren Anleger und zweitens bist du zufällig vor Ort“, erwiderte der Meister und sagte dann auf Deutsch: „Standortvorteil!“
Er grinste breit und schien ein Lob wegen seiner Sprachkenntnisse zu erwarten.
„Als ob es darauf ankommt“, erwiderte ich und setzte ebenfalls ein Grinsen auf, das schon manchen nervös gemacht hatte. Natürlich ohne sichtbaren Effekt beim Meister. Das hatte ich auch nicht erwartet.
Er war ein Mann, der die 60 bereits überschritten hatte, was man ihm aber aus vielerlei Gründen nicht ansah. Da waren die sorgfältig frisierten graumelierten Haare, die im Sonnenlicht leicht glänzten. Vor allem aber war es seine nur als wuchtig, aber durchtrainiert zu beschreibende Figur, die von einem perfekt geschneiderten, zweireihigen Anzug von Martin Greenfield betont wurde. Eine kleine Narbe unter seinem linken Auge kontrastierte mit einem dezenten Diamant-Stecker im rechten Ohrläppchen. Zu unserer Besprechung war er mit einem angemieteten, gepanzerten Mercedes mit getönten Scheiben vorgefahren, den zwei weitere Limousinen unauffällig begleitet hatten. Der größte Teil seiner Entourage war bei den in der Kleinweidenmühle geparkten Wagen zurückgeblieben, während zwei Begleiter im Vorzimmer warteten.
„Well“, sagte er und seine Miene wurde wieder so ausdruckslos wie schon den ganzen Nachmittag, „ich könnte dir jetzt erzählen, dass die Geldgeber – besonders nach den Ereignissen der letzten Jahre – keine Lust haben, ihre eigenen Leute in dieses Projekt einzubeziehen. Du weißt schon, schlechte Presse, alle Welt ist sauer auf sie. Auf einmal stehen sie im Scheinwerferlicht, wo ihre natürliche Umgebung doch die Dunkelheit ist. Ich könnte dir erzählen, dass sie deshalb Angst haben, etwas könnte nach außen dringen, und dann schlittern sie noch viel tiefer in die Scheiße rein, als sie es ohnehin schon sind.“
Er machte eine Pause und trank einen frisch gepressten Fruchtsaft, den eine Assistentin vor der Sitzung in unserem Beisein zubereitet hatte und von dem bis jetzt niemand probiert hatte. „Aber ich will aufrichtig sein“, fuhr er fort.
Wieder grinste ich, doch diesmal nur innerlich. Nach außen verzog ich keine Miene. Ich tat es dem Meister gleich und trank einen Fruchtsaft. Auch damit möchte ich ein hartnäckiges Klischee widerlegen. Ich kenne nur wenige bedeutende Gangster, die während ihrer Arbeit zu harten alkoholischen Drinks greifen. Jedenfalls musste, wer den Meister reden hörte, genau aufpassen. Seine Aussprache war so leise, als wolle er nur mit dem kleinstmöglichen Aufwand sprechen. Er war auch ein Meister in der Ökonomie der verbalen Kommunikation. „Die Menschen und Institutionen, die uns ihr Geld anvertrauen, haben nichts mit den Leuten zu tun, an die du denkst. Nicht, dass sie nicht früher oft und gut mit denen zusammengearbeitet haben. Doch mal ehrlich, wer würde denn heute noch dieser Gurkentruppe etwas anvertrauen? Nachdem sie dermaßen blamiert worden ist? Ich bitte dich!“
Ich nickte erneut, darum bemüht, meinem Gesicht einen zwar nachdenklichen, aber auch einsichtigen Ausdruck zu verleihen. Möglich, dass mir das misslang und ich stattdessen einfach nur beflissen aussah.
Was der Meister sagte, klang plausibel und so sollte es auch wirken. Deshalb tat ich, als hätte ich seine Antwort akzeptiert. Der Meister war mein Auftraggeber. Er würde die einzelnen Phasen des Projekts koordinieren. Dabei hätte mich schon der Name des Forschungsprogramms misstrauisch machen müssen: Helter Skelter. Einerseits der Titel eines Songs der Beatles, andererseits das Motto der Charles Manson-Massaker. Ich vermutete, dass der Meister von seinen Kollegen kontrolliert würde. Jeder von ihnen hatte sich das Recht erworben, Meister genannt zu werden. Ich dagegen war nur ein Teil dieses Projekts, noch dazu ein kleiner, unbedeutender Teil. Da ich ein fürstliches Honorar ausgehandelt hatte, konnte ich mir ausmalen, in welch schwindelerregenden Höhen sich das Gesamtbudget bewegen musste. Ich mochte ein kleines Rädchen sein, die gesamte Maschinerie musste gigantisch sein. Was mich am meisten freute, war, dass wir zwar auch erfolgsabhängige Zahlungen ausgemacht hatten, ich aber – selbst wenn der Meister am Ende nur unbrauchbares Material bekäme – trotzdem voll und ganz auf meine Kosten kommen würde.
Das Gefeilsche um die Höhe der einzelnen Tranchen und ihre Fälligkeit im Beisein der Anwälte war genauso Show gewesen, wie das, was mir der Meister nun unter vier Augen gesagt hatte. Mein Preis hatte schon vorher festgestanden. Das wussten wir beide. Die Geldgeber im Hintergrund kamen auch aus Geheimdienstkreisen, dessen war ich mir nun sicher. Selbstredend nicht von einem deutschen Geheimdienst. Dafür hatten die nicht die Eier. Wenn der Meister so kunstvoll in Abrede stellte, dass ich mit meiner recht naheliegenden Vermutung total danebenlag, dann musste an meiner Vermutung etwas dran sein.
Aber im Grunde war es mir schon immer herzlich egal, wer mich bezahlt. Von mir aus auch die NSA.
Leon:
Man schläft ausgesprochen schlecht, wenn die Umgebung so steril ist wie im Institut. Man schläft noch schlechter, wenn die Liegen, auf die man sich zu betten hat, so schmal, hart und unbequem sind, wie diese Pritschen.
Jeder kennt solche Dinger aus den Arztpraxen der zivilisierten Welt. - Dann machen Sie sich mal frei – ja, alles, auch BH und Slip …, ging mir durch den Kopf, verbunden mit dem Bild der jungen Frau und einem geifernden Pseudo-Mediziner. Ich hab mir wohl zu viele Pornos angesehen. Aber auf solchen Liegen soll der Patient auch nicht einpennen. Hier aber doch!
Man schläft noch viel schlechter, wenn einem eine straff auf der Kopfhaut sitzende Kappe übergezogen wird. Ich werde mir deswegen jedenfalls nicht den Schädel rasieren. Ich bin stolz auf mein perfekt frisiertes Haar. Was machen die Mädels mit ihren Mähnen, Theo mit seiner Matte, Josh mit seinen Rastalocken unter dieser stramm sitzenden Haube? Jedes Mal wenn ich sie wieder abnehmen darf, juckt es, als wäre eine Kompanie Läuse auf dem Vormarsch. Ob wir eine Zulage für das Extra-Shampoo verlangen können?
Von der Kappe führt ein armdickes Kabelbündel zu einer Stecktafel, in die die einzelnen Kabel eingestöpselt werden. Dieses Ding erinnert mich mehr an alte Filme als an moderne wissenschaftliche Forschung. Das Frollein vom Amt. „Bitte verbinden Sie mich!“ – „Mit wem?“ – „Mit Ihnen, gnä’ Frau … Mein Stecker lechzt nach Ihnen!“
Am allerschlechtesten schläft man jedoch, wenn man in die Röhre geschoben wird, deren monotones Klacken teuflisch nervt. Ein Wunder, wenn man dann doch irgendwann wegdämmert.
Ich habe bewusst das unschöne „man“ so ausgiebig verwendet, weil sich diese Erfahrungen verallgemeinern lassen.
Inzwischen habe ich meine Mitschläfer und Mitschläferinnen kennengelernt und alle haben mir bestätigt: Schlafen ist anstrengend. Vor allem dann, wenn du es tun musst. Kein Wunder, dass die einem Geld dafür zahlen. Vielleicht sollte ich wirklich bald das Thema einer Honorar-Erhöhung ansprechen. Was sage ich: vielleicht? Es muss heißen: Ganz bestimmt werde ich bald das Thema Mehr Geld! Meine Träume gibt’s nicht umsonst! zur Sprache bringen.
Der Job ist derart anstrengend und öde, dass ich sogar die Lust auf meine Mitschläferinnen verliere, von denen eine – Michaela – eine hübsche Schnitte ist, die ich gerne, wenn’s sein muss auch im Dienst der Wissenschaft, mal flachlegen würde.
Da frage ich mich in aller Unschuld, warum wir eigentlich an der Sigmund-Freud-Uni sind, wenn hier niemand Sex-Forschung betreibt? So ganz praktisch. Seit Masters und Johnson muss sich auf diesem Gebiet doch was geändert haben – oder? Immerhin liegen bereits Jahrzehnte der sexuellen Revolution zwischen der universitären Vögelei dieser beiden Orgasmus-Forscher und der heute viel hedonistischeren, aber immer noch verklemmt-oberflächlichen Gegenwart. Dafür würde ich mich sogar für kleines Geld zur Verfügung stellen. Aber so was wird in unserem Schnarchladen ja nicht angeboten. Schande!