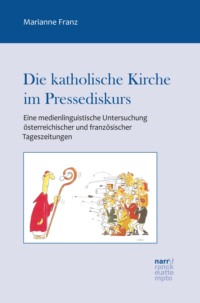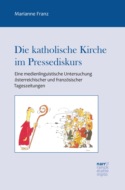Kitabı oku: «Die katholische Kirche im Pressediskurs», sayfa 10
4.1.3 Pressetextsorten mit informations- undPressetextsorten, informationsbetonte meinungsbetontenPressetextsorten, meinungsbetonte ElementenReportageInterview
Ob die Textsorten „Reportage“, „Interview“ bzw. „Meinungsinterview“ tatsächlich in die vorliegende Analyse aufgenommen werden, wird sich erst im Laufe der Untersuchung herausstellen. Es ist zum einen unsicher, ob tatsächlich Reportagen vorkommen, zum anderen ob aus den Interviews auf die RedaktionslinieRedaktionslinie der Zeitungen geschlossen werden kann. Dies wäre allenfalls anhand der Fragestellung der Journalisten möglich – bleibt zu prüfen, ob hier Relevantes zu entdecken ist.
Das Meinungsinterview ist zwar eine Spielart des Interviews, wird hier aber separat dargestellt, da es nach Lüger besondere Merkmale aufweist. Nichtsdestoweniger gibt es zahlreiche Überschneidungen zum normalen Interview bzw. Sachinterview. In der Tabelle kenntlich gemacht wurde dies durch Verbindung der Zellen.



 Tab. 12:
Tab. 12:
Pressetextsorten mit informationsPressetextsorten, informationsbetonte - und meinungsbetontenPressetextsorten, meinungsbetonte Elementen
4.2 Aktuelle Tendenzen der Pressetextsorten-Entwicklung
Die Pressetextsorten, die hier so prototypisch beschrieben werden, sind in der Praxis in vielen Mischformen anzutreffen. Aktuell tendieren die Textsorten immer mehr dazu, sich zu vermischen, so dass nach Burger (2005: 224) „in allen Medien heute nicht mehr klar zu unterscheiden ist zwischen ‚informationsbetonten‘Pressetextsorten, informationsbetonteund ‚meinungsbetonten‘Pressetextsorten, meinungsbetonte Texten, insbesondere zwischen Bericht und Kommentar“Kommentar. Auch Straßner stellt eine derartige Tendenz fest:
„Wird das von den Alliierten oktroyierte Gebot der Trennung von Fakten und Meinung in der Berichterstattung der großen Politik, Wirtschaft etc. schon weitgehend ignoriert, so verschwindet es quer durch die Sparten, um im Feuilleton völlig aufgehoben zu werden. Berichte über Kulturereignisse enthalten fast immer explizite WertungenBewertung, explizite.“ (Straßner 2000: 35)
„Die Fakten- und Meinungstrennung ist ebenfalls aufgehoben bei Hintergrundsberichten, bei denen die Aktualität zurücktritt, um einem ausführlichen Erwägen der Gründe für ein Ereignis und dessen Folgen Raum zu lassen.“ (Straßner 2000: 38)
Nichtsdestoweniger wird in journalistischen Handbüchern immer noch die Trennung zwischen dem sachlichen, neutralen Bericht und dem subjektiven, meinungsbetonten KommentarKommentar gefordert – eine unsinnige Forderung, wie bereits Bucher 1986 feststellt: Es sei eine Fiktion, über etwas zu berichten, ohne dazu einen Standpunkt zu haben (vgl. Bucher 1986, zitiert nach Burger 2005: 224). Es gibt keine reinen Faktendarstellungen.
„Wenn im Journalismus dennoch weitherum noch die Trennungsnorm vertreten wird, dann ist das gemeint als eine Frage der Gewichtung, auch der formalen Gestaltung. Im KommentarKommentar wird explizitBewertung, explizite die persönliche Meinung des namentlich Unterzeichnenden erkennbar, und der Kommentar bedient sich anderer stilistischer Mittel als der Bericht.“ (Burger 2005: 225)
Die Vermischung der Textsorten scheint in der Boulevardpresse stärker zu sein als in der Qualitätspresse. In vielen Tageszeitungen wird die Trennung zwischen Bericht und KommentarKommentar weiterhin kultiviert und auch grafisch gekennzeichnet. Dennoch nehmen „auch in den Zeitungen, die formal die Trennungsnorm klar befolgen, die Berichte immer mehr den Charakter von Mischformen [an]“ (Burger 2005: 225).
Die Entwicklung der Pressetextsorten ist geprägt von der Konkurrenz von Qualitäts- und Boulevardpresse einerseits und von der Konkurrenz mit den elektronischen Medien andererseits (vgl. Burger 2005: 206). So ist eine Tendenz der Pressetexte hin zu Multi-Texten oder Cluster-Texten zu registrieren, die Ähnlichkeiten mit den Hypertexten der elektronischen Medien aufweisen. Pressetexte werden zunehmend multimedial und enthalten neben Texten auch Fotos und Grafiken. Dabei können Fotos ähnliche Funktionen wie Texte haben und beispielsweise wertende Botschaften enthalten, die jedoch oft unbemerkt bleiben (vgl. Burger 2005: 232; siehe dazu auch BildanalyseBildanalyse der vorliegenden Arbeit in Abschnitt 12).
Außerdem wird die Linearität von Pressetexten (in der MeldungMeldung perfektioniert) immer mehr aufgebrochen. Texte werden nicht mehr von vorne nach hinten, sondern nicht-linear gelesen. Die traditionelle Struktur des komplexen Lang-Textes wird aufgelöst in ein Cluster von zusammenwirkenden einzelnen Teil-Texten: Modular aufgebaute Kurz-Texte verbinden sich mit Infografiken und Fotos (vgl. Burger 2005: 233). Nichtsdestoweniger ergeben die verschiedenen Bausteine dank verbaler und optischer Strategien ein Ganzes (vgl. Burger 2005: 236):
„Vom Rezipienten her gesehen ist das Produkt, der TEXT, ein Angebot, bei dem er sich beliebig ‚bedienen‘ kann. Dadurch wird der Rezipient definitiv von der ‚Ganzlektüre‘ eines Textes weggeführt hin zu einer selektiven Lektüre, die sich die für die individuellen Interessen geeigneten Teil-Texte herausgreift. Aus der Perspektive der elektronischen Hypertext-Struktur ist hier ein zumindest analoges Rezeptionsverhalten des Zeitungslesers angestrebt: Der Leser stellt sich ‚interaktiv‘ seinen eigenen individuellen Text zusammen, jeder einzelne Leser folgt dem eigenen individuellen ‚Lesepfad‘.“ (Burger 2005: 237).
Sprachlich ist eine Verschiebung des Verhältnisses Mündlichkeit und Schriftlichkeit hin zur Mündlichkeit festzustellen (siehe dazu auch Abschnitt 3.1.2).
„Zwar beharren zahlreiche Textsorten der Abonnementpresse noch auf Schreibweisen, die stark an der Schriftlichkeit orientiert sind (insbesondere die auf Agenturmaterial basierenden Texte), doch ist in der Boulevardpresse und vielen Sektoren der sonstigen Presse eine zunehmende Hinwendung zu stärker oralen Formen zu registrieren.“ (Burger 2005: 206).
Für Österreich stellt Burger – im Gegensatz zu Deutschland – außerdem eine „Homogenisierung des Pressestils in Richtung Boulevardpresse“ fest (Burger 2005: 207).
4.3 Zusammenfassung
Für die vorliegende Arbeit sind in Bezug auf die Textlinguistik insbesonders die Ergebnisse zu den Pressetextsorten relevant. So konnten die informationsbetonten Textsorten (Meldung, harte Nachricht, Bericht) und die meinungsbetonten Textsorten (Kommentar, Glosse) sowie diverse Mischformen (Reportage, Interview, Meinungsinterview) mithilfe von neun makro- und mikrostrukturellen Kriterien umfassend beschrieben und voneinander abgegrenzt werden: (1) Intention, (2) thematische Entfaltung, (3) inhaltliche Detailliertheit, (4) formale Textstruktur, (5) Perspektive, (6) Präsenz des Autors, (7) intertextuelle Textgeschichte, (8) synchrone Intertextualität und (9) sprachstilistische Merkmale (siehe Abschnitt 4.1). Des Weiteren wurde aufgezeigt, dass Pressetextsorten dazu tendieren, sich immer mehr zu vermischen, und dass damit die Grenzen zwischen meinungs- und informationsbetont verschwimmen (siehe Abschnitt 4.2).
Die Ergebnisse können der empirischen Untersuchung der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt werden. So helfen die beschriebenen Textsortenmerkmale dabei, die Zeitungsartikel nach Textsorten zu kodieren und die gewonnenen Daten zu interpretieren (z.B. hinsichtlich der Distribution der impliziten und expliziten Bewertungen nach Textsorten; hierzu siehe die Auswertung der Diskursanalyse in Abschnitt 13.3).Diskurslinguistik
5 DiskurslinguistikDiskursDiskursanalyse
Eine weitere sprachwissenschaftliche Teildisziplin, aus der die vorliegende Arbeit schöpft, ist die noch junge Diskurslinguistik. Sie ist insofern interessant, als dass sie Strukturen, Muster und Besonderheiten über Einzeltexte hinaus beschreibt. Die Kritische DiskursanalyseDiskursanalyse nach Jäger bildet die Grundlage der für die Artikelanalyse entworfenen Methode.
Unter Diskurslinguistik ist jedoch nicht die Gesprächslinguistik bzw. -analyse zu verstehen (die im Englischen ja „discourse analysis“ heißt), sondern eine mit der TextlinguistikTextlinguistik verwandte Forschungsrichtung, die aus der linguistischen Rezeption der DiskurstheorieDiskurstheorie, vor allem der Diskurstheorie nach Michel Foucault (1926–1984) erwachsen ist. Der Terminus „Diskurs“ bezeichnet demnach nicht „Gespräch“, sondern „eine strukturelle Einheit“, „die über Einzelaussagen hinausgeht“ (Warnke 2007b: 5). Texte sind „in Diskurse im Sinne textübergreifender Strukturen eingebettet“ (Warnke 2007b: 7). Diskurslinguistik resultiert also aus der Überwindung des Verständnisses, dass ein Text die größte linguistisch zu beschreibende Einheit ist. Gegenstand linguistischer Analyse ist damit nicht länger „die begriffliche Architektur eines isolierten Textes“ (Warnke 2007b: 15), sondern sind „textübergreifende Strukturen von Sprache“ (Warnke 2007b: 16). Die Diskurslinguistik bricht damit „die Abgrenzung von vorhergehenden, umgebenden und nachfolgenden Äußerungen“ (Warnke 2007b: 17) auf, wie es sie in textlinguistischen Analysen gibt, wo Einzeltextphänomene untersucht werden. Warnke zufolge (2007b: 18) sind Diskurse „insofern nicht einfach thematisch zusammengestellte Korpora, sondern offene Gesamtheiten von Aussagen, die stets nur exemplarisch und in Ausschnitten ihrer Streuung wissenschaftlich zu beschreiben sind“.
5.1 DiskurstheorieDiskurstheorie nach Foucault
Um besser nachvollziehen zu können, was bzw. welche Weltanschauung und Gesellschaftstheorie mit dem Terminus „Diskurs“ mitschwingt, ist zumindest ein kurzer Blick auf Foucaults DiskurstheorieDiskurstheorie notwendig. Foucaults Anliegen war es, das Zustandekommen gesellschaftlichen Wissens zu rekonstruieren. Er wollte „eruieren, warum und wie bestimmte Denkschemata eine Epoche prägen und die Perspektive bestimmen können, unter der die Menschen die Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem bestimmten Raum sehen“ (Heinemann 2005: 23). Die Organisation von Gesellschaften wird nach Foucault wesentlich durch die sogenannten Diskurse geleistet, indem diese „Weltbilder, Gesellschaftsdeutungen und sozial wirksame Klassifikationen [hervorbringen]“ (Diaz-Bone 2005: 539). Was Foucault exakt unter dem Terminus „Diskurs“ versteht, hat er nie eindeutig und endgültig definiert. Heinemann (2005: 24) versucht eine solche Definition von „Diskurs“ nach Foucault zu formulieren: „Diskurse sind Bündel komplexer Beziehungen zwischen Aussagen und gesellschaftlichen Prozessen und Normen; dadurch zugleich aber auch Instrumente gesellschaftlicher Praktiken und damit der Machtausübung.“ Ein Diskurs ist also „eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören“ (Foucault, zitiert nach Zimmermann 2010: 37). Unter Formationssystem ist eine Art Aussagengeflecht zu einem bestimmten Themenkomplex zu verstehen; z.B. bilden verschiedenste Aussagen zum Thema „Rassismus“ (oder in der vorliegenden Arbeit zum Thema „katholische Kirche“) ein Aussagengeflecht, einen Diskurs.
Aussagen und gesellschaftliche Prozesse beeinflussen sich also gegenseitig; so reproduzieren Aussagen nicht nur, sondern bringen auch Wissen hervor. Dadurch üben sie Wirkung bzw. Macht aus – insbesondere wenn sie Handlungen nach sich ziehen (vgl. Diaz-Bone 2005: 540), denn sie bestimmen „letztlich – mehr oder minder unbewusst – das Denken der Subjekte und die ‚Ordnung der Dinge‘ (Foucault 1974)“ (Heinemann 2005: 23).
Diskurse sind jedoch nicht in der Absicht einzelner Akteure entstanden, sondern sie sind das Resultat geschichtlicher Entwicklungen und „anonyme[r] und überindividuelle[r] Prozesse“ (Diaz-Bone 2005: 540). Wichtig ist, so Heinemann (2005: 23), dass Aussagen nach Foucault nie für sich stehen, sondern in einen Aussagenkomplex, in einen Diskurs, „in ein assoziatives Feld“ eingebettet sind. „Erst von der Ganzheit des Diskurses her erhalten die Einzelaussagen ihre eigentliche Bedeutung […].“ DiskursanalysenDiskursanalyse versuchen als eine Form von Inhaltsanalysen diese Bedeutungen der Aussagen bzw. Texte von eben dieser Ganzheit des Diskurses her zu erschließen.
„DiskursanalysenDiskursanalyse versuchen zunächst Diskurse als kollektive Praxisformen und Wissensordnungen […] zu identifizieren und deren innere Organisation zu rekonstruieren. Danach wird der Fokus erweitert und nach den Wechselwirkungen zwischen Diskursen einerseits und nicht-diskursiven sozialen Vorgängen (institutionellen Prozeduren, Handlungsroutinen, Techniken) andererseits gefragt.“ (Diaz-Bone 2005: 539)
„Die“ DiskursanalyseDiskursanalyse gibt es jedoch nicht. Foucault, der selbst eher Theoretiker war, hat nie eine einheitliche Methode der Diskursanalyse erstellt; jedoch sind in der Foucaultschen Rezeptionsgeschichte, vor allem in den Sozialwissenschaften, verschiedene Arten der Diskursanalyse entworfen worden.1 Hier gehe ich aufgrund der Ausrichtung der vorliegenden Arbeit jedoch nur auf die linguistisch orientierten Diskursanalysen ein.
5.2 DiskursanalysenDiskursanalyse in der Linguistik
Die DiskurstheorieDiskurstheorie hat die Linguistik und hier im Besonderen die TextlinguistikTextlinguistik nachhaltig beeinflusst. Davon zeugt auch der Titel des von Warnke 2007 herausgegebenen Sammelbands „Diskurslinguistik nach Foucault“. Darin wird versucht, „den theoretischen Stand der gegenwärtigen Diskurslinguistik“ in Folge der „Rezeption der Foucault’schen Diskurstheorie in der Linguistik“ zu beleuchten (Warnke 2007c: VII). Dennoch hatte die germanistische Linguistik anfangs mit der Rezeption Foucaults gezögert. Aufgenommen wurde sie zunächst von der Historischen SemantikSemantik, die die historische Entwicklung von Wortbedeutungen untersucht. Vor allem Busse erweiterte ab den 1980er Jahren dieses ursprüngliche Anliegen der Historischen Semantik um die DiskursebeneDiskursebene (Wortbedeutungen als vom Diskurs bestimmt) und zielte auf die Analyse der „Geschichte der Bedingungen der Möglichkeiten sprachlicher Äußerungen“ (Busse 1987, zitiert nach Warnke 2007: 8).1 Diese Spielart der DiskursanalyseDiskursanalyse wird mancherorts auch „(Korpus-)Linguistisch-Historische Diskursanalyse“ genannt (z.B. bei Keller 2004: 22).
In der TextlinguistikTextlinguistik dauerte es etwas länger, bis der Untersuchungsgegenstand „Diskurs“ Akzeptanz fand. Erst ab den 1990ern begannen manche Linguisten die Frage zu stellen, wie diverse Themen von der Gesellschaft behandelt werden, und beschrieben Diskursstränge zu Themen wie Rassismus und Vorurteile. Heinemann führt die dahingehend engagierten germanistischen LinguistInnen Siegfried Jäger oder Ruth Wodak an, VertreterInnen der sogenannten Kritischen DiskursanalyseDiskursanalyse (KDA) bzw. Critical discourse analysis (CDA), auf die ich noch zurückkommen werde (vgl. Heinemann 2005: 26).
Im Sammelband „Methoden der Diskurslinguistik“, herausgegeben von Warnke und Spitzmüller, wird die Diskurslinguistik als „Erweiterung text- und soziolinguistischer Perspektiven“ beschrieben (Warnke/Spitzmüller 2008c: VII.), deren Aufgabe es ist, „Sprache als Teil sozialer Praktiken der Wissensgenese und Wissensformation“ (Warnke/Spitzmüller 2008b: 16) zu untersuchen.
„Es geht also bei der methodischen Umsetzung der Diskurslinguistik um eine sprach- und wissensbezogene Analyse, die die Produktionsbedingungen und Wirkungsmechanismen spezifischer medialer Umgebungen und die Interessen der Diskursteilnehmer als Untersuchungsgegenstand ernst nimmt.“ (Warnke/Spitzmüller 2008b: 17)
Warnke und Spitzmüller sehen eine weitere Aufgabe der foucaultschen DiskursanalyseDiskursanalyse in der Analyse von Machtstrukturen, wobei Macht hier nach Foucault nicht im Sinne von repressiver „Mächtigkeit einiger Mächtiger“ zu verstehen ist, sondern als „komplex[e] strategisch[e] Situation in einer Gesellschaft“ (Foucault 1997, zitiert nach Warnke/Spitzmüller 2008b: 18). Analyse von Machtstrukturen kann oder muss sich sogar auch in der Beschreibung sozialer Strukturen und Dynamiken äußern, die in den Diskursen einerseits abgebildet, andererseits von ihnen auch geschaffen werden.
In der Entwicklung der noch jungen germanistischen Diskurslinguistik haben sich zwei Lager herausgebildet, die sich zwar jeweils auf Foucault berufen, nichtsdestoweniger jedoch so unterschiedliche Ansichten und Zugangsweisen zur DiskursanalyseDiskursanalyse haben, dass sie quasi getrennte Wege gehen und keine Zusammenarbeit stattfindet (Warnke/Spitzmüller 2008b: 19). Die Rede ist von der bereits von Heinemann erwähnten Kritischen Diskursanalyse sowie von der in der Tradition der Diskurssemantik stehenden linguistischen Diskursanalyse. Der dem Anschein nach gravierende Unterschied der beiden liegt in der Ausrichtung der Diskursanalyse. Die Kritische Diskursanalyse (KDA) hat ganz offen die Kritik herrschender Machtstrukturen zum Ziel, wovon die linguistische Diskursanalyse dezidiert Abstand nimmt. Letztere bezieht Position gegen WertungenBewertung in der Analyse und hält eine derartig wertende und kritisierende Vorgehensweise sogar für unwissenschaftlich. Diese Richtung der Diskurslinguistik sieht die Aufgabe der Wissenschaft in der Deskription (und nicht in der Kritik). Die geforderte Analyse der diskursiven Machtstrukturen bleibt in der Diskursbeschreibung verhaftet. Trotzdem plädieren Warnke und Spitzmüller, deren Zugang der deskriptiv linguistischen Diskursanalyse zuzuordnen ist, für einen Austausch zwischen den beiden Lagern, den sie als profitabel einschätzen (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008b: 19). Sie finden aber, dass „explizite Gesellschaftskritik […] kein primäres Ziel der Diskursanalyse“ oder „die alleinige Aufgabe der Diskurslinguistik“ sein soll (Warnke/Spitzmüller 2008b: 22). Die Aufgabe der performanzorientierten Diskurslinguistik besteht in der Beschreibung sprachlicher Oberflächenphänomene (Warnke 2007b: 13). Es geht hier um die „Strukturierung kognitiver Schemata in Äußerungsroutinen“, um die „Beschreibung von Wissensarchitekturen“, etwa die „RekonstruktionRekonstruktion des Identitätsdiskurses“, immer auf der Suche nach sprachlichen Mustern (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008b: 22). Warnke und Spitzmüller stellen ein Ebenenmodell vor (Diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse, DIMEAN), das weniger ein Leitfaden für die Durchführung einer Diskursanalyse ist, als vielmehr dabei helfen soll, diskurslinguistische Gegenstände erst einmal zu finden bzw. abzugrenzen. Das Modell besteht aus einer intratextuellen (u.a. Analyse der Mikro- und Makrostruktur des Textes), einer Akteurs- (Analyse der Handelnden hinter dem Text) und einer transtextuellen Ebene (diskursorientierte Analyse). Die transtextuelle Ebene ist die eigentliche Ebene, auf der Diskursanalyse stattfindet, auch wenn dieser die Analyse der beiden anderen Ebenen vorausgehen muss. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten bzw. Gegenstände diskursorientierter Analysen: Intertextualität, Schemata (Frames/Scripts), diskursschematische Grundfiguren, Topoi, Sozialsymbolik, indexikalische Ordnungen, Historizität, Ideologien/MentalitätenIdeologie (s. a. Welt- und Wertvorstellungen), allgemeine gesellschaftliche und politische Debatten. Die verschiedenen Aufsätze des Sammelbandes von Warnke und Spitzmüller widmen sich einigen dieser diskursanalytischen Gegenstände (vgl. Warnke/Spitzmüller 2008b: 23–43).
Der deskriptiven Diskurslinguistik stehen die inzwischen zahlreich gewordenen Spielarten der KDA bzw. CDA gegenüber, die sich in ihrem theoretischen Unterbau, ihrer Methodologie und ihren Forschungsschwerpunkten unterscheiden, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: Egal ob die Duisburger Schule um Siegfried Jäger, die Wiener Schule um Ruth Wodak oder die englische Variante um Norman Fairclough (ein Vorreiter in dieser Hinsicht ist auch der Niederländer Teun van Dijk) – das erklärte Anliegen ist es, Machtstrukturen aufzudecken und Gesellschaftskritik zu üben. Manche Varianten wollen auch dezidiert die Gesellschaft verändern; bei diesen liegt das Ergebnis der DiskursanalyseDiskursanalyse in „Verbesserungsvorschlägen“.2
Nach Jäger (2009: 25) ist DiskursanalyseDiskursanalyse im Grunde per se kritisch, weil sie „verdeckte Strukturen sichtbar macht (die man dann kritisieren kann oder auch nicht)“. Doch „kritisch“ im engeren Sinn wird sie erst, „wenn sie mit begründeten moralisch-ethischen Überlegungen gekoppelt wird“. Die Kritische Diskursanalyse nach Jäger (vgl. Jäger 2010a: 34) widmet sich gesellschaftspolitischen Themen wie Migration, Rassismus, Rechtsextremimus, Krieg und Frieden, Kriminalität u.a. Der Wiener (diskurs-historische) Ansatz „lehnt die Vorstellung ‚wertneutraler Wissenschaft‘ ab, versteht sich also als ‚anti-objektivistisch‘“ (Reisigl 2007, Absatznr. 17), und untersucht die Zusammenhänge zwischen Sprache, Diskurs und Geschichte, zwischen Geschichte, Politik und Sprache oder Diskurs, Sprache und Identität oder auch institutioneller Kommunikation. Dabei werden Themen behandelt wie Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus, sexistischer Sprachgebrauch, nationale Identitätskonstruktion oder auch Identitätskonstruktion in der EU (vgl. Reisigl 2007).
Für die Analyse in der vorliegenden Arbeit wurde die Methode der Kritischen DiskursanalyseDiskursanalyse nach Jäger gewählt, deren zentrale Eckpunkte im folgenden Abschnitt abgesteckt werden.