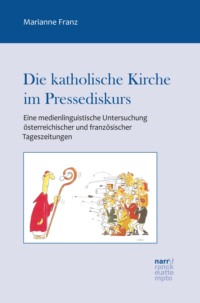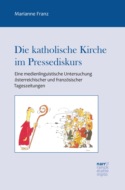Kitabı oku: «Die katholische Kirche im Pressediskurs», sayfa 2
1.2 Hypothesen
Die Untersuchung ging von folgenden Hypothesen in Bezug auf die Beschaffenheit der Berichterstattung über die katholische Kirche aus:
(1) Einfluss der NachrichtenfaktorenNachrichtenfaktoren sowie der Welt- und WertvorstellungenWelt- und Wertvorstellungen
Die Konstruktion der MedienrealitätMedienwirklichkeitMedienrealitätMedienwirklichkeit „Kirche“ vollzieht sich einerseits unter dem Einfluss der NachrichtenfaktorenNachrichtenfaktoren (d.h. der Eigenschaften eines Ereignisses, die darüber bestimmen, ob es in die Berichterstattung Eingang findet oder nicht, z.B. Prominenz der beteiligten Personen, räumliche Nähe des Ereignisses zu den LeserInnen, Dramatik usw.), andererseits unter dem Einfluss der Welt- und Wertvorstellungen der jeweiligen RedakteurInnen.
(2) ThemenselektionThemenselektion
Die NachrichtenfaktorenNachrichtenfaktoren und die Welt- und WertvorstellungenWelt- und Wertvorstellungen der jeweiligen RedakteurInnen wirken sich auf die Themensteuerung aus. Die Tageszeitungen berichten einseitig über die Kirche. Das Verhältnis der Bandbreite kirchlichen Geschehens in der Realität zu den in den Tageszeitungen wiedergegebenen Geschehnissen stimmt nicht überein. Im Detail bedeutet dies:
Die Berichterstattung ist auf „heiße Eisen“ fokussiert. Dazu gehören nach Bauer (vgl. 1997: 5f.) inner- und außerkirchlich heiß diskutierte Themen wie die Sexualmoral der Kirche, in diesem Zusammenhang auch Geburtenregelung, Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität und Zölibat; weiters das Verhältnis zwischen den Religionen (Juden und Christen bzw. Muslime und Christen) sowie das Verhältnis zwischen den Konfessionen (Ökumene), Kirchenbeitrag oder auch der Primat des Papstes.
Über bestimmte kirchliche Tätigkeitsfelder wird kaum berichtet (z.B. Tätigkeiten im sozialen Bereich).
Über bestimmte kirchliche Tätigkeitsfelder wird nicht berichtet (z.B. Tätigkeiten im pastoralen Bereich, beispielsweise in den Pfarrgemeinden).
(3) Inhaltliche Darstellung
Ebenso beeinflussen die NachrichtenfaktorenNachrichtenfaktoren und die Welt- und WertvorstellungenWelt- und Wertvorstellungen der RedakteurInnen die inhaltliche Darstellung der behandelten Themen. Diese zeigt sich in der Wahl der sprachstrukturellen Elemente sowie in den transportierten explizitenBewertung, explizite und implizitenBewertung, implizite Wertungen. Im Detail bedeutet dies:
In dieser teils unbewusst teils bewusst geschaffenen bzw. rekonstruierten MedienwirklichkeitMedienwirklichkeit wird die Kirche tendenziell negativ dargestellt bzw. bewertet.
Wertungen sind nicht nur in den meinungsbetontenPressetextsorten, meinungsbetonte TextsortenPressetextsorten, sondern auch in den informationsbetontenPressetextsorten, informationsbetonte Textsorten enthalten, die ObjektivitätObjektivitätBerichterstattung, objektiveRealität, objektive für sich beanspruchen.
(4) Redaktionelle Besonderheiten
Aufgrund der spezifischen Welt- und WertvorstellungenWelt- und Wertvorstellungen der einzelnen RedakteurInnen bzw. Redaktionen wird davon ausgegangen, dass die Berichterstattungen der einzelnen Tageszeitungen zum Teil Parallelen, zum Teil aber auch Unterschiede aufweisen. Dies betrifft sowohl Themenstrukturen als auch Sprache und Inhalt der Artikel und damit die enthaltenen Bewertungen.
(5) Länderspezifische Besonderheiten (Vergleich Österreich – Frankreich)
Die Berichterstattung über die römisch-katholische Kirche in Frankreich weist inhaltliche und sprachliche Unterschiede zur Berichterstattung in Österreich auf, was auf die strikte Trennung von Staat und Kirche in Frankreich (Stichwort LaizitätLaizität) zurückzuführen ist. Im Detail bedeutet dies:
Kirchlichen Themen wird in französischen Tageszeitungen weniger Raum beigemessen als in österreichischen Tageszeitungen. Zahl und Länge der abgedruckten Artikel sind geringer.
Das Verhältnis negativer und positiver Meldungen in Bezug auf die Kirche fällt noch stärker zugunsten negativer Nachrichten aus als in Österreich. Die Berichterstattung bezieht sich noch häufiger auf so genannte „heiße Eisen“. Einige Tätigkeitsbereiche der Kirche werden noch weniger berücksichtigt.
Wird Kritik an der Kirche geübt, fällt diese offener und schärfer aus. Es gibt gehäuft explizite Wertungen, negative Wertungen treten öfter auf als in Österreich.
In den französischen Tageszeitungen gibt es keine spirituellen Angebote, wie es in österreichischen Tageszeitungen vereinzelt der Fall ist (z.B. „Bimail“ – Bibelworte als spirituelle Anregung zum Weiterdenken in der Wochenendausgabe der Tageszeitung Die Presse).
1.3 UntersuchungsdesignKommunikationswissenschaft
Der Ansatz der Dissertation ist ein linguistischer. Ein derart komplexes Thema erfordert jedoch einen Blick über den Tellerrand und somit ein interdisziplinäres Untersuchungsdesign, das abseits verschiedener linguistischer Teildisziplinen (MedienlinguistikMedienlinguistik, TextlinguistikTextlinguistik, DiskurslinguistikDiskurslinguistik, SemantikSemantik, Pragmatik) auch aus der Forschungstradition der Medien- und Kommunikationswissenschaft schöpft (vgl. Kapitel 2–6 Wissenschaftliche Grundlagen). So weist die KommunikatorKommunikator- und Medieninhaltsforschung hinsichtlich der MedienwirklichkeitMedienwirklichkeit und ihrer Einflussfaktoren bereits zahlreiche Ergebnisse vor (NachrichtenwerttheorieNachrichtenwert, GatekeeperGatekeeping-Forschung usw.), auf denen hier aufgebaut werden kann.
Um die Hypothesen zu verifizieren und damit das mediale Bild der Kirche beschreiben zu können, wird auf verschiedene Methoden zurückgegriffen, die in den Abschnitten 2.4.2 und 11.2 (InhaltsanalyseInhaltsanalyse) sowie 12.2 (BildanalyseBildanalyse) und 5.3 und 13 (DiskursanalyseDiskursanalyse) erläutert werden.
Aufgrund des breit angelegten Untersuchungsdesigns kann die vorliegende Arbeit für den DiskursDiskurs mehrerer Wissenschaftsdisziplinen von Interesse sein, z.B.:
Linguistik: Die auf Sprache fokussierte Analyse ist relevant für die linguistischen Teildisziplinen der MedienlinguistikMedienlinguistik (Sprache in den Medien), der SemantikSemantik (Wertungen), der Sprachkritik (kritischer Blick auf die Sprache) und auch der kontrastiven Linguistik (Vergleich zwischen Frankreich und Österreich).
Medieninhalts- und Kommunikatorforschung: Indem der Inhalt dieser themenspezifischen Berichterstattung analysiert wird und die RedaktionslinienRedaktionslinie nachgezeichnet werden (und damit ihre Welt- und WertvorstellungenWelt- und Wertvorstellungen in Bezug auf das Thema katholische Kirche), leistet die Dissertation einen Beitrag zur Medieninhalts- und Kommunikatorforschung. Außerdem wird sich im Zuge der Analyse der Themenstruktur herausstellen, inwieweit die NachrichtenwerttheorieNachrichtenwert auch auf das Thema „Röm.-kath. Kirche“ zutrifft.
MedienkritikMedienkritik bzw. Medienethik: Durch das Nachzeichnen des medial konstruierten Bildes der römisch-katholischen Kirche und das Aufdecken der Wertungen soll aufgezeigt werden, dass diese Berichterstattung keine neutrale ist. Die Frage stellt sich, inwiefern dies mit den Prinzipien einer objektiven BerichterstattungBerichterstattung, objektiveRealität, objektive vereinbar ist. In diesem Zusammenhang kann die Dissertation Medienkritiker ansprechen.
Theologie: Nicht zuletzt kann diese Dissertation auch für die Religionswissenschaft im Allgemeinen und für die katholische Theologie im Konkreten interessant sein, da sie die Rezeption der römisch-katholischen Kirche in den Medien untersucht: Wie wird Kirche in der medialen Öffentlichkeit wahrgenommen?
1.4 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in vier große Kapitel untergliedert: Zunächst werden die wissenschaftlichen Grundlagen erläutert, auf denen die Untersuchung aufbaut (Kapitel 2–6): Medien- und Kommunikationswissenschaft (v.a. KommunikatorKommunikator- und Medieninhaltsforschung), MedienlinguistikMedienlinguistik, TextlinguistikTextlinguistik (in Hinblick auf die Pressetextsorten), DiskurslinguistikDiskurslinguistik, SemantikSemantik und Pragmatik.
Im zweiten Teil der Arbeit wird der gesellschaftspolitische Kontext Österreichs und Frankreichs erläutert (Kapitel 7–8): das Verhältnis zwischen Kirche und Staat sowie die Beziehung zwischen Kirche und Medien. Das Ziel dieses Abschnittes liegt darin, länderspezifische Eigenheiten herauszufiltern, die als Interpretationshintergrund für die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dienen sollen.
Eine ähnliche Funktion erfüllt der dritte Abschnitt (Kapitel 9–10), der zunächst die österreichische und die französische Presselandschaft und ihre Besonderheiten beschreibt und in weiterer Folge die einzelnen untersuchten Tageszeitungen porträtiert. Hier gibt es bereits erste Ergebnisse in Hinblick auf die RedaktionslinienRedaktionslinie bzw. Positionen der Redaktionen zur katholischen Kirche, die auf von mir mit einigen JournalistInnen durchgeführte InterviewsInterview zurückgehen.
Das vierte Großkapitel umfasst die Darstellung der Ergebnisse der Textanalyse und damit die Verifizierung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Hypothesen (Kapitel 11–13).
Die Arbeit schließt mit einem zusammenfassenden Überblick über die wichtigsten Befunde der Untersuchung (Kapitel 14), welcher auch ins Französische übersetzt ist (Kapitel 15).
Im Anhang befinden sich die Codebücher der Inhalts- und der BildanalyseBildanalyse, einige Ergebnisdaten sowie ein Teil des Korpus der DiskursanalyseDiskursanalyse (Kapitel 16).
In der Epoche des Gender-Mainstreamings ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Autorin der vorliegenden Arbeit auf die bewusste Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache großen Wert legt. Wenn an der einen oder anderen Stelle auf die weibliche oder die männliche Form verzichtet wurde, dann aus Gründen der Sprachökonomie und der Lesbarkeit bzw. um zu vermeiden, dass der Text allzu schwerfällig wirkt. Die Autorin nimmt sich diese Freiheit heraus, möchte jedoch betonen, dass in diesen Fällen stets beide Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.
2–6 Wissenschaftliche Grundlagen
In den folgenden fünf Kapiteln werden die wissenschaftlichen Grundlagen erläutert, auf denen die vorliegende, interdisziplinär ausgerichtete Untersuchung aufbaut. In Kapitel 2 wird auf entsprechende Grundlagen der Medien- und Kommunikationswissenschaft eingegangen (v.a. KommunikatorKommunikator- und Medieninhaltsforschung). Kapitel 3 behandelt die Grundlagen der Medienlinguistik (etwa die Besonderheiten der Pressesprache oder die Stellung des Bildes in Medien-Texten)Medienlinguistik, Kapitel 4 die Grundlagen der TextlinguistikTextlinguistik (v.a. in Hinblick auf die untersuchten Pressetextsorten). Kapitel 5 beschreibt die diskurslinguistischen Grundlagen und Methoden, die für diese Arbeit relevant sind, und in KapitelDiskurslinguistik 6 werden die wichtigsten Erkenntnisse der SemantikSemantik und der Pragmatik in Bezug auf Typen und Mittel der Bewertung mit Sprache dargestellt.
2 Medien- und Kommunikationswissenschaft
Die vorliegende Arbeit schöpft aus der Forschungstradition der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Das folgende Kapitel versucht diese Forschungsdisziplinen im bunten Fächerwald zu verorten und macht sich auf die Spuren relevanter Forschungsergebnisse.
Die Kommunikationswissenschaft versteht sich ursprünglich rein als empirische Sozialwissenschaft und hebt sich dadurch in Bezug auf ihre Ansätze und Methoden von der geisteswissenschaftlich geprägten, historisch-hermeneutischen Publizistikwissenschaft ab (vgl. Maletzke 1998: 22). Heute findet jedoch eine Vermischung dieser Wissenschaftsdisziplinen statt (vgl. Maletzke 1998: 24). Beck bezeichnet Kommunikationswissenschaft daher konsequent als interdisziplinäre Geistes- und Sozialwissenschaft,
„die sich als Humanwissenschaft mit dem Prozess menschlicher Verständigung, seinen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Mitteln, Formen, Störungen und Folgen beschäftigt. […] Ziel der [Kommunikationswissenschaft] ist der systematische, theorie- und hypothesengeleitete sowie empirisch verfahrende Erwerb von Wissen über Kommunikation […]. […] Kommunikationswissenschaftler bedienen sich ebenso historischer, hermeneutisch-interpretativer und diskursanalytischer Methoden wie quantifizierender und qualitativer Methoden der empirischen Sozialforschung.“ (Beck 2006a: 134)
Im Zentrum des Interesses der Kommunikationswissenschaft steht die öffentliche, durch Medien vermittelte Kommunikation. Seit den 1990er Jahren und der vermehrten Auseinandersetzung mit der computervermittelten Kommunikation wendet man sich auch interpersonalen Kommunikationsprozessen bzw. der Verschränkung öffentlicher und nicht-öffentlicher Kommunikation zu (vgl. Beck 2006a: 134)
Die Fragestellungen der Kommunikationswissenschaft führen sie an ihre Fachgrenzen und betrafen schon früh zum Teil „Disziplinen wie Linguistik und Psychologie, Soziologie und Kulturanthropologie, Kybernetik, Politikwissenschaft usw.“ (Schmidt 2002: 60). Hier kommt die MedienwissenschaftMedienwissenschaft ins Spiel:
„Lange Zeit hat die Kommunikationswissenschaft die Medien allzu eng lediglich als technische Verbreitungsinstrumente betrachtet; um Medien in ihren vielfältigen Zusammenhängen mit anderen Phänomenen, etwa gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher, kultureller und ästhetischer Art, hat sie sich nur wenig gekümmert. Und eben um dieses Versäumnis wettzumachen, entstand die MedienwissenschaftMedienwissenschaft.“ (Maletzke 1998: 25)
Die Geburt der MedienwissenschaftMedienwissenschaft wird von den verschiedenen Forschern in den 1960er bzw. 1970er Jahren angesetzt, als ihre Geburtshelfer werden die Literaturwissenschaften (vor allem die Germanistik), die Theaterwissenschaft, die Volkskunde, die Kunstwissenschaft und andere geisteswissenschaftliche Fächer angeführt (vgl. z.B. Hickethier 2003: 6; Schmidt 2002: 54; Bentele 2006: 188; Faulstich 2002: 52f.). Heute sieht sich die Medienwissenschaft „wegen ihrer Herkunft […] als eine Text- und Kulturwissenschaft“ (Hickethier 2003: 6), doch ist sie mehr als das: Sie hat in den Jahrzehnten nach ihrer Etablierung starke sozialwissenschaftliche Einflüsse erfahren, allen voran seitens der Publizistik und der Kommunikationswissenschaft (vgl. Faulstich 1994, zitiert nach Schmidt 2002: 54).
Es ist daher nicht verwunderlich, dass Medien- und Kommikationswissenschaft gerne in einem Atemzug genannt werden.1 Ludes und Schütte schlagen schon 1997 vor, MedienwissenschaftMedienwissenschaft als eine Integrationswissenschaft zu sehen (zitiert nach Maletzke 1998: 27f.):
„Indem die MedienwissenschaftMedienwissenschaft sich zunehmend sozialwissenschaftlich orientiert, ‚entstehen Ansätze einer integrierten Medien- und Kommunikationswissenschaft, in der hermeneutisch-qualitative und sozialwissenschaftlich-quantitative Methoden zum Einsatz kommen, um angemessen dem medialen Wandel begegnen zu können.‘“
Aus diesen Erläuterungen geht hervor, dass eine exakte disziplinäre Verortung der Medien- und der Kommunikationswissenschaft nur sehr schwer, eigentlich sogar unmöglich ist. Ihre Untersuchungsgegenstände sind seit ihren Anfängen dergestalt, dass sie die Aufmerksamkeit mehrere Fächer auf sich ziehen. Beck bezeichnet Kommunikationswissenschaft als sich aus mehreren Teildisziplinen zusammensetzende Aspekt- bzw. Integrationswissenschaft (vgl. Beck 2006a: 134). Sie könne nur interdisziplinär erforscht werden. Geisteswissenschaftliche Fächer wie eben auch die Sprachwissenschaft und sozialwissenschaftliche Fächer bilden zusammen mit der Kommunikationswissenschaft ein interdisziplinäres Gefüge (vgl. Beck 2007: 156f.). So sind die öffentliche Kommunikation und die sie vermittelnden MassenmedienMassenmedien Gegenstand verschiedenster sozial- und geisteswissenschaftlicher Teildisziplinen bzw. Bindestrich-Wissenschaften mit ihren je unterschiedlichen Fachperspektiven (z.B. Kommunikationsgeschichte, MedienlinguistikMedienlinguistik, Medienpsychologie, Kommunikationssoziologie, Medienökonomie usw.) (vgl. Bonfadelli 2006a: 104f.).
Um die Forschungsfelder der Medien- und Kommunikationswissenschaft zu beschreiben, wird gerne auf die sogenannte Lasswell-Formel zurückgegriffen. „Der amerikanische Politologe und Sozialwissenschaftler Harold D. Lasswell hat 1948 die wichtigsten Fragestellungen der damaligen Massenkommunikationsforschung in einem Fragesatz zusammengefasst“ (Beck 2007: 156f.) und ihnen verschiedene wissenschaftliche Forschungsfelder zugeordnet (Tab. 1).
 Tab. 1:
Tab. 1:
Fragen und Disziplinen der Kommunikations- und Medienforschung (Quelle: Kübler 2003: 131; eigene Darstellung)
Obwohl die Formel immer wieder kritisiert, erweitert und differenziert wurde, hat sie sich aufgrund ihrer Prägnanz in der Kommunikationswissenschaft etabliert (vgl. Kübler 2003: 131f.). Zu ergänzende Forschungsfelder, die sie nicht berücksichtigt, sind etwa die Mediennutzung oder die Medienorganisation bzw. die „institutionellen Rahmenbedingungen“ (Bentele/Brosius/Jarren 2003: 9).
Die vorliegende Arbeit versteht sich als medienlinguistische Untersuchung und befindet sich damit an der Schnittstelle zwischen Medien- und Kommunikationswissenschaft und Sprachwissenschaft. Sie baut sowohl auf der Forschungstradition der ursprünglich philologischen, geisteswissenschaftlich geprägten Medienwissenschaft als auch auf der Forschungstradition der stärker sozialwissenschaftlich geprägten Publizistik- und Kommunikationswissenschaft auf und macht sich deren Forschungsergebnisse zunutze. Dabei setzt sie sich vor allem mit dem „Who says what“ auseinander (KommunikatorKommunikator- und Medieninhaltsforschung). Ihr methodischer Zugang ist einerseits ein hermeneutischer (InhaltsanalyseInhaltsanalyse, DiskursanalyseDiskursanalyse und anschließende Interpretation), andererseits ein empirischer (Stichprobenanalyse, quantitative Auswertung der Untersuchungsergebnisse).Medium
In den folgenden Abschnitten werden ausgewählte Forschungsergebnisse der Medien- und Kommunikationswissenschaft dargestellt. Zunächst werden die Phänomene „Medium“ und „MassenkommunikationMassenkommunikation“ beschrieben und für die vorliegende Arbeit brauchbare Definitionen festgelegt. Im Anschluss gehe ich auf einige Erkenntnisse der beiden Forschungsfelder der KommunikatorKommunikator- und Medieninhaltsforschung ein, die für die Überprüfung der Hypothesen bzw. für die angewandte Untersuchungsmethode von Bedeutung sind.
2.1 Medien aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht
Zur Erinnerung: Kommunikations- und MedienwissenschaftMedienwissenschaft beschäftigt sich „mit dem Prozess menschlicher Verständigung, seinen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Mitteln, Formen, Störungen und Folgen“; dies tut sie vor allem im Bereich öffentlicher, durch Medien vermittelter Kommunikation (vgl. Beck 2006a: 134). Doch welche Medien sind das genau? Die Klärung dieses Begriffes inkludiert eine Klärung des Forschungsgegenstandes dieser Wissenschaften. Alltagssprachlich scheint er relativ klar zu sein. Rein assoziativ verbindet man damit sofort Fernsehen, World Wide Web, Rundfunk usw. Doch schon nach Duden (1999) birgt dieser Begriff eigentlich sehr vielschichtige Bedeutungen in sich: Ein Medium kann hier 1. ein „vermittelndes Element“ sein (z.B. „Gedanken durch das M. der Sprache, der Musik ausdrücken“), 2.a. kann mit Medium oder besser: mit Medien (meist im Plural) eine „Einrichtung, [ein] organisatorischer u. technischer Apparat für die Vermittlung von Meinungen, Informationen, Kulturgütern“ gemeint sein, vielleicht auch „eines der MassenmedienMassenmedien Film, Funk, Fernsehen, Presse“. Es könnte sich aber auch um 2.b. ein „[Hilfs]mittel“ handeln, „das der Vermittlung von Information u. Bildung dient (z.B. Buch, Tonband): das akustische Medium Schallplatte“; oder 2.c. um ein „für die Werbung benutztes Kommunikationsmittel“. 3. könnte dieser Begriff für einen „Träger bestimmter physikalischer, chemischer Vorgänge; Substanz, Stoff“ stehen oder 4.a. für jemanden, „der für Verbindungen zum übersinnlichen Bereich besonders befähigt ist“, oder schließlich 4.b. für jemanden, „an dem sich aufgrund seiner körperlichen, seelischen Beschaffenheit Experimente, bes. Hypnoseversuche, durchführen lassen“.
Zugegeben, einige dieser Bedeutungen lassen sich für die Medien- und Kommunikationswissenschaft bereits dadurch ausschließen, dass sie nichts mit Kommunikation zu tun haben (3., 4b). Dennoch zeigt dieser Einblick in das Wörterbuch von Duden, dass Medium vieldeutig ist und es einer Klärung bedarf, was mit diesem Terminus in den Medien- und Kommunikationswissenschaften – vor allem aber in dieser Arbeit – bezeichnet wird bzw. mit welchem Forschungsgegenstand sich diese Wissenschaften beschäftigen.
Sichtet man in Bezug auf den Begriff Medium die Forschungsliteratur, findet man (nicht sehr überraschend) verschiedenste Definitionen und Klassifizierungsmöglichkeiten. Hickethier (2003: 18) begründet diese Tatsache mit der „Mehrdimensionalität und Komplexität des Gegenstandsbereichs“ sowie mit den unterschiedlichen „Interessen und Fragestellungen“ und damit auch Konzeptionalisierungen der Wissenschaften. Vor allem die Medientheorie/-n befasst/-en sich mit der systematischen Beschreibung von Einzelmedien bzw. der Medien im Allgemeinen. Je nach (psychologischem, kommunikationswissenschaftlichem, kritischem, systemtheoretischem oder sozialwissenschaftlichem) Ansatz werden die Medien jedoch anders charakterisiert.
Es wird hier darauf verzichtet, die verschiedenen Medienkonzepte genauer vorzustellen (Näheres siehe Hickethier 2003: 18–36; Faulstich 2002: 17–26; Saxer 1999: 1–14). Die folgenden Ausführungen zielen darauf ab, eine für die vorliegende Arbeit relevante und brauchbare Mediendefinition zu finden.
Faulstich zitiert in seiner „Einführung in die MedienwissenschaftMedienwissenschaft“ verschiedenste Medienkonzepte – und stellt sie in Frage. Viele Versuche der Klassifizierung von Medien (etwa nach Arten oder Funktionen usw.) seien schlichtweg unbrauchbar oder gar unwissenschaftlich (2002: 20): „All diese Versuche sind ausnahmslos entweder unlogisch, unverständlich, dysfunktional, unvollständig, unbegründet oder banal.“ Sind ihm viele dieser Gruppierungen zu präzise und einschränkend, kritisiert Faulstich aber auch die vielerorts gepflegten, sehr allgemeinen und unwissenschaftlichen Metaphern wie etwa „Das Medium ist die Botschaft“, die von Marshall McLuhan stammt und mit der das Begriffswirrwarr laut Faulstich erst seinen Anfang nahm. Harsche Kritik übt er gegenüber dem viel gelesenen und „heute noch vielfach unkritisch zitierten Text“ McLuhans „Die magischen Kanäle“ („Unterstanding Media“, 1964):
„In diesem früheren Bestseller der Popularkultur und Zeitungsfeuilletons wird nachweislich ‚getrickst‘: Nach einem deutlichen Schema werden hier 1. Zitate aus aktuellen Pressetexten und 2. Anekdoten mit 3. Zitaten aus wissenschaftlicher Sekundärliteratur praktisch aller Disziplinen sowie 4. Zitaten aus literarischen Klassikern wie Shakespeare, James Joyce, Milton oder Yeats und der Bibel vermischt, 5. mit dunklen Metaphern und 6. mit mehr als 20 verschiedenen Medienbegriffen zur unterhaltsamen Verwirrung des Lesers versetzt und dann mosaikartig 7. zu diffus-unverständlichen, aber hochgelehrt und griffig klingenden Aussagen verdichtet. […] McLuhan war vieles, ein Eklektiker, ein Überflieger, ein Blender, ein Visionär, ein Schwätzer; nur eines war er nicht: ein Wissenschaftler.“ (Faulstich 2002: 21f.)
Nichtsdestoweniger galt McLuhan lange als Vater der Medientheorie und beeinflusste die Medien- und Kommunikationswissenschaft nicht unwesentlich.
Nach all dieser Polemik plädiert Faulstich für eine Rückbesinnung auf kritisches Denken und eine medienwissenschaftlicheMedienwissenschaft Theoriebildung; der Medienbegriff der Wissenschaft muss vom Medienbegriff der Alltagswelt unterschieden werden:
„Viele begreifen im alltäglichen Sprachgebrauch ‚Medium‘ im uneigentlichen Sinn, d.h. einfach als ‚Mittel‘ oder ‚Instrument‘ oder ‚Werkzeug‘ – und da kann prinzipiell alles ein Medium sein. Das meint durchaus auch Metaphern wie ‚Medium Sprache‘, ‚Medium Literatur‘ oder ‚Medium Musik‘. In der MedienwissenschaftMedienwissenschaft dagegen wird Medium als ein fachspezifisches Konzept verstanden, dem verschiedene Merkmale konstitutiv zugeordnet sind.“ (Faulstich 2002: 23)
Wie Faulstich kritisiert auch Hickethier historische Verengungen und gegenwärtige Überdehnungen des Medienbegriffs (vgl. Hickethier 2003: 18f.). Er selbst geht von einem kommunikationsorientierten Medienbegriff aus,
„der die Medien der individuellen und gesellschaftlichen Kommunikation in den Vordergrund stellt. Medien und Kommunikation werden in einem engen Zusammenhang gesehen. Kommunikation bedient sich immer eines Mediums. Die Menschen, die miteinander kommunizieren, verwenden dabei Zeichen, die mit Bedeutungen in Verbindungen stehen. Kommunikation ist wiederum Voraussetzung dafür, dass die Menschen Vorstellungen erzeugen und dass Wissen entsteht.“ (Hickethier 2003: 20)
Medien seien „gesellschaftlich institutionalisierte Kommunikationseinrichtungen“, wobei Hickethier (2003: 20) zwischen „informellen (nicht durch Organisationen, sondern durch Konventionen bestimmten) Medien“ (z.B. das Medium „Sprache“, die Musik, die Literatur) und „formellen (institutionalisierten) Medien“ (z.B. Telefon, Fernsehen, Radio, Presse usw.) unterscheidet.
Demnach wäre der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit im formellen Bereich der Medien angesiedelt.
Kommunikationsorientiert ist auch die Definition, die Faulstich vorschlägt. Sie geht ursprünglich auf Saxer (1999: 6) zurück, dessen Definition auch von Burkart, Jarren und Maletzke aufgegriffen wird (Burkart 2003: 187; Jarren 2003: 15; Maletzke 1998: 52) und in der Medien- und Kommunikationswissenschaft anerkannt zu sein scheint: „Medien sind komplexe institutionalisierte Systeme um organisierte Kommunikationskanäle von spezifischem Leistungsvermögen.“
Saxer (1999: 5) will damit ein medienwissenschaftliches Konzept schaffen, „das dieser scientific community Identität verleiht, dem expansiven Gegenstand gerecht wird und die medienbezogenen Beiträge unterschiedlicher Disziplinen integriert“. Ziel ist es, einen gemeinsamen Fragehorziont bzw. ein kohärentes Forschungsfeld festzumachen (vgl. Saxer 1999: 5). Die Beschreibung allgemeiner Medien-Charakteristika soll dies ermöglichen. Saxer (1999: 5f.) nennt fünf Medien-Merkmale, die schließlich zu seiner Medien-Definition geführt haben:
1 Medien sind Kommunikationskanäle. Diese Kanäle stellen je nach technischer Beschaffenheit bestimmte Zeichensysteme, Inhalte usw. bereit.1
2 Medien sind Organisationen, d.h. Sozialsysteme. Organisation ist notwendig, damit ein Medium seine Produkte bereitstellen kann.2
3 Medien sind komplexe Systeme, da sie etwa aus „Herstellungs-, Bereitstellungs- und Empfangsvorgängen“ bestehen.3
4 Medienkommunikation wirkt sich in allen gesellschaftlichen Bereichen funktional und dysfunktional aus. Sie haben ein spezifisches Leistungsvermögen, z.B. wird durch sie zu etwas aufgefordert (Werbung) oder es werden räumliche, zeitliche und soziale Distanzen überwunden (World Wide Web).4
5 Medien sind institutionalisiert. Sie sind „ins gesellschaftliche Regelsystem eingefügt“ und werden zum Teil über Marktmechanismen, zum Teil über die Politik geregelt.5
Nun aber zurück zu Faulstich: Auch er führt fünf konstitutive Medien-Merkmale an, die sich jedoch teilweise von Saxers Merkmalen unterscheiden (2002: 23f.):
1 Ein Medium ist ein „Bestandteil zwischenmenschlicher Kommunikation“, wobei diese Kommunikation vermittelt ist (im Gegensatz zur face-to-face-Kommunikation).
2 Ein Medium ist dementsprechend also ein „Kanal“.
3 Jeder dieser Kommunikationskanäle hat ein spezifisches Zeichensystem, „das die Vermittlung und das Vermittelte prägt oder zurichtet“ (z.B. Radio – auditives Zeichensystem, Zeitung – Druckmedium, Fernsehen – audiovisuelles Zeichensystem, World Wide Web – digitales Medium).
4 „Bei jedem Medium handelt es sich um eine Organisation.“ D.h., das Medium ist institutionalisiert.
5 Jedes Medium entwickelt sich, unterliegt daher einem „geschichtlichen Wandel“ und kann zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche gesellschaftliche Bedeutung haben.
Nach Faulstich (2002: 25) gibt es zwar bisher noch keine umfassende, allgemein anerkannte Definition von „Medium“ „im Sinne einer komplexen Medientheorie“. Saxers Definition (s.o.) erscheint ihm allerdings als die bisher gelungenste, wobei er diese um eine Komponente erweitert, mit der er die Bedeutung der Medien für die Gesellschaft betonen will (Faulstich 2002: 26): „Ein Medium ist ein institutionalisiertes System um einen organisierten Kommunikationskanal von spezifischem Leistungsvermögen mit gesellschaftlicher Dominanz.“MassenmedienMassenmedien
Blicken wir zurück auf die Dudendefinitionen von „Medium“: Saxers bzw. Faulstichs Medienbegriff scheint alle Bedeutungen auszuschließen, ausgenommen die Bedeutung 2.a, nach der ein Medium eine „Einrichtung, [ein] organisatorischer u. technischer Apparat für die Vermittlung von Meinungen, Informationen, Kulturgütern“ bzw. „eines der Massenmedien Film, Funk, Fernsehen, Presse“ ist.
Für die vorliegende Arbeit wird Faulstichs (bzw. Saxers) Medienbegriff übernommen. Demnach ist etwa die Sprache kein Medium (bei Hickethier wird sie als informelles Medium bezeichnet), auch I-Pods, Computer als Geräte oder gar die Schrift – all diese Dinge sind keine Medien (wie noch bei Marshall McLuhan; vgl. hierzu Faulstich 2002: 216), sondern vielmehr Instrumente, derer sich Medien allenfalls bedienen. Ein Medium wird erst zu einem Medium, wenn es zu einem institutionalisierten System wird, das bestimmte gesellschaftliche Aufgaben löst. Dies trifft vor allem auf die sogenannten Massenmedien zu, also auf „technisch produzierte und massenhaft verbreitete Kommunikationsmittel […], die der Übermittlung von Informationen unterschiedlicher Art an große Gruppen von Menschen dienen“ (Hickethier 2003: 24). Eines dieser Massenmedien steht im Fokus der vorliegenden Arbeit: die Tagespresse.Massenkommunikation