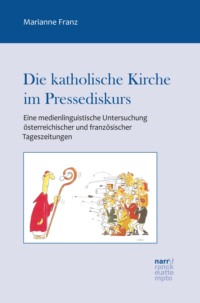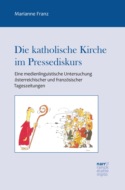Kitabı oku: «Die katholische Kirche im Pressediskurs», sayfa 3
2.2 Massenkommunikation
Im untrennbaren Zusammenhang mit (Massen-)Medien steht die sogenannte Massenkommunikation. In beiden Komposita (Massen-Kommunikation und Massen-Medien) drückt „Masse“ aus, dass ein disperses Publikum angesprochen wird. Da die Tagespresse ein Massenmedium ist und daher Massenkommunikation „betreibt“, soll hier kurz auf die Besonderheiten der Massenkommunikation (vor allem im Vergleich zur interpersonalen – privaten – Kommunikation) eingegangen werden.
Maletzke versuchte 1963 eine Definition, die bis heute weit verbreitet ist (zitiert nach Hickethier 2003: 25):
„Unter Massenkommunikation verstehen wir jene Form der Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich (also ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft), durch technische Verbreitungsmittel (Medien), indirekt (also bei räumlicher oder zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz zwischen den Kommunikationspartnern) und einseitig (also ohne Rollenwechsel zwischen Aussagenden und Aufnehmenden) an ein disperses Publikum […] gegeben werden.“
Interpersonale Kommunikation wäre demnach eine Form der Kommunikation, bei der die Aussagen privat, mit oder ohne technische Verbreitungsmittel (gesprochene Sprache, Telefon), direkt (face-to-face) oder indirekt (Briefkommunikation, E-Mail, Telefon) und wechselseitig zwischen Aufnehmenden und Aussagenden an eine einzelne Person oder aber ein konkretes Publikum (Gruppe) gegeben werden.
Maletzke verpackte seine Definition der Massenkommunikation schließlich in ein grafisches Modell (Abb. 2), deren Hauptbestandeile die vier Faktoren Kommunikator (K), Aussage (A), Medium (M) und Rezipient (R) bilden.
 Abb. 2:
Abb. 2:
Feldmodell der Massenkommunikation (Quelle: Maletzke 1963: 41, zitiert nach Burkart 2003: 184)
Maletzke selbst beschreibt das Schema bzw. die Beziehung der vier Faktoren zueinander folgendermaßen (1988, zitiert nach Rusch 2002c: 106f.):
„Der KommunikatorKommunikator (K) produziert die Aussage durch Stoffwahl und Gestaltung. Seine Arbeit wird mitbestimmt durch seine Persönlichkeit, seine allgemeinen sozialen Beziehungen (u.a. persönliche direkte Kommunikation), durch Einflüsse aus der Öffentlichkeit und durch die Tatsache, dass der Kommunikator meist in einem Produktionsteam arbeitet, das wiederum einer Institution eingefügt ist. Außerdem muss der Kommunikator die Erfordernisse seines Mediums und des ‚Programms‘ kennen und berücksichtigen, und schließlich formt er sich von seinem Publikum ein Bild, das seine Arbeit und damit die Aussage und damit endlich auch die Wirkungen wesentlich mitbestimmt. Die Aussage (A) wird durch das Medium (M) zum Rezipienten geleitet. Sie muss dabei den technischen und dramaturgischen Besonderheiten des jeweiligen Mediums angepasst werden. Der Rezipient (R) wählt aus dem Angebot bestimmte Aussagen aus und rezipiert sie. Der Akt des Auswählens, das Erleben der Aussage und die daraus resultierenden Wirkungen hängen ab von der Persönlichkeit des Rezipienten, von seinen sozialen Beziehungen, von den wahrnehmungs- und verhaltenspsychologischen Eigenarten des Mediums auf der Empfängerseite, von dem Bild, das sich der Rezipient von der Kommunikatorseite formt und von dem mehr oder weniger klaren Bewusstsein, Glied eines dispersen Publikums zu sein. Schließlich deutet der obere Pfeil im Feldschema an, dass trotz der Einseitigkeit der Massenkommunikation ein ‚Feedback‘ zustande kommt.“
Der Vorteil dieses Modells ist, dass darin auch äußere Einflüsse auf KommunikatorKommunikator und Rezipienten Niederschlag finden. Weder Kommunikator noch Rezipient stehen isoliert da, sondern sind eingebettet in soziale Netzwerke, die sie beeinflussen.
In der wissenschaftlichen Rezeption geht dieses Modell einigen nicht weit genug. Faulstich sieht hier den gesellschaftlichen Kontext (Institutionen, Politik, Wirtschaft u.a.) unberücksichtigt, womit er Maletzke jedoch Unrecht tut. In seinem Schema sind sehr wohl Institutionen angeführt; außerdem lassen sich unter dem Einflussfaktor „Zwang der Öffentlichkeit“ wohl auch Politik und Wirtschaft subsumieren. Gerechtfertigte Kritik übt Faulstich hingegen, wenn er sagt, dieses Modell unterstelle „ein offensichtlich idealisiertes Gleichgewicht“ zwischen KommunikatorKommunikator und Rezipienten (Faulstich 2002: 40) – ein überzeugender Einwand, den auch Kübler (2003: 121) mit Faulstich teilt: Das Modell lässt
„weitgehend ausser Acht, dass sich im Zeitalter professioneller, hochorganisierter, machtpolitisch verstrickter und vor allem ökonomisch – sprich: auf Profitmaximierung – ausgerichteter Medienkommunikation die Gewichte zum Nachteil des Publikums verlagert haben, dass es mithin erhebliche Beeinflussungsmöglichkeiten und wohl auch Abhängigkeiten gibt; sie werden durch das Modell egalisiert und damit eskamotiert.“
Hickethier (2003: 51) sieht außerdem ein Problem darin, dass Maletzke von einem journalistischen Verständnis der Massenmedien auszugehen scheint, „bei dem ein einzelner ‚KommunikatorKommunikator‘ sich einer technischen Apparatur bedient und mit ihr viele ‚Rezipienten‘ erreicht“. Das Modell versagt allerdings, wenn es darum geht, komplexere Medienangebote zu beschreiben (wie Filme), bei der mehrere Personen arbeitsteilig mitwirken (vgl. Hickethier 2003: 51). Auch Pressetexte sind komplexe Medienangebote, die nicht auf einen einzelnen Kommunikator zurückgehen, sondern von mehreren Kommunikatoren oder Autoren produziert werden (siehe dazu auch Abschnitt 3.1.1). Nicht nur dass viele Artikel von Presseagenturen hergestellt und von den Zeitungsredakteuren nur noch angepasst (gekürzt, erweitert usw.) werden, es werden auch unterschiedlichste Quellen zitiert (Politikeraussagen, Grafiken von Statistik-Büros usw.).
Massenkommunikation ist also öffentlich, indirekt und einseitig und richtet sich an ein disperses Publikum. Doch seit den 1960ern hat sich viel getan. Das World Wide Web und die zahlreichen Möglichkeiten der Interaktivitäten brachten große Veränderungen mit sich, die die Grenzen zwischen interpersonaler und Massenkommunikation verschwimmen ließen. Kübler (2003: 124) vertritt die Meinung, dass „angesichts der einhergehenden Transformationen […] nicht mehr so eindeutig und dipodisch zwischen personaler und Massenkommunikation“, zwischen Öffentlichem und Privatem getrennt werden kann. Kübler versucht die Neuerungen in Maletzkes Definition zu integrieren bzw. diese zu aktualisieren:
Unter medialer Kommunikation verstehen wir die (sich mehr und mehr verbreitende) Form der Kommunikation, bei der
 Tab. 2:
Tab. 2:
Definition von medialer Kommunikation (Quelle: Kübler 2003: 124; eigene Darstellung)
Anhand der Online-Medien können diese neuen Entwicklungen am geeignetsten festgemacht werden. Das Internet ist einerseits öffentlich, d.h. von allen (mit Internetzugang) benützbar; andererseits gibt es Bereiche, die privat, etwa durch Passwörter geschützt, sind (Newsgroups, Chatrooms, Blogs usw.). Andere Merkmale der Massenkommunikation waren laut Maletzke die Einseitigkeit der Kommunikation sowie die raumzeitliche Distanz der Kommunikationspartner, die jedoch im World Wide Web zum Teil aufgebrochen scheinen.
„Elektronische Daten sind allerorts (nahezu) gleichzeitig mit ihrer Schöpfung und Eingabe verfügbar, so dass nicht nur der Zeitverzug innerhalb der Produktion, der durch diverse Phasen der Materialisierung und Gestaltung – etwa beim Druck – verursacht wird, wegfällt oder zumindest enorm reduziert wird: Letztlich fallen Produktion und Rezeption zusammen, was mit dem Begriff ‚Echtzeit‘ (Virilio 1996; Kloock 2000, 161ff.) gekennzeichnet wird; beim Internet können sie – wie im personalen Dialog – ständig wechseln. Vor allem das charakteristischste Kriterium der Massenkommunikation, die Einseitigkeit des Kommunikationstransfers, wird mehr und mehr aufgehoben – entsprechend erodiert die Dualität von personaler und Massenkommunikation.“ (Kübler 2003: 125f.)
Auch wenn der Begriff „Echtzeit“ sicherlich nicht zutrifft, da die eingegeben Daten erst übertragen werden müssen, ist die zeitliche Distanz beim Chat, beim Instant Messaging oder etwa bei der Internettelefonie tatsächlich kaum mehr wahrnehmbar.
Kübler mag in vielen Dingen Recht haben; sein Konzept der „allmähliche[n] Aufweichung der Massenkommunikation und [der] Mutationen zur medialen Kommunikation“ (2003: 123) scheint mir ein wenig zu drastisch. Massenkommunikation geht aufgrund der neuen Entwicklungen nicht verloren. Die „alten“ Medien (Fernsehen, Rundfunk, Presse) machen sich die „neuen“ zwar zunutze: Tageszeitungen gehen online, man kann diverse Nachrichtensendungen des ORF im Web ansehen, das Fernsehprogramm nachlesen, Rundfunksender haben Internetauftritte mit verschiedensten Angeboten und sind auch über Internet empfangbar (mit einer kleinen Zeitverschiebung). Dennoch: Die alten, traditionellen Medien mit ihren typischen „massenkommunikativen“ Merkmalen bleiben parallel dazu bestehen. Es ist ein Mehr an Angebot, aber das eine ersetzt das andere nicht.
Manche von Kübler angesprochene Neuerungen sind gar nicht so neu: Privatheit und Öffentlichkeit wurden auch in den „alten“ MassenmedienMassenmedien bereits gerne vermischt (Geburtstagswünsche, Informationen über Schul- oder Studienabschlüsse, Todesfälle usw. im Anzeigenteil der Tageszeitungen, Grüße an den oder die Liebste(n) über das Radio usw.). Auch die Einseitigkeit konnte in gewissen Fällen durchbrochen werden (Leserbriefe, Anrufer beim Rundfunk oder bei Live-Sendungen im Fernsehen). Die von Maletzke angeführten Merkmale der Massenmedien „öffentlich“, „einseitig“, „indirekt“ und „an ein disperses Publikum gewandt“ sind daher nicht ausschließlich zu sehen, sondern vorrangig.
Allerdings stimme ich Kübler in Bezug auf die Online-Medien zu. Das World Wide Web vermittelt neben öffentlicher bzw. Massenkommunikation auch private, interpersonale Kommunikation (E-Mail, Instant Messaging, Blogs, Chats, Plattformen wie Facebook usw. – oft durch Passwörter geschützt). Für dieses „Massen“-MediumMedium trifft es zu, dass die „Massen“-Kommunikation zum Teil aufgeweicht scheint. Es gestattet den Usern wie kein anderes Massenmedium auf Kommuniziertes zu antworten (viele Online-Tageszeitungen ermöglichen ihren Lesern etwa, auf Artikel direkt zu reagieren bzw. KommentareKommentar auf die Website zu posten). Privates und Öffentliches verschwimmen – man denke an zwar private, aber öffentlich zugängliche Blogs, die zum Teil eine große Öffentlichkeit erlangen (z.B. der Warblog eines Mannes aus Bagdad mit dem Pseudonym Salam Pax, der über das Kriegsgeschehen im Irak berichtete und 2003 das weltweite Interesse der Medien, so auch der New York Times, auf sich zog).
Nichtsdestoweniger müsste Küblers Definition, die ja die mediale Kommunikation im Allgemeinen in den Blick nimmt, in Bezug auf die Massenkommunikation abgeändert werden. Ausschließlich auf Massenkommunikation bezogen, könnte also eine Definition folgendermaßen lauten:
Unter Massenkommunikation verstehen wir die Form der Kommunikation, bei der
 Tab. 3:
Tab. 3:
Gedankenexperiment zu einer zeitgemäßen Definition von MassenkommunikationKommunikator
Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit, die ausschließlich die Printausgaben der Tageszeitungen in den Blick nimmt (die Internetauftritte bleiben unberücksichtigt), reicht Maletzkes Definition bzw. sein Modell der Massenkommunikation aus, um die Grundzüge der Kommunikationsvorgänge der Presse zu beschreiben.
Die Tageszeitungen als Printprodukte vermitteln eine Form der Kommunikation, bei der
 Tab. 4:
Tab. 4:
Definition der Massenkommunikation in Tageszeitungen (Printversion)
2.3 Kommunikatorforschung
Kommunikatorforschung beschäftigt sich „mit den Bedingungen und Voraussetzungen der Aussagenproduktion und -gestaltung“ (Beck 2006c: 136) „in den Institutionen der Massenkommunikation“ (Weischenberg 1999: 58). Dabei lag der Fokus lange Zeit auf der „Erforschung journalistischer Kommunikatoren“ (Beck 2006b: 136) und wurde später etwa auch auf „PR-Manger und ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘“ ausgedehnt (Beck 2007: 165). Dennoch ist die deutschsprachige Kommunikatorforschung immer noch sehr stark auf den Journalismus ausgerichtet (vgl. dazu auch Pürer 2003: 108f.).
In den Anfängen dieser Forschungsdisziplin wurden Journalisten als individuell bzw. autonom handelnde Kommunikatoren gesehen. Mittlerweile ist man von dieser Sichtweise abgekommen. Die Kommunikate werden in der Regel arbeitsteilig hergestellt und man spricht daher auch von „kollektiven Akteuren“ (vgl. Beck 2007: 164). Zu den Kommunikatoren zählen alle am Prozess der Publikation Beteiligten. Das können Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche sein wie
„Redakteure, Reporter, Fotoreporter, Autoren, Rechercheure und Archivare ebenso wie Pressesprecher, Kommunikationsmanager, aber auch Layouter, Grafiker, Cutter, Werbegestalter, Webdesigner und -programmierer, Ton- und Bildingenieure, Drucker, Kameraleute und Verleger, Herausgeber, Programmdirektoren, Intendanten oder andere dispositiv Tätige“ (Beck 2007: 164f.).
Der Sprachwisssenschaftler Bucher verwendet für das Phänomen der arbeitsteiligen Herstellung von Kommunikaten den Begriff „Mehrfachautorenschaft“:
„Medienbeiträge sind hinsichtlich ihrer Urheberschaft mehrschichtig. Sie sind einem Träger des Verbreitungsmediums verpflichtet – beispielsweise einem Verlagshaus oder einer öffentlichen Anstalt – gehen zurück auf verschiedene Quellen – geschriebene Texte, Dokumente, aufgezeichnete oder mitgeschriebene Äußerungen – werden mehrfach überarbeitet und in der Präsentation zusätzlich formatiert, beispielsweise in das Layout einer Tageszeitung eingepaßt oder von einer Rundfunksprecherin dem eigenen Sprechduktus angepaßt.“ (Bucher 1999a: 216)
Im publizistischen Bereich wären solche Mehrfachautoren etwa Journalist, Chefredakteur, Verlagshaus, Presseagentur, von der Material bezogen wird, Grafiker usw. Goffmann und Bell führen folgende Autoren an: den Prinzipal, den Urheber der Äußerung, den Berichterstatter, den Editor oder redigierenden Redakteur und den Präsentator (vgl. Bell 1991, Goffman 1981, zitiert nach Bucher 1999a: 216).
Allerdings unterscheidet sich der Begriff „kollektiver Kommunikator“ vom Begriff „Mehrfachautorenschaft“ dahingehend, dass mit Ersterem eindeutig nur die vermitteltende Instanz bezeichnet wird und nicht etwa die „Urheber der Aussage oder die Quellen“ (Beck 2007: 163), mit Zweiterem auch das Vermittelte, wenn beispielsweise Aussagen verschiedener Personen (mitunter in direkter Rede) wiedergegeben werden. Bucher (vgl. 1999a: 216f.) differenziert diesbezüglich zwischen der Kommunikationsebene der Darstellung (die mediale Handlung) und der Kommunikationsebene des Dargestellten (die Handlungen, die Gegenstand der Berichterstattung, der Kommentierung oder von Mediendialogen sind). Die Mehrfachautorenschaft rechtfertigt es, von einer „Intertextualität“ der Medienbeiträge zu sprechen (vgl. Bucher 1999a: 216).
Zurück zum Begriff „Kommunikator“: Ein Kommunikator im weitesten Sinne steht also für die „publizistische Institution der Aussagenentstehung“ (Weischenberg 1999: 60), er ist ein „Akteur (Handlungs- und Rollenträger), der Aussagen für die öffentliche Kommunikation bereitstellt“ (Beck 2006b: 135). Zu bemerken ist, dass die Rolle des Kommunikators stabil ist – im Gegensatz zur interpersonalen Kommunikation, wo Kommunikatoren und Rezipienten die Rollen wechseln.
Öffentliche Kommunikation wird erst durch Kommunikatoren möglich. Diese haben verschiedene Funktionen zu erfüllen: „Vermittlung von Information, aber auch Überzeugung oder Überredung“ usw. (Beck 2006b: 136). Kommunikatoren gestalten, be- und verarbeiten, selektieren, steuern und präsentieren (vgl. Beck 2007: 163f.). Ihnen „kommt damit nicht nur eine funktionale Schlüsselrolle im Kommunikationsprozess zu, sondern auch eine einflussreiche oder gar mächtige Position“. Kommunikatoren entscheiden „maßgeblich darüber […], welche Nachrichten, Themen und Meinungen Eingang in die öffentliche Kommunikation finden“ (Beck 2007: 165).
Welche Erkenntnisse – vor allem in Bezug auf den in dieser Arbeit interessierenden Journalismus – verdanken wir nun der Kommunikatorforschung? Im Laufe der Entwicklung dieses Forschungsfeldes wurden unterschiedliche theoretische Ansätze verfolgt. Löffelholz (2003) liefert diesbezüglich einen sehr guten Überblick. Auch wenn er anmerkt, dass aufgrund des „pluralistische[n], differenzierte[n] und dynamische[n] Forschungsgebiet[s] innerhalb der Kommunikationwissenschaft“ (2003: 31) eine Systematisierung nur sehr schwer möglich ist, versucht er in seinem Artikel dennoch eine solche. Dazu ordnet er „unterschiedliche theoretische Ansätze, die sich in ihrem Entstehungskontext, ihrer Herangehensweise, ihrem jeweiligen Untersuchungsfokus, der Komplexität ihrer Theoriearchitektur und ihrem Ertrag für die empirische Forschung ähneln“ (Löffelholz 2003: 31) sogenannten Theoriekonzepten zu, insgesamt acht an der Zahl. Sie werden in ihren Grundzügen auch von Beck (2007) im Zuge der Darstellung der Kommunikatorforschung in seiner Einführung in die KommunikationswissenschaftKommunikationswissenschaft. übernommen. Die acht Konzepte eignen sich insofern für die Beschreibung der Entwicklung der JournalismusforschungJournalismusforschung (s. a. Kommunikator), als dass ihre aufsteigende Nummerierung weitgehend der Chronologie ihrer Entstehung entspricht. Eine kurze Übersicht über Charakteristiken der einzelnen Konzepte ermöglicht folgende Tabelle (Tab. 5).1
 Tab. 5:
Tab. 5:
Synopse theoretischer Konzepte der JournalismusforschungJournalismusforschung (s. a. Kommunikator) (Quelle: Löffelholz 2003: 33)
In den folgenden Abschnitten werden nun einige konkrete Ergebnisse (vor allem aus dem Bereich des analytischen und legitimistischen Empirismus sowie aus der Systemtheorie) vorgestellt, die für die Überprüfung der Hypothesen der vorliegenden Arbeit zentral sind (siehe Abschnitt 1.2). Es geht um die Art und Weise, welche Nachrichten von Journalisten ausgewählt werden. Dabei bildet die NachrichtenwerttheorieNachrichtenwert die Grundlage der ThemenfrequenzanalyseThemenfrequenzanalyse (siehe Abschnitt 11). Daneben werden in aller Kürze noch andere Theorien der NachrichtenselektionNachrichtenselektion bzw. -rezeption dargelegt, da sie Aufschluss darüber geben, welche Prozesse sowohl die Berichterstattung als auch die Nachrichtenrezeption beeinflussen.Nachrichtenwert
2.3.1 Nachrichtenwerttheorie
Im Folgenden werden die zentralen für die vorliegende Arbeit relevanten Aussagen der Nachrichtenwerttheorie dargestellt. Für detaillierte Informationen verweise ich vor allem auf Maier u.a. (2010), auf die ich mich in diesem Abschnitt hauptsächlich beziehe.Nachrichtenfaktoren
Die Nachrichtenwerttheorie lässt sich bis in die 1920er Jahre zurückverfolgen, als sich Walter Lippmann damit auseinandersetzt, wie JournalistenJournalismusforschung (s. a. Kommunikator) Nachrichten auswählen und „welche Kriterien ein Ereignis erfüllen muss, um Redakteuren publikationswürdig zu erscheinen“ (Maier/Stengel/Marschall 2010b: 29). Einige von ihm angeführte Kriterien wie Negativität oder Betroffenheit der Leser sind den später entwickelten Nachrichtenfaktoren bereits ähnlich (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 30). Der Terminus „Nachrichtenfaktor“ selbst fällt erst in den 1960er Jahren. Norwegische Friedensforscher beschäftigen sich mit dem Nachrichtenfluss und führen erstmals auch Inhaltsanalysen durch, um die Auswahlkriterien der Journalisten herauszufinden (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 31). Wichtige Namen sind hier Østgaard, Galtung und Ruge. Østgaard zeigt neben äußeren (politischen und wirtschaftlichen) Faktoren, die auf den Nachrichtenfluss einwirken, auch dem Nachrichtenprozess inhärente Faktoren auf, die sowohl die Ereignisse, über die berichtet wird, betreffen als auch die Journalisten selbst. Solche inhärenten Faktoren sind Vereinfachung, Identifikation und Sensationalismus (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 33f.). Galtung und Ruge zufolge spiegeln Nachrichtenfaktoren „allgemeine menschliche Wahrnehmungsprozesse“ wider (vgl. 1965, zitiert nach Maier/Stengel/Marschall 2010b: 34). Es handelt sich dabei um „Ereignismerkmale, die grundsätzlich das Interesse von Menschen auf sich ziehen, die einen Einfluss darauf haben, wie aufmerksam ein Thema in den Medien verfolgt wird“. Nachrichtenfaktoren sind also „allgemeine kognitionspsychologische Mechanismen“, die nicht nur die Themenauswahl beeinflussen, sondern auch die Rezeption der Berichterstattung (Maier 2010a: 26). Galtung und Ruge (vgl. 1965, zitiert nach Maier 2010a: 23) stellen drei Hypothesen bezüglich des Zusammenwirkens der einzelnen Nachrichtenfaktoren und ihrer Auswirkung auf die NachrichtenselektionNachrichtenselektion auf: 1. die Additivitätshypothese, der zufolge es wahrscheinlicher ist, dass ein Ereignis zur NachrichtNachricht wird, je mehr Nachrichtenfaktoren auf es zutreffen; (2) die Komplementaritätshypothese, die besagt, dass ein nicht vorhandenes Merkmal durch den hohen Wert eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann, so dass das Ereignis dennoch zur Nachricht wird; (3) die Exklusionshypothese, nach der ein Ereignis mit zu wenigen oder keinen Nachrichtenfaktoren keinen Eingang in die Berichterstattung findet.
Kepplinger (2008, zitiert nach Maier 2010a: 18) beschreibt „Nachrichtenfaktoren“ später als „Merkmale von Nachrichten über Ereignisse und Themen, die dazu beitragen, dass diese publikationswürdig bzw. mit Nachrichtenwert versehen werden“. Aus dieser Definition geht hervor, dass zwischen Nachrichtenfaktor und Nachrichtenwert zu unterscheiden ist. Der Wert einer NachrichtNachricht steigt, je mehr Faktoren sie erfüllt. Anzahl und Ausprägung bzw. Intensität der Nachrichtenfaktoren bestimmen somit den Nachrichtenwert.
„Dieser Nachrichtenwert entscheidet darüber, ob ein Ereignis in der medialen Berichterstattung überhaupt verwertet wird und in welchem Umfang. Dieser Nachrichtenwert eines Ereignisses wird seit Schulz (1976) anhand verschiedener (formaler) Maßzahlen gemessen, in denen sich journalistische Beachtung ausdrückt: z.B. anhand der Platzierung eines Beitrags auf der Titelseite einer Zeitung […] oder anhand der Länge des Beitrags […].“ (Maier 2010a: 19)
Seit Schulz ist die Nachrichtenwertforschung vor allem in Deutschland beheimatet (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 39f.). Die Anzahl der Nachrichtenfaktoren, die sich bei Galtung und Ruge noch auf zwölf belief (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010b: 36), wird von Schulz auf 19 erweitert. Er fasst sie aber zu sechs übergeordneten Faktorendimensionen zusammen (Konsonanz, Status, Dynamik, Valenz, Identifikation und Relevanz) (vgl. Schulz 1976 und 1982, zitiert nach Maier/Marschall 2010: 98f.). Auch andere Wissenschaftler, wie Staab, Donsbach, Maier u.a. oder Fretwurst, haben versucht übergeordnete Dimensionen zu erschließen (vgl. z.B. Staab 1990, Donsbach 1991, Maier u.a. 2009, Fretwurst 2008, zitiert nach Maier/Marschall 2010: 98–102), um Redundanz der inzwischen 22 Nachrichtenfaktoren und damit „Mehrfachmessung der journalistischen Auswahlkriterien“ zu vermeiden. Denn allem Anschein nach „berücksichtigen Journalisten bei der Auswahl wichtiger Ereignisse für die Berichterstattung vermutlich nicht so viele Ereignismerkmale, wie die aktuelle Forschung zur Nachrichtenwerttheorie suggeriert“ (Maier/Stengel 2010: 101). Die von den verschiedenen Forschern aufgezeigten Dimensionen sind nachstehend gegenübergestellt (Tab. 6).
 Tab. 6:
Tab. 6:
Übergeordnete Faktorendimensionen der journalistischen Auswahl (Quelle: Maier/Stengel 2010: 103)
Maier und Stengel haben die vergleichbaren Faktorendimensionen zeilenweise nebeneinander angeordnet. Auch wenn sich die Termini zum Teil unterscheiden, sind die dahinterstehenden Merkmale großteils sinnverwandt (z.B. Status, Personalisierung, Prominenz, Personen). Hervorheben möchte ich den Faktor „Visualität“, der in der Tabelle bei Maier u.a. (2003–2009) vorkommt und ursprünglich von Ruhrmann u.a. eingeführt wurde, die sich mit dem Nachrichtenwert im deutschen Fernsehen auseinandergesetzt haben (vgl. Ruhrmann 2003, zitiert nach Maier/Stengel 2010: 108).
„Ausgehend von den Ergebnissen einer Journalistenbefragung zeigen sie zunächst, dass die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Film- und Bildmaterial einen der wichtigsten Einflussfaktoren für die Entscheidung über die Publikation eines Ereignisses als Nachrichtenmeldung darstellt (vgl. Diehlmann, 2003).“ (Maier/Stengel 2010: 108)
Dass Bilder in den letzten Jahrzehnten nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Presse immer wichtiger wurden und werden, wird auch in Abschnitt 3.2 erläutert. Rössler, Marquart, Kersten, Bomhoff (2009) sprechen diesbezüglich von Fotonachrichtenfaktoren und übertragen die Text-Nachrichtenfaktoren auf Bilder. Faktoren, die die Bildauswahl sowie den Grad der Aufmerksamkeit der RezipientInnen beeinflussen, sind Schaden, Gewalt und Aggression, Prominenz sowie Sex und Erotik (vgl. Rössler u.a. 2009, zitiert nach Maier/Stengel 2010: 110). Inwieweit das Vorhandensein von Bildern einen Nachrichtenfaktor in der Presse darstellt, ist noch nicht belegt.
Interessant ist, dass bisherigen Studien zufolge die Nachrichtenfaktoren medienübergreifend ähnlich sind. In Frage steht jedoch, ob die Ausprägung der Nachrichtenfaktoren, d.h. die den Faktoren zugesprochenen Werte, je nach MediumMedium und Redaktion unterschiedlich sein kann (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010c: 132f.). Ein weiteres Forschungsdesiderat besteht darin, ob die Nachrichtenwerttheorie auf verschiedene Kulturen gleichermaßen zutrifft, oder inwiefern die Nachrichtenfaktoren themenabhängig sind (vgl. Maier/Stengel 2010: 112f.). Die vorliegende Arbeit kann hier einen Beitrag leisten, da sie die Berichterstattung verschiedener Länder und verschiedener Redaktionen bezüglich eines spezifischen Themas vergleicht.
Kepplinger und Ehmig gehen in ihrer Zwei-Komponenten-Theorie davon aus,
„dass sowohl die Merkmale der Ereignisse (Nachrichtenfaktoren) als auch der Nachrichtenwert, den jeder einzelne Nachrichtenfaktor für ein spezifisches MediumMedium hat, die Nachrichtenauswahl bestimmen. Sie argumentieren, dass davon auszugehen sei, dass bestimmte Nachrichtenfaktoren z.B. für BoulevardzeitungenBoulevardzeitung wichtiger seien als für QualitätszeitungenQualitätszeitung. Daher versuchen sie den relativen Einfluss jedes einzelnen Nachrichtenfaktors zu errechnen und testen dann anhand einer zweiten StichprobeStichprobe (s. a. Künstliche Woche) die Qualität dieses Prognosemodells. Ihrer Meinung nach ist diese Prognosemöglichkeit eine der herausragenden Eigenschaften der Nachrichtenwerttheorie […]. Allerdings variieren diese Maßzahlen eben von Medium zu Medium und von Redaktion zu Redaktion, und auch die Forschung hierzu steht noch am Anfang […].“ (vgl. Kepplinger 2008 und Kepplinger/Ehmig 2006, zitiert nach Maier 2010a: 19)
Vorab kann festgestellt werden, dass die Nachrichtenwerttheorie die Hypothesen, von der die vorliegende Arbeit ausgeht (siehe Abschnitt 1.2), zu bestätigen scheint, wenn es um die tendenziell negative Darstellung der Kirche geht. Denn bisherige Studien zeigen:
„Das Weltbild in unseren Medien ist durch negative Ereignisse geprägt, die in relativer Nähe zu uns stattfinden, in denen vorrangig prominente Personen und aggressives Verhalten vorkommen, und die sich gut in (bewegten) Bildern darstellen lassen. Negativität, Personalisierung, Visualisierung, Boulevardisierung: all das sind oft beklagte mediale Trends unserer Zeit […].“ (vgl. Maier/Stengel/Marschall 2010c: 133)
Vorherrschende Methode, um festzustellen, welche Ereignisse welche Nachrichtenfaktoren aufweisen, ist die InhaltsanalyseInhaltsanalyse bereits publizierter Medienbeiträge. Dazu werden Nachrichtenfaktoren meist auf Artikel- oder Beitragsebene codiert (vgl. Maier 2010b: 53), indem durch „eine subjektive Interpretationsleistung“ „die Merkmale des berichteten Ereignisses“ analysiert „und auf der zur Verfügung stehenden Skala“ eingeordnet werden (Maier 2010b: 55). Die Distribution der Nachrichtenfaktoren gibt Aufschluss über ihre Relevanz bei der NachrichtenselektionNachrichtenselektion. Daneben wird, wie bereits erwähnt, auch der Nachrichtenwert festgestellt, indem man den Beachtungsgrad des Ereignisses in der Berichterstattung anhand seiner Platzierung und seiner Berichtlänge misst (vgl. Maier 2010a: 21). Damit die Zuweisung der Nachrichtenfaktoren nicht beliebig geschieht, muss ein Codebuch erstellt und Inter- bzw. Intracoder-Reliabilität sichergestellt werden.
In der vorliegenden Arbeit ist eine Intercoder-Reliabilität, bei der verschiedene Codierer dasselbe Material auf dieselbe Weise codieren, nicht möglich. Umso wichtiger ist die Einforderung der Intracoder-Reliabilität, bei der derselbe Codierer zur Überprüfung dasselbe Material mithilfe desselben Codebuchs mit zeitlichem Abstand ein weiteres Mal auf dieselbe Weise codiert (vgl. Maier 2010b: 58). Geachtet werden muss darüber hinaus auf Inhaltsvalidität (vollständiges KategorieKategoriensystem, das misst, was die Forschungsfrage beinhaltet) sowie Kriteriumsvalidität (externe Stützung der Studie durch andere Studien, frühere Befunde) und Inferenzvalidität (Prüfung der Plausibilität der vorgenommenen Inferenzschlüsse mit Ergebnissen anderer Studien oder Daten) (vgl. Rössler 2005, zitiert nach Maier 2010b: 60). Empfohlen wird eine Triangulation auf mehreren Ebenen (z.B. Daten-, Methoden-, Theorien- oder Forschertriangulation; vgl. Maier 2010b: 69), die in der vorliegenden Arbeit z.B. durch die JournalistInnen-Befragung versucht worden ist.
In der hier vorgenommen Untersuchung werden die Nachrichtenfaktoren im Rahmen der ThemenfrequenzanalyseThemenfrequenzanalyse relevant. Ziel ist es herauszufinden, inwieweit die Nachrichtenwerttheorie auf die Berichterstattung über die katholische Kirche zutrifft, welche Nachrichtenfaktoren vornehmlich Eingang finden, und welche Ereignisse von den JournalistInnen bevorzugt werden. Dazu werden die Themen der Artikel mit den Nachrichtenfaktoren abgeglichen, wofür ich auf die 22 Nachrichtenfaktoren nach Ruhrmann u.a. zurückgreife (vgl. 2003, zitiert nach Maier/Marschall 2010: 80–84). Ich behalte mir jedoch vor, die Liste, wenn nötig, abzuändern. Die 22 Faktoren sind: