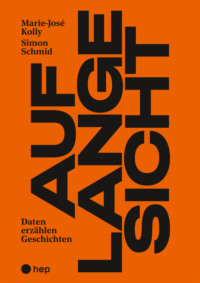Kitabı oku: «Auf lange Sicht (E-Book)», sayfa 3
Wie viel wir arbeiten
Olivia Kühni
Publiziert am 26.02.2018
 6 Minuten
6 Minuten
Die Arbeitszeit der Menschen hat über die Jahrzehnte deutlich abgenommen. Doch ein zweiter Blick – gerade auf die Situation der Frauen – zeigt ein differenzierteres Bild.
SOZIALES
Neun Stunden in Büro, Spital oder Schule statt zwölf in der Fabrik: Die arbeitenden Menschen in der Schweiz sind heute durchschnittlich deutlich weniger im Einsatz als zur Zeit unserer Urgrosseltern. Damit hat dieses Land eine ähnliche Entwicklung mitgemacht wie viele europäische Nachbarstaaten. Woran könnte das liegen? Weshalb sieht die Lage in den USA anders aus? Wo müssen wir vielleicht noch etwas genauer hinschauen? Dazu gleich. Zunächst zu den Daten:
1870 waren Arbeiter in der Schweiz durchschnittlich 3195 Stunden pro Jahr im Einsatz. Rund fünf Generationen später, im Jahr 2000, waren es mit 1597 Stunden noch rund die Hälfte. Ähnlich sieht die Gesamtentwicklung in elf westeuropäischen Ländern[1] aus, in der Grafik zusammengefasst unter «Europa». Überall haben die Jahresarbeitsstunden (G22) ab etwa 1910 stark, während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kaum und ab 1950 wieder stärker abgenommen.
Viele Statistiken in Wochenarbeitsstunden stellen jeweils nur die Entwicklung bei den Vollzeitstellen dar. Das sorgt für eine gute Vergleichbarkeit im Laufe der Zeit, schliesst aber einiges an Realität aus. In Jahresarbeitsstunden zu rechnen, hat den Vorteil, dass Teilzeitarbeit oder unregelmässige Arbeitszeitmodelle miteinbezogen werden. Dazu später mehr.
Etwas anders hingegen sieht es in den USA aus. Dort lagen die geleisteten Arbeitsstunden mit Ausnahme der Phase von der Grossen Depression bis zur Nachkriegszeit tendenziell leicht über jenen in Europa. Seit den 1980ern stagnieren sie auf doch deutlich höherem Niveau. Bei den Ferien und Feiertagen sieht es ähnlich aus: In der Schweiz sind diese von 13 Tagen (1870) über 28 Tage (1980) auf 33 Tage (2000) gestiegen, in den USA gleichzeitig von 4 Tagen auf 22 Tage gestiegen und dann wieder auf 20 gefallen. Sind die US-Amerikaner etwa einfach fleissiger als wir? Zunächst: Die Frage muss anderesherum gestellt werden. Nicht die USA sind eine bemerkenswerte Ausnahme, wie gern angeführt wird, sondern die westeuropäischen Länder. Die Menschen hier arbeiten durchschnittlich deutlich weniger als in anderen Ländern. Vergleicht man Grossstädte weltweit, arbeiten die Menschen in Hongkong, Mexiko-Stadt, Nairobi, Tokio, Doha oder Chicago viele Hundert Stunden jährlich mehr als Zürcherinnen oder Genfer. Die Frage müsste also vielmehr lauten: Warum arbeiten wir so viel weniger als Menschen in anderen Teilen der Welt?
Reichtum und Strassenkampf
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die zu einer Erklärung dieses Phänomens beitragen können. Die zwei offensichtlichsten: Reichtum und Strassenkampf. Je mehr Wohlstand die Menschen in einem Land mit jeder Arbeitsstunde erarbeiten (die sogenannte Arbeitsproduktivität), desto weniger lange arbeiten sie. Dieser Zusammenhang ist gut belegt, doch eine abschliessende Antwort liefert das noch nicht. Dies ist politisch und historisch bedingt: Unternehmen in Europa wurden dank der Industrialisierung im Laufe des 19. Jahrhunderts tatsächlich immer effizienter im Erwirtschaften von Wohlstand (eben: produktiver). Gut organisierte Arbeiterbewegungen sorgten dafür, dass sich der wachsende Reichtum in kürzeren Arbeitszeiten niederschlug. In den USA hingegen war und ist die Situation eine andere: Die Staaten sind eine Gesellschaft von Einwanderern und Pionierinnen, mit harter Konkurrenz im Arbeitsmarkt, im Vergleich zu Europa schwachen Arbeiterbewegungen und einer deutlich höheren Lohnungleichheit. Letztere hat in den vergangenen Jahrzehnten in den USA noch einmal zugenommen.
Der Zusammenhang zwischen ungleichen Löhnen und langen Arbeitsstunden ist gut belegt: Am unteren Ende der Einkommensskala müssen die Menschen viel arbeiten, um zu überleben, am oberen Ende tun sie es, da sich zusätzlich geleistete Stunden deutlich mehr auszahlen, als dies in einem europäischen Land der Fall wäre. Kurz: Geringe und abnehmende Stundenzahlen sind nicht nur eine Frage der Produktivität, sondern stets ein Spiegel von Kultur und politischen Präferenzen.
Die Frauen stocken auf
Die Ergebnisse von Langzeitstudien zu den Arbeitsstunden sollte man mit Vorsicht geniessen. Die Ökonomie vergass lange Zeit den unsichtbaren, nicht quantifizierten Zwilling von Fliessbandarbeit oder Bürojob: die unbezahlte Haushaltsarbeit. Man könnte auch sagen: Sie übersah die Realität vieler Frauen. Das hat auch hier Folgen. Viele Langzeitstudien zu den geleisteten Arbeitsstunden zählen diese Stunden nicht pro Kopf in der Bevölkerung, sondern pro Arbeiter, bei Rechnungen zu Wochenstunden oft gar pro Vollzeitarbeiter. Die Methode schafft eine gute Vergleichbarkeit: Man kann Aussagen darüber treffen, wie sich die durchschnittliche Belastung von aktiven Arbeiterinnen, quasi die Arbeitsverhältnisse, über die Jahre hinweg entwickelt hat. Daraus lässt sich durchaus eine Vorstellung davon gewinnen, wie sich die Arbeitslast der gesamten Gesellschaft verändert. Allerdings ist diese Vorstellung nur dann verlässlich, wenn sich an der Erwerbsbeteiligung nichts Fundamentales geändert hat. Mit anderen Worten: Arbeitet der durchschnittliche Arbeiter neu sechs statt zwölf Stunden, hat sich die generelle Arbeitszeit in der Gesellschaft nur dann halbiert, wenn die sechs Stunden dafür nicht jemand anderes zusätzlich übernommen hat. Reduzierte Arbeitsstunden können etwas anderes bedeuten als generell weniger Arbeit: nämlich gleich viel Arbeit wie zuvor, einfach auf mehr Schultern verteilt. Was vielleicht auch eine erfreuliche Erkenntnis ist – nur eben eine andere.
| G22 | JAHRESARBEITSSTUNDENpro Arbeiter |

QUELLE: Huberman $ Minns (2007)
| G23 | WOCHENARBEITSSTUNDEN (USA)pro Person ab 14 Jahren |

QUELLE: Ramey $ Francis (2009)
Genau das ist tatsächlich zum Teil geschehen. Den beiden Ökonomen Valerie A. Ramey und Neville Francis fiel der blinde Fleck vieler Studien auf. Im Jahr 2009 begannen sie, die geleisteten Arbeitsstunden in den USA (G23) statt pro Arbeiter pro Person im erwerbsfähigen Alter umzurechnen, zusätzlich analysiert nach Geschlecht und Alter. Sie kamen zu folgenden Erkenntnissen:
—Die geleisteten (bezahlten) Arbeitsstunden pro Kopf in der Bevölkerung haben seit 1900 tatsächlich abgenommen. Die durchschnittliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger ist insgesamt geringer geworden, jedoch nicht in dem Ausmass, wie man es angesichts der üblichen Stundenrechnungen vermuten könnte.
—Die Abnahme gilt ausserdem nicht für jede Bevölkerungsgruppe. Junge Menschen bis zur Volljährigkeit arbeiten durchschnittlich weniger als vor hundert Jahren (wegen der Schule), dasselbe gilt für Menschen ab 65 Jahren sowie Männer in sämtlichen Altersgruppen. Frauen ab 18 Jahren hingegen arbeiten durchschnittlich mehr und ab 25 Jahren sogar deutlich mehr Wochenstunden als noch um 1900.
Die Zahlen gelten für die USA und sind darum nicht zuverlässig auf die Schweiz oder andere europäische Länder übertragbar. Die Erwerbsbeteiligung der Frauen ist jedoch auch auf dem europäischen Kontinent gestiegen. Das Fazit dürfte lauten: Nicht alle der verschwundenen Stunden haben steigender Wohlstand und politischer Kampf in eifriger Zweisamkeit geschluckt – einen Teil davon haben auch einfach die Frauen geschultert. Was wiederum nicht nur auf den Feminismus zurückzuführen ist, sondern auch auf die Art von Jobs, die in den letzten Jahrzehnten entstanden und verschwunden sind.
Bei der (unbezahlten) Haushaltsarbeit übrigens ist es genau umgekehrt: Hier haben die Männer zugelegt. Um zu wissen, wie viel zusätzliche Freizeit wir im letzten Jahrhundert tatsächlich gewonnen haben, muss man diese Arbeit natürlich miteinbeziehen. Hierzu nur so viel: Wo Mühsal wegfiel, fanden wir oft rasch wieder Neues zu tun.
DIE DATEN
Die Langzeitstudie zur Entwicklung der Arbeitsstunden stammt von Michael Huberman (Universität Montreal) und Chris Minns (London School of Economics and Political Science): «The times they are not changin’: Days and hours of work in Old and New Worlds, 1870–2000», erschienen in «Explorations in Economic History» (2007).
Ihre Daten trugen die Wirtschaftshistoriker aus einer Vielzahl von Quellen zusammen, unter anderem von der Internationalen Arbeitsorganisation und dem Groningen Growth and Development Centre der Universität Groningen sowie, insbesondere in jüngerer Zeit, von den offiziellen Ämtern der jeweiligen Staaten, in der Schweiz dem Bundesamt für Statistik.
Wie enden Epidemien?
Simon Schmid
Publiziert am 09.03.2020
aktualisiert am 23.02.2021
 11 Minuten
11 Minuten
Ein Rückblick auf drei vergangene Infektionskrankheiten. Und ein vorsichtiger Ausblick auf die Zukunft des Coronavirus.
GESUNDHEIT
Survival of the fittest: Charles Darwin bediente sich dieser Kurzformel, um das Prinzip der Evolution zu beschreiben. Es überlebt die Art, die am besten an die Umwelt angepasst ist. Wie funktioniert dieses Prinzip bei Viren? Welche Krankheitserreger haben die grössten Chancen, sich in der menschlichen Population auf Dauer zu verbreiten – und welche Viren werden relativ rasch wieder ausgemerzt? Der Rückblick auf die letzten Epidemien zeigt: Erfolgreich sind gerade nicht die Keime, welche die Menschheit mit schlimmen Krankheiten in Angst und Schrecken versetzen. Erfolg haben Viren mit anderen Eigenschaften.
Sars
Am 16. November 2002 wurde in der südchinesischen Provinz Guangdong von einem Patienten mit einer atypischen Lungenentzündung berichtet. Bald stellte sich heraus: Es handelte sich um eine Infektionskrankheit, die von einem bis dahin unbekannten Erreger aus der Familie der Coronaviren verursacht wird. Die Krankheit erhielt den Namen «Schweres akutes Atemwegssyndrom» (Severe acute respiratory syndrome, Sars (G24)).
—Betroffene: Insgesamt 8422 Menschen steckten sich über die nächsten Monate damit an. 916 Menschen starben (wobei die genauen Zahlen je nach Quelle etwas variieren). Die meisten Fälle traten in Südostasien auf.
—Verbreitung: Bevor Kontrollmassnahmen eingeleitet wurden, steckte jeder Sars-Infizierte im Schnitt zwei bis drei weitere Menschen an.
—Sterblichkeit: Mit einer Sterberate von rund 10 Prozent war das Virus ein gefährlicher Erreger. Er befiel Personen allen Alters und war besonders für Patienten über 65 Jahre vielfach tödlich.
Zwischen der Ansteckung und Entwicklung von Symptomen vergehen bei Sars in der Regel sechs bis sieben Tage. In dieser Zeit nisten sich die Viren tief in der Lunge ein, werden aber kaum herausgehustet. Erst mit den Symptomen beginnt dann die Ansteckungsgefahr. Beim neuen Coronavirus sitzen die Viren weiter oben im Rachen und können einfacher übertragen werden.
Die Sars-Epidemie dauerte von März bis Juni 2003 – nur wenige Monate lang. Weil Ansteckungen besser erkannt und isoliert werden konnten als Corona-Fälle heute, liess sich die Übertragungskette des Virus besser unterbinden. Besonders an Sars war die hohe Variation der Ansteckungsraten. Viele Infizierte steckten niemanden an – ein paar wenige Infizierte dagegen steckten sehr viele weitere Menschen an. Forscher sprechen von sogenannten Super-Spreading-Ereignissen. Im Einzelfall sind solche Ereignisse für die Betroffenen und deren Umgebung sehr unglücklich. Doch die Bekämpfung der Epidemie wird damit insgesamt vereinfacht: Lassen sich Super-Spreading-Ereignisse verhindern, ist die weitere Ausbreitung bereits viel unwahrscheinlicher.
| G24 | SARS: EIN KURZER SPUKWöchentliche Anzahl neuer Sars-Fälle, weltweit |

Die frühen Fälle in China zwischen November 2002 und März 2003 fehlen in dieser Grafik. QUELLE: Weltgesundheitsorganisation
| G25 | A/H1N1: EINE UNGEWÖHNLICHE GRIPPEWELLEWöchentliche Anzahl positiver Grippetests, in den USA |

QUELLE: Centers for Disease Control and Prevention
| G26 | EBOLA: NACH ZWEI JAHREN WAR DAS SCHLIMMSTE VORBEIMonatliche Anzahl neuer Ebola-Fälle in Westafrika |

QUELLE: Centers for Disease Control and Prevention
Kurz: Sars endete, weil sich der Erreger bereits nach relativ kurzer Zeit verriet. Die Epidemie liess sich deshalb mit klassischen Kontrollmassnahmen effizient bekämpfen. Nach 2003 ist die Krankheit nur noch in Einzelfällen aufgetaucht.
H1N1-Grippe
Am 17. April 2009 berichteten die US-Gesundheitsbehörden, dass sich zwei Kinder in Südkalifornien mit einem Grippevirus des Typs A/H1N1 (G25) infiziert hatten: mit Influenzaviren eines neuartigen genetischen Strangs. Beinahe zeitgleich wurden in Mexiko identische Erkrankungen gemeldet. Rasch wurde offensichtlich: Das Virus hatte sich geografisch bereits ausgebreitet. Wegen der genetischen Verwandtschaft zu Grippeviren, die bei Schweinen vorkommen, sprach man bei H1N1 zuerst von einer «Schweinegrippe». Zu Unrecht, wie sich später herausstellte: Der H1N1-Ausbruch war durch ein Virus verursacht worden, das allein unter Menschen zirkulierte. Zwei Monate später, am 11. Juni, rief die WHO eine Pandemie aus.
—Betroffene: 30 000 Menschen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Influenzavirus A(H1N1)pdm09 angesteckt. Millionen weitere sollten folgen. In etwas mehr als einem Jahr wurden 18 500 Todesfälle gezählt, die durch Laborproben bestätigt wurden.
—Verbreitung: Das neue Grippevirus war ungefähr ähnlich ansteckend wie eine gewöhnliche Grippe.
—Sterblichkeit: Sie war im Vergleich zur bisherigen, saisonalen Grippe eher tiefer. Allerdings konnten auch gesunde, junge Erwachsene am neuen Influenzavirus schwer erkranken.
Die Grippe breitete sich in den USA in zwei Wellen aus, bevor sie Anfang 2010 abebbte. Zu Beginn des Jahres 2011 trat H1N1 erneut in Erscheinung, aber um einiges schwächer. Als das Virus entdeckt wurde, war die Angst zuerst gross. Ein H1N1-Subtyp hatte 1918/19 eine der schlimmsten Pandemien der Geschichte verursacht: die Spanische Grippe. An ihr waren 25 bis 50 Millionen Menschen gestorben. Doch die Todesrate von A/H1N1 war schliesslich relativ niedrig: Sie lag deutlich unter 0,1 Prozent, also niedriger als die bisherige Schätzung für das Coronavirus. Besonders die über 65-Jährigen erwiesen sich als resistent – vermutlich, weil sie vor Jahrzehnten bereits eine Immunität gegen ähnliche Virenstämme aufgebaut hatten oder gegen einen ähnlichen Stamm geimpft worden waren.
Mit Impfungen gegen den neuen Grippetypus konnte man in den USA bereits im Oktober starten – ein halbes Jahr nach Entdeckung der Viren und drei Monate vor dem typischen Höhepunkt der Grippesaison im Februar. Im August 2010 verkündete die WHO dann das Ende der Pandemie. Medizin und menschliches Immunsystem hatten dem neuen Virus widerstanden.
Das A/H1N1-Grippevirus ist deswegen nicht ausgerottet. Noch heute wird es in 41 Prozent aller Influenza-positiven Proben in der Schweiz nachgewiesen. Es zirkuliert also zusammen mit anderen Grippeviren weiterhin unter den Menschen. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit führen Komplikationen bei der saisonalen Grippe in der Schweiz jährlich zu mehreren Hundert Todesfällen.
Ebola
Am 26. Dezember 2013 erkrankte ein zweijähriger Knabe in Meliandou, einem Dorf im Urwald von Guinea, an einer mysteriösen Krankheit. Er musste erbrechen, hatte Fieber und schwarzen Stuhl. Zwei Tage später starb er. Erst drei Monate später war klar, woran der Knabe gestorben war: an Ebola (G26), einer Krankheit, die in Westafrika bisher nicht aufgetreten war. Das Virus, das sie verursacht, war zu diesem Zeitpunkt bereits in die Hauptstadt Conakry gelangt und breitete sich in den Nachbarländern Liberia und Sierra Leone aus. Im Juli 2014 hatte es die dortigen Hauptstädte erreicht.
—Verbreitung: An sich ist Ebola nicht sehr ansteckend, denn es braucht den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Infizierten. In vielen Regionen und Provinzen lag die Reproduktionszahl zwischen 1 und 2. Dieser Wert bewegt sich im Bereich einer saisonalen Grippe, aber unterhalb des neuen Coronavirus.
—Betroffene: Von knapp 30 000 infizierten Personen starben in Westafrika über 11 000.
—Sterblichkeit: Das ergibt für den Ausbruch von 2014 bis 2016 eine Sterblichkeit von mehr als einem Drittel. Bei anderen Ausbrüchen war die Sterberate sogar noch höher. Wer das Virus erwischte, schwebte also in Lebensgefahr.
| G27 | COVID-19: DIE PANDEMIE IST NOCH NICHT VORBEIWöchentliche Anzahl neuer Fälle weltweit |

QUELLE: Johns Hopkins University
| G28 | COVID-19: EINE HEFTIGE ZWEITE WELLEWöchentliche Anzahl neuer Fälle in der Schweiz |

QUELLE: Johns Hopkins University
Dass sich Ebola in Westafrika verbreiten konnte, lag primär an der schlechten Versorgung. Statt im Spital wurden Kranke von Angehörigen zu Hause umsorgt oder siechten in Slums vor sich hin. Der Wissensstand über die Krankheit war unzureichend. Zum Höhepunkt der Epidemie steckten sich 7000 Menschen pro Monat an, wie aus Daten der WHO hervorgeht.
Ein Impfstoff gegen Ebola ist seit 2019 in der EU und in den USA zugelassen. In Westafrika wurde er ab April 2015 bereits in grösserem Stil getestet. Dass die damalige Epidemie eingedämmt werden konnte, lag aber nicht an den Impfungen. Sondern in erster Linie an allgemeinen Massnahmen der Gesundheitsversorgung: Man hat Helfer ausgebildet, Behandlungszentren aufgebaut, die Bevölkerung informiert. Organisationen wie Médecins sans frontières behandelten während des Ebola-Ausbruchs Tausende von Patienten. Ausserdem wurden teils rigorose Quarantänemassnahmen verhängt: Es gab Ausgangssperren, ganze Gebiete wurden abgeriegelt. Nach und nach ging die Zahl der Neuansteckungen auf diese Weise zurück.
Die westafrikanische Ebola-Epidemie von 2013 bis 2016 wurde also nicht mit einer medizinischen Wunderwaffe, sondern mit organisatorischen Mitteln besiegt. Das funktionierte, weil Infizierte das Ebola-Virus während der Inkubationszeit (im Schnitt 11 Tage) typischerweise nicht weitergeben. Impfungen dürften hingegen in Zukunft nützlich sein. Noch ist Ebola nicht ausgerottet: 2017 und 2018 kam es in der Demokratischen Republik Kongo mehrmals zu Ausbrüchen. Der jüngste Fall betraf die Provinz Nord-Kivu: Erst seit ungefähr zwei Wochen werden dort keine Neuinfektionen mehr registriert.
Neues Coronavirus
Vermutlich litt der erste Patient bereits am 1. Dezember an Covid-19 (G27), der Lungenkrankheit, die vom neuartigen Coronavirus ausgelöst wird. Berichten zufolge, handelt es sich um einen älteren Mann, der in der Nähe des Engros-Fischmarkts in der chinesischen Millionenstadt Wuhan zu Hause war. Völlig gesichert scheint diese Information jedoch nicht. Jedenfalls meldeten die chinesischen Behörden erst Ende Jahr ein grösseres Problem. Am 5. Januar 2020 orientierte erstmals die WHO über das gehäufte Auftreten von Lungenentzündungen ungeklärten Ursprungs in Wuhan. Das Virus Sars-CoV-2, das diese Atemwegserkrankung verursacht, hat die Medien, aber auch den Alltag vieler Menschen seither fest im Griff.
—Betroffene: Weltweit haben sich per Ende Februar 2020 bereits über 100 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, wobei von einer grösseren Dunkelziffer auszugehen ist. Gegen 3 Millionen Todesfälle stehen damit im Zusammenhang.
—Verbreitung: Mit einer Reproduktionszahl von 2 bis 3 ist das Coronavirus deutlich ansteckender als die saisonale Grippe, aber nicht extrem ansteckend wie etwa die Masern.
—Sterblichkeit: Die Sterberate wird je nach Studie unterschiedlich eingeschätzt. Gemäss einem Konsens liegt sie bei rund 1 Prozent. Je nachdem, welches Land betroffen ist, kann sie auch höher oder tiefer zu liegen kommen.
In der Volksrepublik China, wo die Epidemie ihren Anfang nahm, wurde das Virus innerhalb von Monaten zurückgedrängt. Die Reduktion ist das Ergebnis drakonischer Massnahmen. Einkaufszentren, Autobahnen und U-Bahnen wurden in vielen Städten abgeriegelt. Viele andere Länder waren weniger konsequent. Etwa die Schweiz: Nach der ersten Welle im Frühjahr 2020 folgte im Herbst und Winter eine zweite, noch grössere Welle von Ansteckungen (G28). Vielerorts lief es ähnlich. So haben sich die Fälle weltweit zu einer einzigen, grossen Welle addiert, die Ende 2020 ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte.
Tückisch am Coronavirus ist, dass eine Ansteckung unbemerkt bleiben kann. Das schwächt die Bereitschaft, sich sozial zu distanzieren, und hilft der Verbreitung des Virus. Das passende Vergleichsszenario zur Corona-Pandemie ist deshalb nicht Sars, sondern die H1N1-Influenza. Die Erfahrung zeigt, dass sich in Europa nur rund die Hälfte der Bevölkerung gegen die Grippe impfen lässt. Manche Eltern wollen ihre Kinder selbst gegen die hoch ansteckenden Masern nicht impfen. Offen ist auch, ob es zwingende Gründe gibt, damit eine Gesundheitsbehörde eine Impfung für obligatorisch erklären kann – vermutlich nicht. Impfungen gegen Covid-19 können den Krankheitsverlauf deutlich abmildern. Sie verringern das Übertragungsrisiko, löschen es aber nicht völlig aus.
So könnte sich Sars-CoV-2 über kurz oder lang in der Population einnisten. Auch in Zukunft könnten Menschen vom Virus heimgesucht werden. In den meisten Fällen gäbe es normale bis schwere Erkältungen – ähnlich, wie das bei anderen Erregern aus der Familie der Coronaviren bereits der Fall ist. Sie zirkulieren meistens unter Kindern, deren Immunsystem noch nicht damit in Kontakt gekommen ist. Ein solches Szenario bedeutet nicht, dass man das Coronavirus verharmlosen sollte. Doch irgendwann dürfte es zur Normalität gehören. Immun- und Gesundheitssystem werden einen Umgang damit finden, ähnlich wie bei der Grippe.
Charles Darwin lebte im 19. Jahrhundert. Der britische Evolutionsbiologe hätte die Corona-Pandemie sicherlich mit Interesse verfolgt. Und daraus geschlossen: Die besten Überlebenschancen haben nicht die Viren, die ihren Wirt am schnellsten umbringen. Sondern jene, die mit ihm am besten koexistieren können. Wie etwa die Grippe oder das Coronavirus.
DIE DATEN
Sars: Die Daten wurden aus den Updates der WHO ausgelesen. Diese stehen ab dem 17.03.2003 zur Verfügung, enthalten jedoch nicht die Sars-Fälle, die zuvor bereits in China aufgetreten waren.
H1N1: Die Daten stammen vom Flu Dash-board der US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Ebola: Die Daten stammen von der Website der CDC. Ursprüngliche Datenquelle sind die Situation Reports der WHO ab dem 25.03.2014.
Coronavirus: Die Daten stammen von der Johns Hopkins University. Diese unterhält ein Dashboard mit globalen Statistiken zum Virus. Die Daten sind auf Github abgelegt. Sie beginnen am 22.01.2020.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.