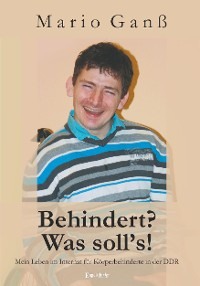Kitabı oku: «Behindert? - Was soll’s!», sayfa 2
Im Dachgeschoss richtete man einige Zimmer für das Personal her, welches von weiter entfernt kam und nicht jeden Tag zur Arbeit fahren konnte. Hier oben hatten ebenfalls die Lehrer ihr Zimmer. Desweiteren existierten auf dem Boden noch kleine Kammern, die zur Aufbewahrung von Dingen jeglicher Art dienten.
Im Innenbereich des Heims II sah man kaum Rollstühle, das war den Kindern aber egal, da sie sich auch ohne gut fortbewegen konnten. Wir bewegten uns so vorwärts, wie wir es von zu Hause her gewohnt waren, meistens krabbelnd. Sollten die Hände nach dem Waschen einmal sauber bleiben, dann wurden wir von den Erziehern oder Pflegern an den Tisch gesetzt oder ins Bett getragen.
Für unser körperliches Wohlbefinden kümmerte sich das pflegerische Personal. Es sorgte unter anderem für hygienische und medizinische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Medikamentengabe. Neben den Lehrern waren auch Erzieher tätig, die uns hauptsächlich am Nachmittag betreuten und mit uns beispielsweise Hausaufgaben machten. Aber die Erzieher brachten uns abends auch ins Bett und unsere Pflegekräfte schauten uns bei den Hausaufgaben schon mal über die Schulter. Es war ein harmonisches Zusammenspiel der Mitarbeiter, ein Hand in Hand aller Angestellten. Durch diese enge Zusammenarbeit entstand eine Atmosphäre, die einer Großfamilie glich. Egal ob Lehrer, Erzieher oder Pfleger, der eine war einfach für den anderen da, wenn auch vornehmlich für seinen zuständigen Bereich. Niemand hielt sich für etwas Besseres! Jeder der Beschäftigten brachte uns Kindern seine ganz eigene Fürsorge, ja teilweise Liebe entgegen. Wir fühlten uns geborgen! Und gerade dieses persönliche Engagement der Mitarbeiter machte unter anderem das Einmalige dieser Einrichtung aus.
Schnell lebte ich mich in Oehrenfeld ein. Das Leben und das Spielen in der Vorschule mit den anderen Kindern machten mir richtig viel Spaß. Ich lachte viel und gern.
Seitdem ich in Oehrenfeld war, hatte ich ein Problem. Ich konnte immer noch nicht ohne Unterstützung allein auf einem Stuhl sitzen. Eines Tages kam Fräulein Kleinert auf die Idee, einmal auf dem Dachboden zu sehen, ob sich dort nicht noch eine alte Sitzgelegenheit auftreiben ließ. Und tatsächlich wurde sie fündig. Es war ein ganz kleines niedriges Stühlchen aus Holz. Schnell befreite sie es vom Schmutz. Zu meiner Freude hatte der Stuhl sogar seitliche Lehnen. Der schien gerade auf mich gewartet zu haben! Als der Stuhl sauber war, wurde ich gleich hineingesetzt. Jeder war gespannt, wie ich mit ihm zurechtkam.
Ein erster Erfolg zeigte sich dann gleich. Ich schrie schon mal nicht mehr. Doch noch immer muss ich Angst gehabt haben. Ich machte mich so steif, dass ich die Beine hochnahm und so nach vorne vom Stuhl rutschte. Es half nur noch eine Methode. Man holte eine Binde und wickelte sie um mich und die Rückenlehne des Stuhles. So konnte ich wenigstens halbwegs – »gefesselt« – allein auf einem Stuhl sitzen. Eine Lösung auf Dauer war dies natürlich nicht. Da half nur eins: Physiotherapie!
Um unsere körperlichen Fähigkeiten zu testen und zu fördern, hatten wir von Anfang an Physiotherapie. (Dies wurde bei uns früher als »Heilgymnastik« bezeichnet. Später sagte man aber »Physiotherapie«, da das Wort »Heil…« nicht mehr genannt werden sollte, weil es an vergangene Zeiten erinnerte.)
Fast alle Kinder gingen überhaupt nicht gern dorthin. Dies hatte einen triftigen Grund: die Physiotherapeutin Frau Ziegenbarth, eine schon ältere Frau. Sie erschien in kräftiger und hochgewachsener Gestalt mit grau meliertem Pagenschnitt. Die Frau trat sehr resolut auf. Schon allein dies flößte uns gehörigen Respekt ein. Sie hatte außerdem Methoden, einem etwas beizubringen, die aus damaliger Sicht haarsträubend, ja fast unmenschlich waren. Diese sollte jeder von uns mehr oder weniger stark zu spüren bekommen.
Wie schon erwähnt, konnte ich kaum auf einem normalen Stuhl sitzen, geschweige dann auf einer Turnbank. Doch dies sollte ich nun erlernen:
Frau Ziegenbarth setzte mich auf eine solche Bank. Ich machte mich sofort steif und rutschte gleich wieder hinunter. Unsere Therapeutin setzte mich ein weiteres Mal auf diese Bank und schwups lag ich erneut unten. Das Spielchen ging ewig. Frau Ziegenbarth schien unendliche Ausdauer zu haben, ich aber auch! Letztendlich schmiss ich mich schon aus Gnatz auf den Boden. Ich schrie, kratzte und biss sogar. Sie packte mich immer wieder an den Sachen und stauchte mich regelrecht auf die Bank. Ich weinte bitterlich und rief nach meinen Eltern. Doch die waren ja nun einmal nicht da. Ich dachte: »Das scheint die auszunutzen.«
Mit der Zeit merkte ich langsam, dass ich mit Gnatz und einem Böckchen bei Frau Ziegenbarth nicht durchkam. Dies schien ihr Herz nicht zu erweichen. Ich zeigte einen guten Willen. Und siehe da, sie wurde auf einmal ganz zugänglich. Nun übte sie mit mir ganz ruhig und verständnisvoll das Sitzen auf der Turnbank. Bald konnte ich es. Von da an klappte auch das Sitzen auf meinem Stühlchen alleine und ohne fesselnde Binde.
Frau Ziegenbarth hatte allgemein sehr eigene Methoden, uns Kindern etwas beizubringen. So zum Beispiel bei denjenigen, die durch eine Halbseitenlähmung ihren einen Arm beziehungsweise ihre Hand nicht richtig bewegen konnten. Sobald sie merkte, dass dieses Kind keinen Willen zeigte, seinen »kranken« Arm zu benutzen, band sie den »gesunden« auf den Rücken. So wurde das Kind kurzerhand gezwungen, seine gelähmte Hand beziehungsweise seinen Arm zu benutzen.
Viele Eltern beschwerten sich bei Herrn Mertens und Herrn Friedrich über die Behandlungsmethoden von Frau Ziegenbarth. Erfolg hatten sie kaum. So gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Eltern nahmen ihre Kinder aus der Physiotherapie oder sie duldeten die ungewöhnlichen Lernmethoden. Meine entschieden sich für Letzteres, wofür ich ihnen heute sehr dankbar bin!
Einsicht kommt meistens spät. So verhält es sich auch bei mir. Aber wie soll man als kleines Kind wissen, dass es so eine Frau im Grunde nur gut mit einem meint? Man denkt in diesem Augenblick nur: »Die Frau tut mir weh. Die ist böse.« Was Frau Ziegenbarth mit ihren durchaus umstrittenen Methoden bezwecken wollte, das begreift man erst hinterher.
Vorbereitung auf die Schule
Die ersten Wochen und Monate in der Vorschule vergingen sehr schnell. Die vier Wochen Probezeit hatte ich ohne besondere Vorkommnisse hinter mir und lebte mich schnell in die Gruppe ein. Man wollte mich vorerst in Oehrenfeld behalten und mich zu gegebener Zeit noch einmal auf meine Schultauglichkeit testen.
Doch für ein Mädchen aus unserer Vorschulgruppe war die Probezeit nach vier Wochen vorbei. Schnell merkte man, dass sie uns anderen Kindern geistig weit unterlegen war. Sie störte die Beschäftigungen und besonders die Nachtruhe. Sie lief nachts umher und machte sich in der Regel in der Küche zu schaffen. Dann aß sie aus dem Futtereimer, in dem eigentlich die Speisereste für die Schweine gesammelt wurden. Das Verhalten des Mädchens war einfach zu auffällig und so wurden ihre Eltern gebeten, ihr Kind wieder mit nach Hause zu nehmen.
Da viele Kinder von weit entfernt nach Oehrenfeld kamen, lohnte es sich kaum, dass unsere Eltern uns jedes Wochenende nach Hause holten. Abgesehen von den langen Fahrzeiten wäre dies für uns Kinder eine viel zu ungeheuerliche Achterbahn der Gefühle geworden. Frühestens am Freitagmittag hätten unsere Eltern anreisen können. Die Freude darauf wäre bei uns Kindern natürlich unendlich groß gewesen. Doch die effektive Zeit, die wir dann in unserem Elternhaus verbringen würden, wäre nicht wirklich lang gewesen. Schon spätestens Sonntag nach dem Mittagessen hieße es dann wieder: »Ab nach Oehrenfeld«. Traurigkeit machte sich so den ganzen Sonntag breit.
Um uns diese Gefühlsschwankungen zu ersparen, zeigte die Erfahrung, dass es für uns Kinder, aber auch für die Eltern besser war, uns nur zu den Ferien abzuholen. Waren die Zeiten zwischen den Ferien etwas zu lang (unter anderem zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien) richtete man einen Besuchssonntag ein.
Solche Sonntage hasste ich eigentlich. Zwar freute ich mich, dass ich meine Eltern einmal wieder sah. Doch wusste ich, dass sie nach wenigen Stunden abermals ohne mich nach Hause fahren würden. Meistens war an diesen doch ersehnten Sonntagen auch noch Elternversammlung. So blieb im Grunde noch weniger gemeinsame Zeit für uns mit unseren Eltern.
Am ersten Besuchssonntag, den ich in Oehrenfeld erlebte, fand ein Gespräch zwischen Herrn Dr. Friedrich und meinen Eltern statt. Herr Dr. Friedrich hatte sehr viele Erfahrungen aus seinem jahrelangen Umgang mit körperlich behinderten Kindern. Er konnte zum ersten Mal meinen Eltern klipp und klar sagen, was es mit meiner Behinderung auf sich hat. Meine Eltern erfuhren, dass ich geistig vollkommen entwickelt bin. Nur das Gehirn konnte auf Grund des Sauerstoffmangels bei der Geburt meinen Körper nicht richtig steuern. Deshalb habe ich diese krampfartigen Bewegungen. Etwas scherzhaft meinte Herr Dr. Friedrich: »Mit dieser Behinderung kann ihr Sohn hundert Jahre alt werden.«
In den Monaten vor der Einschulung wurden ich und die anderen Kinder intensiv auf die Schule vorbereitet. Wir waren sechs Kinder in der Vorschulgruppe. Durch diese überschaubare Anzahl konnte mit jedem von uns intensiv geübt werden.
Da es in Oehrenfeld eine allgemein übliche zehnklassige polytechnische Oberschule gab, orientierten sich auch die Beschäftigungen in der Vorschule an dem Bildungs- und Erziehungsplan des damaligen Bildungswesens.
In zahlreichen und durchaus lustigen Beschäftigungen brachten uns Fräulein Kleinert und Fräulein Fischer bei, mit Mengen zu rechnen und zu zeichnen. Beim Zeichnen übte man mit uns unter anderem schräge und gerade Striche sowie verschiedene Bögen. Die Kinder aus meiner Vorschulgruppe meisterten diese Übungen relativ leicht, konnten sie doch zumindest eine ihrer Hand richtig bewegen. Bei Detlef, der ebenfalls wie ich Spastiker war und Koordinierungsschwierigkeiten der Hände hatte, konnte man immerhin mit ein wenig Geduld erkennen, was er zeichnete. Hingegen war bei mir auch nicht mit größter Fantasie zu erahnen, was ich da unter gewaltigen Anstrengungen zu Papier brachte. Nur durch Führen meiner Hand war ein einigermaßen akzeptables Ergebnis erkennbar.
Zum Rechnen nahmen wir kleine farbige Holzstäbchen, aber auch andere geometrische Figuren zu Hilfe. Während ich das Rechnen problemlos im Kopf bewältigte, bereitete es mir große Mühe, die Stäbchen und Figuren auf dem Tisch geordnet hinzulegen. Immer wieder stieß ich sie durch meine unkontrollierten Bewegungen der Hände durcheinander. Auch hier gelang es mir nur mit Hilfe der Erzieherinnen (sie führten meine Hände), die Stäbchen und Figuren einigermaßen richtig abzulegen.
Natürlich stand auch Basteln auf unserem Programm. In den meisten Fällen war hier der Umgang mit einer Schere erforderlich. Während die anderen Kinder bei dieser nicht ganz ungefährlichen Tätigkeit unter strenger Kontrolle der Erzieherinnen standen, gab man mir verständlicherweise erst gar keine Schere in die Hand. Zu groß wäre für mich und die Anderen die Verletzungsgefahr gewesen.
In weiteren Beschäftigungen lernten wir Lieder und Gedichte, was mir besonders leicht fiel und mir immer Freude bereitete. Als mich meine Eltern Ostern wieder einmal nach Hause holten, sagte ich ihnen spontan ein für diesen Anlass gelerntes Gedicht auf, worüber sie sich sehr freuten.
Das Radio war zu diesem Zeitpunkt so ziemlich die einzige Verbindung zur Medienwelt. Es gab zwar in unserem Haus einen Fernsehapparat (damals in schwarz/weiß), doch dieser stand in der ersten Etage und wir Kinder vermissten ihn im Grunde auch überhaupt nicht.
Neben der Unterhaltung wurde das Radio natürlich für einige Beschäftigungen genutzt. Da gab es eine Sendung, die speziell für Vorschulkinder gemacht wurde, das »Butzemannhaus«. Dies kam in der Woche immer morgens von 8.40 bis 9.00 Uhr im »Radio der DDR«. An jedem Tag der Woche stand die Sendung unter einem anderen Thema. So wurden meines Wissens nach Geschichten erzählt, zum Beispiel»Vom kleinen Pfennig«.1 An einem anderen Tag sangen Kinder bekannte Lieder, bei denen wir mit einstimmen konnten. Mit der Zeit wussten wir schon immer, was an welchem Tag kam. Das »Butzemannhaus« stellte einen festen Bestandteil unserer Beschäftigungen dar, sofern keine besonderen Aktivitäten wie Spaziergänge geplant waren. Dementsprechend freuten wir uns mehr oder weniger auf die Sendungen, je nach dem, welches Thema an den Tagen dran war. Doch einen besonderen Tag werde ich nicht vergessen:
Es war wieder einmal ein Mittwoch, die Zeit um den 30. November, meinem Geburtstag. Draußen begann es in der düsteren Zeit gerade Tag zu werden. Fräulein Kleinert setzte uns vor das Radio – es war noch ein alter großer aus Holz gefertigter Röhrenapparat – um das »Butzemannhaus« zu hören. Für uns Kinder verlief alles wie gewohnt. Wir quasselten noch miteinander, während die Sendung schon anfing. Wir wussten, dass mittwochs immer die »Glückwunschtante« mit ihrem Teddy »Brummelchen« Glückwünsche für Kinder über den Sender schickte. Dies fanden wir eher langweilig. Kannten wir die Kinder ja sowieso nicht, die da genannt wurden.
Doch an diesem Tag mahnte uns Fräulein Kleinert ungewöhnlich oft zur Ruhe. Warum nur? Hatte sie sich etwas ausgedacht, von dem wir noch nichts ahnten?
Ja und so war es tatsächlich. Immer wenn die »Glückwunschtante« die Namen der Kinder aufzählte, die Geburtstag hatten, sollten wir ganz still sein und Fräulein Kleinert drehte das Radio ein wenig lauter. Und ganz plötzlich, total unerwartet erklang aus dem Lautsprecher mein Name, »Mario Ganß«. Schlagartig war es natürlich dann mit der Ruhe vorbei! Ich hüpfte vor lauter Aufregung fast aus meinem Stühlchen. Die anderen Kinder riefen in heller Begeisterung wild durcheinander: »Mario, du warst im Radio!« Man kann sich vorstellen, dass es anschließend fast unmöglich war, die Sendung noch zu Ende zu hören. Aber das nahm Fräulein Kleinert spielend in Kauf, denn ihr war ja die Überraschung absolut gelungen!
Hinterher erzählte mir Fräulein Kleinert, dass meine Oma die ganze Sache ausgeheckt hatte. Sie rief beim Sender an und bestellte die Glückwünsche zu meinem Geburtstag.
Richtig viel Spaß machten uns die Turnstunden mit Fräulein Fischer und Fräulein Kleinert. Hier konnten wir, im Gegensatz zur Physiotherapie, einmal nach Herzenslust so richtig herumtoben. Keiner achtete dabei so streng darauf, dass wir uns nicht so bewegten, wie wir es eigentlich bei Frau Ziegenbarth immer tun mussten.
Nach den lehrreichen Beschäftigungen blieb natürlich viel Zeit zum Spielen. Dafür eignete sich unser Gruppenraum bestens, da er sehr groß war. Der riesige Traktorreifen hatte es uns allen besonders angetan. Mit ihm spielten wir alle am liebsten. Konnte man sich doch in seinem Inneren so schön verstecken und sich mit ihm durch die Gegend rollen lassen.
Wenn der gegenüberliegende Gymnastikraum nicht gerade für die Physiotherapie oder den Sportunterricht genutzt wurde, durften wir auch in diesem spielen, meistens am Nachmittag oder am Wochenende. Dann waren auch die anderen Kinder aus der ersten und zweiten Klasse dabei. Oft spielten wir »Feuer, Wasser, Sturm«. Dieses Spiel mochten wir fast alle sehr gerne, denn es eignete sich gut zum Austoben. Dabei ging es darum, Kommandos einer Erzieherin so schnell wie möglich zu folgen. Sagte sie »Feuer«, dann rannten beziehungsweise krabbelten alle Kinder durch den Raum. Bei »Wasser« suchte sich jeder etwas, worauf man klettern konnte, die Sprossenleiter zum Beispiel, aber eine Matte tat es auch. »Sturm« war das Zeichen, sich flach auf den Boden zu legen. Derjenige, der bei diesen Anweisungen jeweils der Letzte war, schied aus.
Die Spaziergänge an der frischen Luft standen bei uns Knirpsen ganz oben auf unserer Wunschliste.
Für diese Ausfahrten standen uns solche Rollstühle zur Verfügung, wie ich einen davon zu Hause hatte. Obwohl sich der Rollstuhl für meine Eltern eher als unhandlich erwies, war dieser für Spazierfahrten mit mehreren Kindern durchaus praktisch. Wegen der langen Sitzfläche hatten in ihm gleich zwei Kinder Platz. Einige Kinder aus der Vorschule waren recht gut zu Fuß. Dennoch erwies es sich als günstiger für sie bei längeren Spaziergängen eine Sitz- und Fahrgelegenheit zu haben. So bot unter gegebenen Umständen der lange Fußkasten des Rollstuhles Platz für ein drittes Kind. Auf diese Weise bekamen unsere beiden Erzieherinnen uns sechs Kinder auf einmal unter. Wegen den größeren starren Rädern vorn am Rollstuhl war dieser auch ganz gut für die in dieser Gegend verbreiteten unebenen Wege geeignet.
Die nähere Umgebung bot sich für schöne Spaziergänge regelrecht an. Nicht weit von unserem Haus entfernt begann ein großer Wald. Unweit von diesem schloss sich ein kleiner Teich mit einer hübschen Wiese an. Hier ließ es sich hervorragend spielen und herumtoben. Wenn der Boden nicht zu nass war, setzten uns die Erzieherinnen auf die Wiese und wir konnten herumkrabbeln. Manchmal nahmen wir Decken und etwas zu essen mit. Das Picknick am Teich war dann immer etwas Besonderes.
Einen erfrischenden Spaziergang durch den Wald empfand ich oft als ziemlich schaurig. Es gab Stellen, an denen der Baumwuchs der Fichten sehr dicht war. Düsterheit und somit eine gewisse gruselige Stimmung machten sich breit. Oft kamen wir an Kreuzungen vorbei, deren Wege noch tiefer in den Wald hineingingen. Insgeheim wäre ich diese Wege gern einmal entlang gegangen, um zu erfahren, wo sie hinführten.
Selbst der Winter hinderte uns nicht daran, die kalte, aber klare Luft zu genießen. Dann größtenteils auf zwei Kufen. Zwar bedeutete dies für unsere Erzieherinnen immer zusätzliche Arbeit. Mussten wir doch zunächst einmal warm angezogen werden. Dann wurden die Schlitten herausgeholt. Einen nicht unerheblichen Nachteil bei diesen Aktionen gab es: kurioserweise die vom Schnee geräumten Wege. Die Kinder, die einigermaßen gut zu Fuß waren, konnten ja die betreffenden geräumten Stellen selbst gehen. Doch mich, der noch nicht einmal alleine stehen konnte, musste man mit dem Schlitten über den so manchmal blanken Weg ziehen. Da auch andere Kinder, gerade bei Schnee, schlecht laufen konnten, wurden auch schon einmal zwei Kinder auf einen Schlitten gesetzt. Dies bedeutete oft für die Erzieherinnen eine ganz gewaltige Plackerei, zwei Kinder gleichzeitig über stellenweise blanke Steine zu ziehen. Doch niemand von ihnen tat dies widerwillig, da sie ebenfalls durchaus Spaß an der Sache hatten!
An Bergen für ein flottes Rodeln mangelte es bei uns keinesfalls. Unter anderem schlängelte sich ein geeigneter langer Berg gleich hinter unserem Haus entlang. Bei solchen Schlittenfahrten gingen Frau Fischer und Fräulein Kleinert entweder nur mit einigen Kindern oder es kamen noch ein oder zwei von den Pflegern hinzu. Ein weiterer leerer Schlitten wurde mitgenommen. Der Grund war einfach. Es passten zwar immer zwei Kinder auf einen Schlitten, doch beim Herunterrodeln der Berge musste immer ein Erwachsener mitfahren. Während dieser Zeit setzte man das zweite Kind auf den leeren Schlitten. Man konnte uns ja nicht einfach in den Schnee setzen und warten lassen, bis die anderen gerodelt waren.
Aber auch ohne Spaziergänge hielten wir uns viel in unserem Garten hinter dem Haus auf. Neben Zierrasen mit Blumenrabatten, die wir nicht betreten durften, lud uns eine große Wiese zum Spielen und Herumtoben ein. Von dieser extra abgetrennt gab es Spielgeräte wie ein Karussell und eine Schaukel. Bänke fand man hier natürlich auch. Wer nicht allein laufen konnte, wurde in den Garten getragen und auf eine Bank oder gleich auf die Wiese gesetzt.
Ich kann mich kaum erinnern, dass wir Rollstühle benutzten, wenn wir in den Garten gingen. Wenige Ausnahmen gab es, und zwar für die Kinder, die entweder zu schwer waren oder sich gerade etwas gebrochen hatten. Dies kam gar nicht so selten vor, denn einige Kinder hatten die sogenannte »Glasknochenkrankheit«.
Etwas, dem wohl alle Kinder während eines Schuljahres entgegenfiebern, sind die großen und kleineren Ferien. Da machten wir Vorschulkinder keine Ausnahme. Wir hatten immer mit den Schulkindern zeitgleich Ferien. Den Tag der Abreise konnten wir verständlicherweise kaum erwarten. War so endlich erneut die Zeit gekommen, seine Eltern nach etwa vier bis sechs Wochen in die Arme schließen zu können. Die Koffer waren meistens schon gepackt und so hieß es, so schnell wie möglich ins Auto und ab nach Hause. Unterhielten sich meine Eltern dann noch mit den Erzieherinnen, so drängelte ich vehement. Die Freude, nach so langer Zeit in seine gewohnte Heimat zu kommen und seine lieben Verwandten wiederzusehen, war einfach riesig!
Aber so groß die Freude war, einmal nach Hause zu fahren, bedeutete dies auch ebenso jedes Mal Schmerz, wieder nach Oehrenfeld fahren zu müssen. Diese Tage hasste ich sehr! Schon ab Halberstadt fing ich an zu schluchzen. Dies steigerte sich bis Oehrenfeld in ein tränenreiches und lautes Weinen. Man wird es wohl schon vom Weiten gehört und sich gedacht haben: »Jetzt ist wieder Mario Ganß im Anmarsch.« Meine Eltern fackelten beim Abschied auch nicht lange. Sie übergaben mich dem Personal und verschwanden dann gleich. Auch wenn diese Art und Weise vielleicht nicht gerade die schönste war, sich voneinander zu verabschieden, stellte sie sich dennoch für mich als die beste heraus. Nachdem meine Eltern gingen, weinte ich noch einen kurzen Moment. Dann sah ich meine Freunde, fing an, mit ihnen zu reden oder zu spielen und die Welt war für mich halbwegs in Ordnung.
Mit der Zeit und in den kommenden Jahren wurde dieser Trennungsschmerz zwar immer weniger, doch so richtig verschwand er nie.