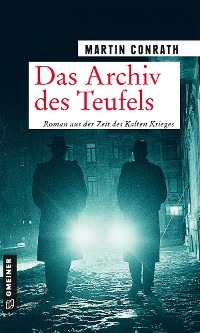Kitabı oku: «Das Archiv des Teufels», sayfa 2
Morgans Arbeitsplatz ist so ordentlich und aufgeräumt, als hätte er erst heute den Dienst angetreten. Auf der grünen Schreibunterlage liegt ein Hefter, drei Zentimeter dick. Rot prangen die Worte »TOP SECRET« auf dem Deckel.
Morgan legt seine Handflächen auf den Hefter. »Das ist Ihr Auftrag. Alles, was Sie wissen müssen, steht darin. Adenauer hat mich gebeten, den besten Mann darauf anzusetzen.«
Adenauer persönlich? Robert wusste nicht, dass Morgans Kontakte so weit nach oben reichen. Er bleibt ruhig. »Sir, bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass ich der beste Mann des CIC bin.«
»Ihre Bescheidenheit in allen Ehren, Bennett, aber für diesen Auftrag sind Sie es. Sie werden nicht mehr in die McGraw-Kaserne zurückkehren. Niemand soll wissen, dass sie noch in Deutschland sind. Ihr Name ist nun mal kein gewöhnlicher. Deswegen der ganze Zirkus, deswegen auch ein Deckname. Alles topsecret. Ihre neue Wohnung ist in Schwabing. Sie wird Ihnen gefallen. Unten wartet ein Wagen. Noch Fragen?«
Morgan hebt seine Hände vom Hefter, lehnt sich zurück. Robert nimmt die Akte an sich. Er glaubt Morgan kein Wort. Bei einem solchen Auftrag ist es unmöglich, dass seine verschobene Abreise geheim bleibt. Da hilft auch kein Deckname. Er wird mit zu vielen Menschen reden müssen, die ihn persönlich kennen. Er wird vorsichtig sein müssen, noch vorsichtiger als sonst. In seinem Job hat er sich viele Feinde gemacht, auf allen Seiten. »Nein Sir. Nicht im Moment. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.« Diese Lüge geht Robert nicht leicht über die Lippen.
Morgan steht auf, hält ihm die Hand hin. »Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden, Robert.«
Robert versteift sich, drückt kurz Morgans Hand, dann salutiert er, Morgan erwidert den Gruß, einen Moment scheint er verunsichert.
Robert verlässt Morgans Büro, geht die Treppe Stufe für Stufe hinunter. Sein Kopf fühlt sich an wie nach einem Granateinschlag, wenn die Druckwelle einen von den Füßen holt. Oder wie nach einem schweren Besäufnis, wenn die Realität noch verzerrt ist und man keinen klaren Gedanken fassen kann. Was hätte er tun können? Ablehnen? Vielleicht wäre er mit einer Degradierung davongekommen. Da würde sogar sein Vater nicht dran rütteln können. Nach Hause würde Morgan ihn dann so schnell nicht mehr lassen. Amerika wird die Deutschen noch in hundert Jahren bewachen müssen.
Was zum Teufel hat er getan, dass Morgan ihn so straft?
Bundesrepublik Deutschland, München, 23.3.1952
Der Jeep hält am Straßenrand. Robert steigt aus, dreht sich einmal im Kreis. Kaum Kriegsschäden an den Häusern. Gaslaternen säumen die Straße. Geschäfte aller Art sind geöffnet und bieten die unterschiedlichsten Waren an: gehobene Bekleidung, Küchenzubehör, elektrische Geräte, Fernseher, Radiogeräte. Die Gegend ist wohlhabend, die Geschäfte nach der Hamsterwelle zu Beginn des Koreakrieges wieder gut gefüllt. Aus Angst vor dem Weltuntergang kauften die Deutschen, was das Zeug hielt, bunkerten Kartoffeln, Mehl, Zucker und Konserven aller Art. Selbst die Schwarzmärkte waren wie leer gefegt, nichts war mehr zu bekommen. Hier muss niemand auf dem Schwarzmarkt einkaufen und jeden Moment damit rechnen, verhaftet zu werden. Die Passanten sind bestens gekleidet. Robert wird sich in den Läden mit einer neuen Garderobe eindecken.
Es riecht nach Qualm aus Kohleöfen, ein leichter Wind weht und verhindert, dass der Rauch sich über die Stadt legt. Im vergangenen Dezember war es schlimm gewesen. Die Abgase der Autos, Zehntausender Kohleöfen und die entsprechende Wetterlage sorgten für zwei Wochen andauernde stickige Luft. Manchmal konnte man kaum zehn Meter weit sehen. Zu Hunderten starben alte Menschen, und viele Kinder wurden krank, schwerer Husten grassierte, die Ärzte waren überfordert. Doch auch das ging vorüber.
Der Fahrer überreicht ihm ein Schlüsselbund: Haustüre, Wohnung und Keller. Robert bedankt sich, grüßt, der Fahrer schwingt sich in den Jeep, fährt davon, hupt sich den Weg frei.
Robert wiegt das Bund in seiner Hand. Sicherheitsschlüssel, alle drei. Er steckt auf Anhieb den richtigen ins Schloss. Er gleitet geschmeidig hinein, lässt sich leicht drehen, die Tür schwingt geräuschlos auf und schließt sich hinter ihm von selbst. Es riecht nach Bohnerwachs. Robert fühlt sich sofort heimisch. Mutter hat immer samstags die Holzböden gewachst. Vater wollte, dass Sonora, das Hausmädchen, diese Arbeiten übernimmt, aber Mutter blieb eisern. »Samstags hat Sonora frei und dabei bleibt es. Punkt!« Damit war die Diskussion beendet, und Vater versuchte nicht, sie umzustimmen, wenn sie eine Entscheidung mit dem Wort »Punkt!« unterstrich. Robert wundert sich bis heute, warum sein Vater ihr so oft nachgegeben hat, selbst wenn er gegenteiliger Meinung war und nach seiner Überzeugung – als Oberhaupt der Familie – das Recht auf ein Veto hatte.
Robert tritt auf die erste Stufe der geschwungenen Treppe. Kein Knarren, das Holz gibt nicht nach, nichts reibt. Die Wände sind mit einer Blumentapete verkleidet. Bunte Blüten einer ihm unbekannten Art auf cremefarbenem Untergrund. Er steigt die Treppe in die dritte Etage hinauf, an den Türen hängen keine Namensschilder, an seiner ebenfalls nicht. Wozu dann ein Deckname? Robert wird ihn nicht benutzen. Das ist sinnloses Kasperltheater, nichts weiter. Müsste er in den Osten, dann bräuchte er mehr als einen Decknamen. Er bräuchte eine neue Existenz mit Papieren, Lebenslauf und einer tragfähigen Legende.
Auch diese Tür öffnet sich wie von selbst. Alles hier ist gepflegt, geschmiert und in bestem Zustand. Robert betritt seine neue Wohnung. Es ist warm, kein Geruch von verbranntem Holz oder von Briketts – Gas heizt die Zimmer, ein unglaublicher Luxus. Das Bad hat kein Außenfenster, aber eine Badewanne, darüber hängt ein Boiler für heißes Wasser, ebenfalls gasbetrieben. Die kleine blaue Zündflamme flackert vor sich hin. Morgan lässt sich nicht lumpen.
Robert stellt sich vor, wie er in der Wanne liegt, »Die Mars-Chroniken« von Ray Bradbury zu Ende liest und einen anständigen Whiskey schlürft. Will Morgan ihn einlullen? Was wartet auf ihn zwischen den Deckeln der Mappe? Es wäre an der Zeit, sich die Akten anzusehen, aber Robert macht, was er immer macht, wenn er den Standort ändert. Er inspiziert sein neues Domizil. Ihm ist es wichtig, seine Umgebung zu kennen, zu wissen, welche Wege es gibt, falls er fliehen muss. Er überprüft genau, auf welche Schwachstellen er achtgeben muss, durch die jemand eindringen könnte. Er prägt sich die Möbel seiner Wohnung genau ein, muss wissen, was er hat und wo es steht, muss sich in der Küche auskennen, damit er sich in einem Gespräch nicht verrät, wenn er behauptet, er wohne dort schon ein Jahr. Solche Fehler könnten ihn enttarnen, könnten tödlich sein. Nur den Keller wird er nicht begutachten, da er ihn nicht betreten wird.
Warum ist er eigentlich hier? Warum hat Morgan ihn ausgewählt? Warum niemand anders? Seine Wut steigert sich. »Ich sollte nicht hier sein, verdammt«, sagt er und macht mit der Inspektion weiter, so wie er es gelernt hat. Er prägt sich alles ein, Robert kann sich in kürzester Zeit Dutzende Details merken und sie Tage, ja Wochen später abrufen, als läse er sie von einem Zettel ab.
In der Wohnung stehen Möbel vom Beginn des 20. Jahrhunderts: geschwungenes, gedrechseltes Holz, dicke Polster. Gott sei Dank nicht die kalten, schmucklosen, simplen, mit Kunststoff überzogenen Dinger, die jetzt so in Mode sind. Die Küche ist mit modernen Geräten ausgerüstet: Kaffeemaschine, elektrisches Rührgerät, Toaster, Mixer. Sie grenzt an den Hinterhof, das Fenster ist nicht vergittert und in gutem Zustand. Es aufzubrechen würde Lärm machen. Im Wohnzimmer warten ein Fernsehgerät und ein Radio, hier gehen die Fenster auf die Straße hinaus, eine Feuerleiter führt auf die Straße hinunter. Ein Fehler. Denn die Leiter kann man auch heraufklettern. Aber auch dieses Fenster ist solide und nur mit brachialer Gewalt von außen zu öffnen.
Das Schlafzimmer ist so groß, dass das französische Bett klein darin wirkt. Ein Kleiderschrank aus dunklem Holz mit eingelassenen Spiegeln bedeckt eine ganze Wand. Robert stellt seinen Koffer auf das Bett, öffnet ihn, nimmt seine Sachen heraus. Ein Anzug, die Uniform, Unterwäsche und Hemden für vier Tage.
Das Schiff, das nun ohne ihn in die Heimat unterwegs ist, verfügt über eine Wäscherei, deshalb hat er nicht mehr Kleidung mitgenommen. Den Schlafanzug wirft er achtlos auf das Bett. Er will nicht hier sein. Er stellt das Rasierzeug, Eau de Cologne, die Zahnbürste ins Bad. Robert braucht nicht einmal ein Zehntel des Platzes, den das Waschbecken und der Badschrank bieten, um seine Habseligkeiten unterzubringen.
Seine Uniform trägt im Gegensatz zu den meisten Offizieren das CIC-Rangabzeichen, üblicherweise hat das CIC keine Befehlsgewalt über andere Offiziere des Heeres. Es sei denn, sie sind mit Vollmachten ausgestattet wie Robert. Auch das ist die Folge seiner Abstammung. Sein Vater hat darauf bestanden und Robert war es recht.
Er geht zurück ins Wohnzimmer. Auf dem Sekretär thront eine Adlerschreibmaschine, daneben steht ein Telefon. Schlafzimmer, Küche, Bad, Wohnzimmer – Robert schätzt die Wohnung auf mindestens achtzig Quadratmeter. Die Zimmer sind alle vom Flur aus zu erreichen und miteinander verbunden. Das sind einige Meter, die er zurücklegen kann, wenn er nachdenken muss: Im Kreis laufen befeuert seinen Geist. Die Wohnung ist viel zu groß, zu protzig.
»Ich sollte nicht hier sein!«
Er setzt sich an den Sekretär, schiebt die Adler zur Seite und knallt den Hefter auf das blank polierte Holz. Er springt auf, hat eine Entscheidung gefällt.
»Nein!«, schreit er durch die Wohnung. »Verdammt, das können die nicht mit mir machen! Ich bin der Robert Bennett! Sohn von James Bennett.«
Ein einziges Mal in seinem Leben will er einen wirklichen Nutzen davon haben, ein Mal soll ihm die Tatsache, der Sohn eines Helden zu sein, zum Vorteil gereichen. Er reißt den Hörer von der Gabel, wählt die Vermittlung, lässt sich mit dem amerikanischen Fernwähldienst verbinden. Er wird seinen Vater bitten, ihn nach Hause zu holen, er soll, er muss seinen Einfluss geltend machen. Morgan beruft sich auf Adenauer? Sein Vater spielt mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Golf. Wer hat wohl die größere Macht? Robert hat genug für sein Land getan. Und genug getötet. Schreie hallen durch seinen Kopf. Er schüttelt ihn heftig, damit sie schweigen. Eine junge Frau meldet sich.
»Guten Tag, Sir. Bitte nennen Sie mir Ihre Zuteilungsnummer oder Ihre Dienstnummer.«
In der Leitung knackt es, leises Rauschen läuft im Hintergrund mit. »Counter Intelligence Corps; Bennett, Robert; Major, OA 75683457.«
»Vielen Dank, Major Bennett, bitte warten Sie einen Moment.«
Robert wirft einen Blick auf den Hefter. Die Vermittlerin wird anhand einer Liste, die wöchentlich aktualisiert wird, nachsehen, welche Verbindungen sie für Robert herstellen darf. Nur innerstädtisch, nur innerhalb der amerikanischen Zone, deutschlandweit oder international? Robert hört Papier rascheln. Er schlägt den Deckel des Hefters auf. Der Auftrag lautet: »Cleanen Sie Sigfried Heiderer.«
Den Namen Heiderer hat Robert schon gehört, ein Alt-Nazi, der in Deutschland in den Diensten des FBI steht. Mehr weiß er nicht über ihn. Es gibt einfach zu viele Nazis, und von einigen sind die FBI-Akten gesperrt. Heiderer gehört dazu, das geht aus einem Vermerk hervor.
Robert liest weiter. Heiderer war Ost-Experte, Kommandant des Bataillons Ostmark, bestehend aus Ukrainern, beteiligt am Massaker von Lemberg, an der Erschießung von Juden und Kriegsgefangenen. Das Bataillon rückte als Erstes ein und ist angeblich für Hunderte Morde verantwortlich. Eine Stimme hallt durch seinen Kopf. »Fang mich doch!« Es ist die Stimme seines Bruders Ted. Er ist sieben Jahre alt, Robert ist zehn. Die Sonne brennt ihnen auf die Haut, ihre Hemden haben sie ausgezogen, Schweiß glänzt auf ihren Rücken. Robert rennt los, er wird den kleinen Frechdachs fangen wie immer. Aber diesmal rennt Ted nicht den staubigen Weg nach Süden. Er biegt ab zum Green River, Robert folgt ihm. Was hat er vor? Er schlägt einen Haken, wieselt durchs Unterholz. Nicht dumm von Ted, da ist Robert langsamer, weil er größer ist. Robert kennt den Weg, und jetzt weiß er auch, was Ted vorhat. Er beschleunigt, bricht aus dem Dickicht, vor ihm das steile Ufer des Green River, er muss abrupt stoppen. Der Fluss ist hier breit und tief, die Strömung ist zu stark, um dagegen anzuschwimmen. Auf der anderen Seite steht Ted und dreht Robert eine Nase. Er hat das Seil in der Hand, mit dem sie sich über den Fluss schwingen.
»Ted!«, ruft Robert. »Das wirst du mir büßen.« Doch Robert kann seinem Bruder nicht böse sein, im Gegenteil. Ted hat ihn ausgetrickst. Er ist stolz auf seinen kleinen Bruder. Robert lacht, klatscht Beifall. »Okay, dieses eine Mal hast du gewonnen!«
Ted schwingt mit dem Seil zu Robert ans andere Ufer zurück, das Seil gibt nach. Wenn Ted in den Green River fällt, wird er ertrinken. Roberts Herz setzt für eine Sekunde aus. Doch das Seil hält. Robert fängt Ted auf, drückt ihn. »Du kleiner verrückter Kerl. Was, wenn du in den Fluss gefallen wärst? Du wärst ertrunken wie eine junge Katze.«
Ted schaut Robert mit seinen blauen Augen, mit seinem unschuldigen Blick an. »Dann hättest du mich gerettet. So wie immer. Du musst mich immer retten. Versprichst du das?« Er japst, redet so schnell, dass er fast keine Luft bekommt.
Robert streicht ihm über den Kopf. »Das verspreche ich dir. Ich werde dich beschützen und dich retten, was auch immer passieren wird.«
Die Trauer kriecht Robert die Kehle hoch. Er hat sein Versprechen nicht halten können. Robert hat es auf dem Weg nach Deutschland erfahren. Nur ein kurzes Telegramm von seinem Vater. »Ted ist tot. Lemberg.« Mehr haben sie in all den Jahren nicht erfahren können. Sie konnten ihn nicht einmal begraben. Niemand weiß, wo seine Leiche liegt. Die Marke ist ihnen zugespielt worden, inoffiziell. Ted hatte die Aufgabe, aus Lemberg jüdische Professoren und ihre Familien über die Ostsee nach Schweden und dann in die Staaten zu bringen. Das hat ihn das Leben gekostet. Aber niemand weiß, nein, wusste, wie. Robert nimmt den Hefter in die Hand, kann nicht glauben, was er da liest. Sigfried Heiderer ist mit großer Wahrscheinlichkeit für den Tod seines Bruders verantwortlich! Den soll er cleanen? Soll ein ominöses Archiv finden, in dem die Beweise gegen Heiderer enthalten sind?
Robert greift nach dem Hefter und wirft ihn durch den Raum. »Morgan, du verfluchte hinterlistige Ratte!«, schreit er. Es ist ihm egal, ob ihn jemand hört.
Die Blätter landen auf dem geölten Parkettboden. Was hat er Morgan angetan, dass er ihm ausgerechnet diesen Auftrag zuweist? Was für ein Ungeheuer ist dieser Mann? Warum zum Teufel soll er Heiderer cleanen? Der verfluchte Nazi soll in der Hölle schmoren. Das Telefon reißt ihn aus seinen Gedanken. Robert ergreift den Hörer. Es ist die Vermittlung.
»Major Bennett, ich kann Ihnen morgen Vormittag um neun Uhr dreißig die gewünschte Verbindung herstellen.«
Robert starrt auf die Blätter, die sich auf dem Parkettboden ausgebreitet haben. Vater wird ihn nach Hause holen, das steht außer Zweifel. Weg von diesem grauen, kalten Land, weg von Morgan und seinen Intrigen.
Robert zögert, ihm kommt ein Gedanke: Was wäre, wenn er tatsächlich nach Hause führe? Würde er sich nicht jeden Tag seines restlichen Lebens fragen, warum er die Chance vertan hat, den Mörder seines Bruders seiner gerechten Strafe zuzuführen? Und wenn Heiderer unschuldig ist? Es waren noch andere Befehlshaber in Lemberg. Vor allem die Ukrainischen Nationalisten trieben ihr Unwesen. Die Verhältnisse waren chaotisch, die Befehlsketten brüchig, die Militär-Archive sind verschollen. Das ist die offizielle Lesart. Robert legt den Hörer weg, sammelt die Blätter auf, die ihm plötzlich unendlich wertvoll erscheinen. Er streicht sie glatt, ordnet sie, überfliegt die Informationen noch einmal. Ergebnis: Heiderer kann, muss aber nicht der Mörder seines Bruders sein. Was auch immer Morgan sich gedacht hat, ihm den Auftrag zuzuteilen, ist Robert egal. Er wird alles gegen Heiderer zusammentragen, was er nur finden kann. Und wenn Heiderer seinen Bruder auf dem Gewissen hat, dann Gnade ihm Gott, dann wird er ihn in die Staaten schaffen, wo er vor Gericht gestellt wird und ihn nichts anderes erwartet als der Strang.
Aus dem Hörer quäkt die Stimme der Vermittlung. »Major Bennett? Sind Sie noch dran?« Sie klingt ungeduldig.
Robert betrachtet den Hefter. Er ist nicht mehr zu gebrauchen. Er wird sich einen anderen besorgen, einen mit Leineneinband, einen, der Teds Namen tragen wird. Robert hält sich den Hörer ans Ohr. »Verzeihen Sie, ich hatte gerade etwas Wichtiges zu tun. Ich brauche die Verbindung nicht mehr.«
Deutsche Demokratische Republik, Berlin, 5.3.1952
Das Schlimmste an dem Auftrag ist ihr Deckname: Herta Müller. Sie hasst diesen Namen. Ihre Lehrerin auf der Volksschule hieß so und sie war eine Hexe. Hat sie ständig gegängelt, sie immer drangenommen, wenn sie nichts wusste, hat sie dreimal am Tag in die Ecke gestellt und ihr mindestens einmal die Woche die Eselsmütze aufgesetzt. Die alte Müller hat sie gehasst, weil sie immerzu Fragen gestellt hat und weil ihr Vater Kommunist war. Und sie hat ihren Vater denunziert.
Wie sehr sie auch diesen Namen hasst, sie muss sich selbst so nennen, damit sie ihre Beute täuschen kann. Sie muss den Namen in ihrem Unterbewussten verankern, damit sie unwillkürlich reagiert, wenn er gerufen wird. Aus Anna Münzinger wird Herta Müller.
Den Namen hat ihr Oberst Jukowski verpasst. Der Name soll für Durchschnitt stehen. Alles an Herta Müller soll Durchschnitt sein: Größe, Gesicht, Haare. Wer sie beschreibt, wird eine Frau gesehen haben, wie sie es zu Tausenden gibt. Das macht sie fast unsichtbar. Sie trägt einen knielangen mittelbraunen Rock, ebenso braune Lederschuhe mit wenig Absatz. Sie hat sich dezent geschminkt, sie soll auf keinen Fall in irgendeiner Weise hervorstechen.
Anna steigt in die Straßenbahn, löst eine Karte nach Zehlendorf. Ihre Beute trifft sich mit ihr im Kaffeehaus Bertelmann an der Ecke Schellingstraße und Barer Straße. Es ist das vierte Treffen, und heute muss es gelingen. Eigentlich viel zu früh, aber die Überwachung Auerbachs hat ergeben, dass er in wenigen Tagen nach Düsseldorf ausgeflogen wird. Dort ist er außer Reichweite. Deswegen hat sie sich auch den Nachmittag freigenommen, damit sie sich mit Auerbach treffen kann.
Sie greift in die Manteltasche, fühlt das Glasfläschchen. Sie muss vorsichtig sein. Joseph Auerbach ist misstrauisch. Kein Wunder. Er ist ein Mörder und hat viel zu verlieren. Aber die Amis schützen ihn, haben ihn reingewaschen, weil sie ihn brauchen. Er ist Ingenieur für Wassertechnik, maßgeblich am Aufbau der Berliner Wasserversorgung beteiligt. Jetzt soll er das Gleiche in Düsseldorf machen und danach im Ruhrgebiet. Es gibt nur noch wenige Spezialisten in Deutschland auf diesem Gebiet.
Die Bahn rumpelt vorbei an Trümmern. Es geht langsam voran. Nicht einmal zehn Prozent des Schutts sind beseitigt, es fehlt an schwerem Gerät. Also müssen alle ran. Vergangenen Sonntag ist wieder Trümmertag gewesen. Anna spürt noch immer jeden einzelnen Knochen. Die ganze Nachbarschaft hat von morgens bis abends Steine geschleppt. Vor dieser Arbeit kann sie sich nicht drücken, das würde Verdacht erregen.
Anna geht ihren Plan in Gedanken durch, immer wieder. Sie muss Auerbach dazu bringen, einen Spaziergang mit ihr zu machen. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, hin zu einem ganz bestimmten Ort. Sie kennt Auerbachs Gewicht, sie hat das Morphin-Scopolamin so dosiert, dass Auerbach nach dreißig Minuten das Bewusstsein verliert. Zehn, vielleicht fünf Minuten vorher wird er die Wirkung spüren. Dann wird er unruhig werden, vielleicht Alarm schlagen. Die Amerikaner haben ein Merkblatt herausgegeben, woran man den Versuch einer Entführung erkennen kann. Die Wirkung von Morphin-Scopolamin und anderer Drogen ist darauf genau beschrieben. Das Zeitfenster ist eng, verdammt eng. Aber sie wird ihn da packen, wo sich alle Männer packen lassen.
Die Bahn hält, sie muss aussteigen. Das Kaffeehaus liegt direkt um die Ecke. Sie geht los. Auf der anderen Straßenseite steht ein groß gewachsener Mann in grauem Anzug und betrachtet ein Schaufenster. Sie kennt ihn nicht, aber er verhält sich seltsam. Schaut zu ihr, dann wieder auf das Schaufenster. Zieht eine Packung Zigaretten aus der Tasche. Zündet sie an. Ein Zeichen an eine Greiftruppe? Ist sie enttarnt? Hat Auerbach etwas gemerkt? Wieder dreht sich der Mann um, späht die Straße hinunter. Eine Frau tritt aus einem beschädigten Haus. Der Mann wirft die halb gerauchte Zigarette auf den Boden, tritt sie aus. Er muss gut betucht sein, wenn er so verschwenderisch mit Zigaretten umgeht. Ein Kippensammler wird sich freuen. Die Frau fliegt ihm in die Arme, sie küssen sich leidenschaftlich, gehen Arm in Arm davon. Fehlalarm.
Die anderen Passanten benehmen sich unverdächtig, dennoch beobachtet sie jeden und alles. Das kostet Kraft. Sie kann diese Konzentration nicht den ganzen Tag aufrechterhalten. Auf eine Rückendeckung hat sie verzichtet. Zu gefährlich. Zu leicht erkennbar und letztlich sinnlos. Eine Waffe darf sie nicht tragen, würde sie damit erwischt, wäre sie erledigt. Es gibt immer wieder spontane Kontrollen, ganze Viertel werden abgesperrt, keiner kann entkommen.
Anna geht weiter, überquert die Straße, kehrt um. Niemand bleibt plötzlich stehen oder ändert die Richtung. Sie biegt um die Ecke, das Kaffeehaus ist so gut wie unbeschädigt. Nicht eine Scheibe ist zu Bruch gegangen in den Bombennächten. Ein Wunder. Als sie es betritt, schlagen ihr beißender Zigarettenqualm und die gedämpften Stimmen der Gäste entgegen. Irgendjemand schmaucht Pfeife, der angenehme, würzige Geruch dämpft ein wenig den der scharfen Zigaretten. Anna raucht nicht, und der Qualm macht ihr nicht wirklich etwas aus. Er ist nicht schlimmer als die abgasgeschwängerte Luft, die oft über der Stadt hängt, wenn das Wetter ungnädig ist und einen Deckel aus kalter Luft über Berlin stülpt, der den Luftaustausch unmöglich macht. Das Wetter ändert sich immer wieder, doch das Misstrauen, die Angst und das Vergessen-Wollen, die über der Stadt und dem ganzen Land liegen, ändern sich nicht. Wenn sie Auerbach fangen kann, wird sie dazu beitragen, dass ein wenig Erinnerung an die Verbrechen der Nazis wach bleibt, Erinnerungen, die im Westen unter Schweinebraten, Nylonstrümpfen und Autos erstickt werden. Sie lenkt ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Menschen. Kellner huschen zwischen den Tischen hin und her, hier muss niemand lange auf seine Bestellung warten. Sie entdeckt den Pfeifenraucher. Feistes Gesicht, runde Hüften, Kugelbauch. Vor ihm steht ein Teller mit drei Stück Kuchen, eines davon bereits zur Hälfte gegessen. Der Mann scheint zufrieden. Seine Seele fühlt sich wohl, eingehüllt in Tabak, Zucker und Fett. An einem anderen Tisch tuscheln drei junge Frauen miteinander. Sie sind modisch gekleidet, in Pariser Chic, ganz Dior: Wellenlinien, leichte Stoffe, die am Körper hinabfließen, weiche, runde Formen. Sie sind schön anzusehen. Anna gefällt diese neue Weiblichkeit, doch sie selbst kann solche Kleider nicht tragen. Sie muss eine graue Maus sein, für die sich niemand umdreht. Jeder Tisch ist besetzt, an einem sitzen Männer im Frack. Anna fragt sich, warum sie um diese Tageszeit so gekleidet sind. Vielleicht haben sie sich hier verabredet, um gemeinsam zu einem Empfang zu gehen? Nicht ihr Problem. Niemand scheint verdächtig.
Auerbach hat sie noch nicht entdeckt. Er sitzt am Fenster in einem Sessel und ist in die Tageszeitung vertieft. Anna ist zehn Minuten zu früh, er rechnet noch nicht mit ihr.
Sie tritt von hinten an ihn heran. »Ist hier noch ein Platz frei?«
Die Zeitung fällt raschelnd auf den runden Marmortisch, Auerbach springt auf, in seinem Gesicht mischen sich Freude und Verlegenheit. »Herta, wie schön, Sie zu sehen, aber selbstverständlich.«
Sie beugt sich zu ihm hin, schließt die Augen, gibt ihm zu seiner Überraschung einen leichten Kuss auf die Lippen. Sie sind weich und trocken, Gott sei Dank. Sie spürt leichte Übelkeit aufsteigen. Er riecht nach Moschus, er muss auf dem Schwarzmarkt einkaufen, so etwas gibt es nicht in den Kaufhäusern.
»Setzen Sie sich doch.« Er zeigt auf den anderen Sessel. Roter Plüsch. »Was darf ich Ihnen bestellen?«
Anna zieht den Mantel aus, Auerbach will ihn nehmen, um ihn an die Garderobe zu hängen, aber sie schüttelt den Kopf. »Lisa ist neulich der Mantel gestohlen worden.«
Auerbach zieht die Hand zurück. »Sie haben recht, man kann nie vorsichtig genug sein. Die Stadt ist voller Diebe.«
Und voller Menschen, denen das Nötigste fehlt. Sie ist erstaunt, dass es nicht viel mehr Überfälle gibt, dass sich die Vergessenen nicht zusammentun, um ihr Recht auf ein würdiges Leben durchzusetzen. Anna nimmt Platz, drapiert den Mantel über der Lehne. Auerbach rückt seinen Sessel noch etwas näher an ihren, dann lässt er sich in seinen Sessel gleiten. Er ist schlank, kein Gramm Fett zu viel, er hält sich fit, und er sieht nicht schlecht aus. Stattlich, dennoch jungenhaft. Und vor allem harmlos, als könne er kein Wässerchen trüben. Anna weiß es besser.
»Was möchten Sie?«
»Eine heiße Schokolade bitte. Ganz dunkel.«
Er winkt einem Kellner, der sofort an ihren Tisch kommt, Auerbach gibt die Bestellung auf: eine Tasse Brühkaffee für sich, extrastark und schwarz, die heiße Schokolade für Anna, extradunkel.
»Wie geht es Ihnen?«, fragt Auerbach. »Hat Ihr Chef ein Einsehen gehabt?«
Annas Deckarbeitsplatz ist ein kleines Versicherungsbüro. Sie arbeitet dort als Sekretärin. Auerbach hat sie erzählt, dass ihr Chef sie auch samstags bis sieben Uhr arbeiten lässt. Auerbach hat schon zweimal angerufen, um sie zu sprechen. Sie ist sich sicher, dass er prüfen wollte, ob es dieses Büro überhaupt gibt. Er hat es sich von außen angesehen und sogar jemanden geschickt, der eine Versicherung abgeschlossen hat. Seitdem hat er mehr Vertrauen gefasst. Sie geht davon aus, dass er ihre Deckidentität geschluckt hat. Die Westpresse ist voll mit reißerischen Artikeln über Entführungen Unschuldiger. Alles gelogen. Anna weiß es. Sie hat schon viele Naziverbrecher und Landesverräter gefasst und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Der Westen aber macht sich nach wie vor mit Nazi-Verbrechern gemein. Die Nürnberger Prozesse haben nur den Schaum der Nazijauche abgeschöpft.
»Ja. Ich muss jetzt nur noch bis fünf arbeiten. Eine große Verbesserung«, antwortet sie fröhlich.
Die Getränke kommen. Die Schokolade dampft, so heiß ist sie, der Kaffee ebenfalls. Das Kaffeehaus hat keine Heizung. Im hinteren Teil befindet sich ein Kaminofen, der aber nicht befeuert wird. Kohle ist teuer, Holz gibt es überhaupt nicht, die Gasleitung ist noch nicht repariert.
Anna kostet. Die heiße Schokolade ist dick und herb, schmeckt leicht bitter nach Kakao. So hat ihre Mutter sie früher gemacht, bevor die Nazis sie verschleppt haben. Da war Anna zehn Jahre alt. Nur ein Jahr später war ihr Vater weg. Ihr Großvater hat sie bei Nacht und Nebel nach Frankreich gebracht. In der Nähe von Bordeaux war eine Anlaufstelle für deutsche Kommunisten. Dann er ist ins Reich zurückgekehrt. Weder von ihrer Mutter noch von ihrem Vater oder ihrem Großvater hat sie je wieder gehört. Sie atmet tief durch, muss aufpassen, dass sie nicht wehleidig wird, das vernebelt die Sinne. Sie kann es sich nicht leisten, unaufmerksam zu sein.
Auerbach nippt an seinem Kaffee, schaut sie über den Tassenrand hinweg an. »Am Sonntag, äh«, er errötet, »hätten Sie Lust, mit mir und Freunden einen Ausflug zu machen?«
Anna setzt ein erfreutes Gesicht auf, sie weiß, dass es echt wirkt. Vor dem Krieg hat sie Schauspiel studiert. »Aber ja. Gerne. Wohin soll es denn gehen?«
»Ich habe Ihnen doch von Norbert erzählt. Er hat ein Segelboot, wir machen eine kleine Tour über die Spree, vorausgesetzt, das Wetter hält.«
Anna greift nach Auerbachs rechter Hand, drückt sie, er erwidert die Berührung leicht. Auch seine Hände sind trocken. Er ist vollkommen entspannt. Wieder steigt leichte Übelkeit auf. »Das wäre wunderbar! Und schlechtes Wetter macht mir nichts aus. Mein Mantel ist wasserdicht.«
Auerbach lächelt milde. »Der würde nicht viel nutzen auf dem Wasser. Aber es ist gut, wenn Sie wetterfest sind. Die nötigen Kleider habe ich noch von meiner Frau. Die müssten Ihnen passen.«
Anna ist überrascht. Er hat noch nie von seiner Frau erzählt. »Ihre Frau …«
»Sie ist tot. Bombennacht. Ich war freiwilliger Helfer bei der Feuerwehr. Die Bombe hat den Keller getroffen. Niemand hat überlebt.«
Anna drückt seine Hand fester. »Es sind so viele ums Leben gekommen.«
Er lächelt noch immer. »Aber jetzt ist es ja vorbei, und das Leben geht weiter.«
Auerbach ist ein guter Lügner. Er war nie bei der freiwilligen Feuerwehr. Und er war auch nie verheiratet. Er hat in den letzten Tagen des Krieges Hunderte Kinder in den Tod geschickt und Dutzende Männer erschießen lassen, die sich geweigert hatten, als Kanonenfutter zu sterben. Bevor ihn die Russen schnappen konnten, ist er geflohen und hat sich den Amerikanern ergeben.
»Wie furchtbar«, haucht Anna.
»Ja, aber wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander. Das macht es leichter.«
Anna seufzt tief. »Ich bewundere Sie, dass Sie nicht verbittert sind.«
Auerbach legt seine andere Hand auf ihre. »Wir müssen vergeben, so wie uns vergeben wird. Ist es nicht so«?
»Ja, so ist es. Nur so kann wirklicher Friede einkehren.«
Auerbach nickt wissend, er erhebt sich. »Entschuldigen Sie mich einen Moment. Der Kaffee …«
Beide lachen. Er hat eine schwache Blase, auch das weiß Anna. Sie schaut Auerbach nach, er muss aus dem Café raus und über den Hof gehen, wo die Toiletten untergebracht sind. Ihr bleibt genug Zeit. Noch einmal überzeugt sie sich, dass er das Kaffeehaus verlassen hat. Noch einmal schaut sie sich die anderen Gäste an. Wenn ein Agent darunter ist, wenn es eine Falle ist, hat sie bereits verloren. Sie verdeckt das Fläschchen mit der einen Hand so, dass es niemand sehen kann, und beugt sich über den Tisch. Es sieht aus, als wolle sie das Zuckerdöschen nehmen. Die K.-o.-Tropfen plätschern in den Kaffee. Der ist so bitter, dass Auerbach nichts schmecken wird. Sie lässt das Fläschchen verschwinden, nimmt einen Löffel Zucker und gibt ihn in den Kakao. Die Wolkendecke bricht auf, die Sonne kommt heraus. Besser kann es nicht werden.