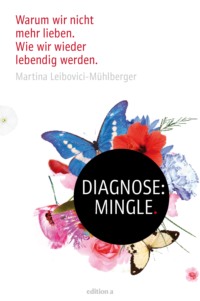Kitabı oku: «Diagnose: Mingle», sayfa 4
Was jedoch für unsere Fragestellung der ICH-Entwicklung als der wesentlichste Aspekt der Analyse früher Kommunikationsprozesse bezeichnet werden muss, ist die Tatsache, dass im Hintergrund all dieser von uns als Säugling und Kleinkind sowie heranwachsendem Kind gemachten Erfahrungen unser ICH geformt wird. Erst während wir zum ICH werden, beginnen wir auch die Fähigkeit zu entwickeln, dieses ICH zu bemerken und später dann darüber nachzudenken.
Klar wird hier allerdings auch die Tatsache, dass kein vom Kontext seiner Entstehung »losgelöstes« ICH existiert. Das ICH und sein Bewusstsein zu sich entsteht über das DU, das lebendige Gegenüber und jene Prozesse von Bezugnahme aufeinander. Wer das anzweifelt sei herzlich dazu eingeladen, in historischen Texten zu den ersten Findelhäusern nachzulesen oder deren Todesstatistiken zu studieren. Denn der Säugling, der zwar physisch ernährt wird, aber ohne Bezug(sperson) in einem kalten, seine verzweifelten Signale unbeantwortet lassenden Kosmos zu leben verurteilt ist, der verzweifelt als Organismus binnen kurzer Zeit. Er findet keinen Andockplatz für eine ICH-Entwicklung, vermag zu keinem ICH zu werden und gibt sein Leben auf. Das haben in jüngerer Zeit auch die schrecklichen Waisenhäuser des Ceauşescu-Regimes neuerlich bewiesen. Schon der Stauferkaiser Friedrich II (1194-1250), der wissen wollte, ob Aramäisch oder Latein die heilige Ursprache wäre und Ammen verbot, die ihnen anvertrauten Kinder zu herzen, ihnen vorzusingen, sie zu streicheln oder auch nur, sie beim Stillen anzusehen, erreichte damit nur den Tod der Kinder.
Ohne Bezug, ohne Bindung und Beziehung zu einem DU also kein ICH. Aber wenn wir diesen grundsätzlichen Entwicklungsweg der ICH-Werdung nun nachvollziehen können, erhebt sich natürlich als nächstes die Frage: WIE sieht denn dieses ICH aus? Aus welchen Bestandteilen setzt es sich zusammen? Was genau meinen wir, wenn wir »ICH« sagen? Wie erlebt sich also dieses ICH, das nicht nur in Abhängigkeit zum DU, sondern auch zum größeren DU einer ganzen Gesellschaft, ihren Werten und Grundüberzeugungen und den damit verbundenen Erfahrungen entsteht? Was also ist genau gemeint, wenn sich ein einzelnes ICH beschreibt, das als indisches Mädchen im untersten Kastensegment aufgewachsen ist, oder ein ICH, das in den Hamptons seine ersten prägenden Lebensjahre zugebracht hat? Und gibt es einen Unterschied in der ICH-Wahrnehmung über die Jahrhunderte hinweg?
Lassen wir die Stromschnellen kultureller Einflussfaktoren auf die ICH-Entwicklung beiseite und konzentrieren wir uns auf jene ICHs, die uns in unserem westlichen Lebensalltag bevorzugt entgegenkommen. Wen dürfen wir erwarten?
Wenn wir heute »ICH« sagen und unsere »Sozialisierungsadresse« in unserer reichen Konsumgesellschaft angeben können, so haben wir eine ziemlich klare und vor allem hochspezifische Vorstellung, wer dieses ICH ist. Dieses ICH ist zuerst einmal in klarer Weise eine eigenständige von allen anderen getrennt zu sehende biologische Einheit mit eindeutigen Körpergrenzen. Der körperlichen Ausdehnung und Oberflächenbeschaffenheit dieses ICHS ist heute gleich eine besonders herausragende Bedeutung zugeordnet. Viel Energie, Zeit und Geld wird dafür aufgewendet, um der Präsentation dieses Körpers im Spannungsfeld von Idealvorstellungen einen höchst persönlichen, eben individuellen Look zu geben. Das Ganze erfolgt unter der Zielsetzung, zu seiner eigenen »Marke« zu werden, sich als höchst persönliches Individuum von allen anderen abgrenzen zu können. Für diejenigen von uns, die weniger in der Öffentlichkeit stehen, gilt es dabei nur, in ihren unmittelbaren sozialen Bezugsgruppen »individuelles Gesehen-Werden« zu erzeugen und einen persönlichen »recall« zu provozieren. Jene mit sogenanntem Öffentlichkeitsauftrag müssen dann eben ihr ganzes Leben eventuell auch mit einem roten Käppchen auf dem Kopf in die Oper gehen oder sich sonstwie verkleiden. Aber neben der Möglichkeit, Körperlichkeit als ersten Signalgeber für Individualität zu nutzen, gilt es, eine höchst eigene, unverwechselbare Persönlichkeit zu präsentieren. Die Zielvorstellung unserer heutigen Zeit ist es, wenn möglich zu einem atemberaubenden Gesamtkunstwerk zu avancieren, die perfekte Selbstinstallation oder aber sein persönliches Denkmal zu Lebzeiten zu werden. Wer das schafft, dem sind die Blicke und die Aufmerksamkeit ja die Gefolgschaft der Twitter-Follower sicher. Persönlicher Kreativität und Selbstpersiflage im Dienste dieses Ziels sind keine Grenzen gesetzt. Denn wer will heute noch ernsthaft als Dutzendware gesehen werden oder hängt seine Identität hauptsächlich an seiner Berufsgruppenzugehörigkeit auf?
Dahinter steht ein langer Weg der Individualisierung des Menschen. Auch wenn uns dies heute nicht bewusst ist, wir uns die heutigen Verhältnisse zu dem, was es heißt, ein ICH zu sein, uns als ICH zu FÜHLEN, als normal, wahr, wirklich und gar nicht mehr anders möglich vorstellen.
Natürlich können wir davon ausgehen, dass sich auch schon der mittelalterliche Mensch als Individuum begriff, als ein Mensch mit bestimmtem Aussehen, wenngleich dazu im Durchschnitt der Bevölkerung nur eine so verschwommene Wahrnehmung existierte, wie es der nächstliegende Dorfweiher an einem windstillen Sommertag erahnen ließ. Denn Spiegel waren Mangelware und sicher nicht in jeder Köhlerhütte Standard. Die sozialpsychologische Konzeption des ICHS war in strikter Form an die jeweilige Gemeinschaft und das gemeinsame Überleben gebunden, das ICH durch die Zugehörigkeit zu einer definierten Bezugsgruppe und ihrem Regelwerk weitestgehend bereits definiert. Individualismus, der nur den Einzelnen ins Zentrum stellte, wurde nicht geduldet und unterlag der Ächtung. Das Individuum als unabhängige und von der Gemeinschaft zunehmend abgekoppelte Selbstkonzeption, nahm erst einen langen Weg durch die Einflüsse von Renaissance, Aufklärung und Industrialisierung bis in die Moderne. Die damit verbundenen Übergänge von der dörflichen zur urbanen Gesellschaft, vom Obrigkeitsstaat zu Demokratie, von der überlebensnotwendigen Wirtschaftseinheit einer Gemeinschaft hin zu staatlicher Kranken- und Pensionssicherung trugen ihren Teil dazu bei.
Wie hat sich das Verständnis von Lieben als »Kommunikationsund Organisationsform« von notwendiger Bindung und Beziehung, die uns ja wie besprochen evolutionär eingeschrieben ist, in Parallele dazu entwickelt? Liebe als Sinn stiftende Beziehungsvariable des Paars erweist sich bei genauerer Betrachtung als ein relativ junges Auswahlkriterium in der Partnerwahl. Zumindest dann, wenn wir sie in der Bedeutung eines romantischen emotionalen Affekts verstehen. Die Partnerwahl wurde auch bei uns lange Zeit nach wirtschaftlichen und sozialen Statusüberlegungen getroffen. Die Entwicklung von Zugehörigkeit, wechselseitiger Zuverlässigkeit in der Erfüllung der erwarteten Rolle und Kameradschaft war dabei ein ausreichendes emotionales Spektrum zwischen den Partnern. Liebe im Sinn einer heftigen leidenschaftlichen Affektion füreinander war im Standardkatalog der Kriterien für Paarbeziehungen nicht enthalten, ja vielfach gar nicht erwünscht. Das romantische Ideal, das Liebe als beziehungsbegründende Variable postulierte, gestaltete sich erst im 18. Jahrhundert aus und trat danach langsam seinen Siegeszug durch alle Bevölkerungsschichten an.
Man könnte also durchaus zur Annahme kommen, dass mit zunehmender Individualisation auch zunehmend Gestaltungsfreiheit eröffnet wurde, ein auf der eigenen Person und ihrer Spezifität begründetes »Lieben« zu entwickeln.
Interessant ist, dass »Liebe« als Sinn stiftendes Prinzip schon immer zentrales Motiv in Literatur und Kunst war. Angefangen bei Philemon und Baucis, die noch als altes Ehepaar durch ihre Liebe in Eintracht verbunden vor ihrer Hütte sitzen, über Romeo und Julia, bis zu »Love Story« reichend. So wird das »Lieben« immer wieder als die große positive Kraft beschworen. In unzähligen Varianten ist das Wesen der Liebe Thema der Auseinandersetzung.
In einer Gesellschaft, die ihren Mitgliedern einen hochpersönlichen individualisierten Lebensentwurf einräumt, ja diesen postuliert, sind wir nun dort angekommen, wo jeder von uns diese seine große erfüllende Liebe erleben will. Aber irgendetwas muss schiefgegangen sein.
Wie konnte das passieren? Noch nie haben wir derart intensiv über uns nachzudenken vermocht. Noch nie haben wir dank Arbeitszeitbegrenzung und Urlaubsregelung derart viel Zeit für die Gestaltung unserer Beziehungen zur Verfügung gehabt. Noch nie haben wir uns in derart gesicherten wirtschaftlichen Bedingungen und mit medizinischer Rundumversorgung auf höchstem Niveau vorgefunden. Noch nie stand uns also so viel Raum zur Selbstgestaltung eines glücklichen, liebenden Lebens zur Verfügung. Noch nie waren wir so knapp an der Tür zum Paradies und scheinen dennoch am weit geöffneten Tor laut lamentierend und unser Schicksal beklagend beständig vorbeizulaufen. Luzifer steht in der lässigen Verkleidung eines Geschäftsmanns mit einem frechen, kleinen Panamahut auf dem Kopf daneben und reibt sich angesichts der Tatsache die Hände, dass 38% der europäischen Bevölkerung eine klinisch relevante psychische Beeinträchtigung aufweisen, sprich unglücklich sind.
Wo sind wir in unserer ICH-Werdung falsch abgebogen und haben damit selber das Grundprinzip der Lebendigkeit, »das Lieben«, verraten?
Das losgelöste ICH
Nennen wir sie Katharina, denn sie ist eine in der Öffentlichkeit bekannte, bewunderte und beneidete Person. Ich kam anlässlich eines Sommerschulfests mit ihr ins Gespräch, bei dem sich Eltern etwas am Rande stehend zusammenrotten, während ihre Kinder beim Sackhüpfen konkurrieren. Der übliche Small Talk will abgespult sein, während man aus Plastikbechern Mineralwasser schlürft oder mit dem Fortschreiten der Veranstaltung dann zum selbstgemachten Kuchenbuffet mit Kaffee vordringt. Und wir redeten natürlich über die Kinder. Dass ich vier Kinder habe, schien sie bemerkenswert und hinterfragenswürdig zu finden. Als Trägerin des Emblems »reich und schön« hatte sie auch jene leicht fordernde, offensive Art an sich, mit der Vertreter dieser Spezies gerne ihre Machtposition demonstrieren. Mit anderen Worten, sie war taktlos. »Du hast sicher jede Menge Schwangerschaftsstreifen, nach vier Kindern«, meinte sie irgendwann in einem Tonfall, in dem sich kalte Forscherlust und konspirative Schwesternschaft im Widerstreit zu befinden schienen. Das »Du« reklamierte sie schlichtweg aus der Elterncommunity heraus als selbstverständlich.
»Nicht einen«, versetzte ich knapp und nahm einen Schluck aus meinem Becher. Meine so demonstrierte Coolness machte sie neugierig.
»Du bist Gynäkologin«, hakte sie nach.
»Auch«, gab ich zur Antwort, »aber das hat damit nichts zu tun. Einfach gutes Gewebe und nicht zu viel zugenommen.« Mein Ton war sachlich, deskriptiv, abgegrenzt, emotionslos, obwohl ich meine eigene Körperlichkeit beschrieb. Das schien ihr zu vermitteln, dass wir so was wie »Freundinnen« waren, und sie wurde plötzlich vertraulich: »Ich habe mir im siebenten Monat drüben in den Staaten einen Kaiserschnitt wegen möglicher Schwangerschaftsstreifen machen lassen. Die Kleine war dann noch ein paar Wochen im Brutkasten, aber alles top versorgt, und ich habe mich wenigstens wieder erholen und shapen können.« Während sie erzählte, schien sie mir durchaus mit ihrer Vorgehensweise im Reinen zu sein. »Alles im Griff,« strahlte sie mich zum Abschluss noch an, »als ich sie aus der Klinik bekommen habe, hatte ich schon fast wieder meine Figur.« Jetzt wirkte sie fast wie ein kleines Mädchen, das Zustimmung, wenn nicht sogar Lob von mir erwartete. Fehlte nur noch, dass sie sich vor mir im Kreis drehte, um mir ihren »Body« von allen Seiten als perfekt vorzuführen.
»Alles im Griff«, wiederholte ich, ließ meinen Blick zu unseren beiden Mädchen wandern, die gerade voller Enthusiasmus im Stafettenlauf ihres Teams einen Ball durch einen Parcours dribbelten und drehte mich dabei um. Mir war speiübel. Dies war kein Einstieg in eine intensive Freundschaft zwischen Katherina und mir.
Katharina ist zugegeben ein Extrembeispiel, der Prototyp des losgelösten ICHS, eines Menschen, der nur mehr sich und seine persönlichen Bedürfnisse wahrzunehmen versteht und dies sogar im Bezug auf sein eigenes Kind. Der losgelöste Mensch ist nach meiner Beobachtung jener, der sich nicht mehr in Einbettung und im Spannungsfeld der Gemeinschaft und eines anderen Gegenübers befindet, sondern einer, der in seiner Wahrnehmung ganz auf sich selbst fixiert ist.
Den historischen Ausgangspunkt dieser Abkehr vom Kollektiv oder auch das Misstrauen gegen Gemeinschaft als Einstieg in einen Individualisierungsprozess, der sich von einem Gegenüber loszulösen trachtet, sehe ich im Schrecken und der tiefen unbewussten Beschämung, die der zweite Weltkrieg hinterlassen hat. Als sich die Feuerstürme gelegt und Staub und Asche auf den Boden gesenkt hatten und als die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages das ganze Ausmaß der Verwüstung und des Wahnsinns menschlichen Zerstörungsvermögens beleuchtete, muss im kollektiven Unbewussten aller Überlebenden ein Grauen über die Macht, die kollektive Ideologien zu entwickeln im Stande sind, erwacht sein. Selbst wenn jeder Einzelne für sich eine plausible Rechtfertigung für seinen Part schnitzen konnte, selbst wenn keiner, der den Krieg überlebt hatte, sich erinnern konnte, beim Anschluss auf dem Heldenplatz gewesen zu sein, selbst wenn jeder Befragte zu allererst sich selber glaubwürdig vermitteln konnte, dass er, gerade er, nichts von der Existenz von Konzentrationslagern gewusst hatte: Es muss doch in dieser Nachkriegsgesellschaft und genauso bei jenen, die auf der anderen Seite gestanden sind, als Reaktionsbildung zu einem tiefen und in der Folge unaufgearbeiteten Vertrauensverlust in die positive Kraft von Gemeinschaft gekommen sein. Denn alle haben es gewusst, haben gewusst, dass es diese Vorkriegsgemeinschaft war, die die Weichen gestellt, die Feindbilder gepflegt und geeignete Protagonisten eingesetzt hat. Wer dazu ein sehr schonungsloses Zeugnis nachlesen möchte, blättere in Sebastian Haffners Werk »Die Geschichte eines Deutschen.« Und natürlich haben auch alle anderen Nationen und jene, die in Übersee saßen, ihren historischen Part im Weltkonfliktklima gespielt. Der nachfolgende Bildersturz von Tradition, die kollektive Weisungsverweigerung der 68er gegenüber der Vorgeneration, die Forderung nach Selbstbestimmung von Moral und Ethik tragen allesamt bereits als zentrales Credo das sich selbst ins Zentrum stellende, von den Zwängen und Vorgaben einer Gemeinschaft losgelöste ICH. Grundsätzlich keine schlechte Idee. Statt einer obrigkeitsorientierten Rudelgefolgschaft das freie, selbstbestimmte, selbstdefinierte Individuum entwickeln zu wollen, das sich, sein spezifisches Sein und seine Bedürfnisse realisiert und vertritt, scheint ein Selbstverantwortung stärkender Ansatz zu sein. Das klingt ausnehmend gut, nahezu prophylaktisch gegen bösartige Vermassungstendenz. Ja, das klingt nahezu ideologieresistent. Diese Veränderung des Menschenbilds wäre auch absolut begrüßenswert gewesen, wäre sie damals beginnend und bis heute weiter fortgesetzt, als ein Prozess erfolgt, in dem ein »ICH«, das sich in die Grundmatrix von gemeinsam lebender Gemeinschaft eingebettet versteht, seine Entwicklung in der individuellen Selbstentdeckung genommen hätte.
Hat es aber nicht, so viel ist sicher, denn das hätte bedeutet, als tiefstes kollektives Fundament unserer inneren, unsere psychische Grundstruktur definierenden Überzeugungen, so etwas wie Verbindlichkeit zum Ausgang der Individualisation zu machen. Stattdessen haben wir Luzifers Verführung im aufkeimenden Wirtschaftswunder nicht zu widerstehen vermocht. Das »losgelöste ICH«, das auf sich selbst zentrierte ICH, sich bespiegelnde und für sich raffende ICH ist zum Prototypen geworden. Jenes, das eine vom anderen losgelöste eigennützige Selbstbestimmung zunehmend zum erklärten Ziel macht, koste es, was es wolle. Wir haben alle dabei mitgemacht, ich auch. Wir waren als die Erben der 68er unterwegs. Gerade in unseren studentischen Zirkeln, denen früher eine Zeit der Bildung, nicht nur Ausbildung, zugestanden wurde, war der Raum vorhanden, sich gesellschaftlichem Umdenken zur zentralen Bedeutung des Individuums im Spannungsfeld atmosphärischer und politischer Prozesse experimentell zu widmen. Das ICH und seine selbstzentrierte Entwicklung wurde zum Dogma. Die unterschiedlichsten, uns in ihrer Bedeutung damals gar nicht bewussten und aus heutiger Perspektive lächerlich anmutenden Blüten begleiteten diesen Prozess. Selbstuntersuchungsgruppen waren Anfang der 80er-Jahre zum Beispiel der große Renner, auch wenn wir sie heute alle in tiefen Winkeln unseres Gedächtnisses vergraben haben. Mit der damaligen Bibel »Getting Clear« ausgerüstet und mit Plastikspekulum und Spiegel bewaffnet, nahmen wir als junge, aufklärerischer Selbstbestimmung verpflichtete Frauen in kuscheliger Gruppenatmosphäre die Tiefen unserer Weiblichkeit in anatomischen Besitz. Wir setzten zugleich ein kämpferisches Signal gegen eine männlich-chauvinistisch besetzte Frauenheilkunde, diskutierten Masters und Johnsons Sexualreport und explorierten den technisch korrekten Zugang zu UNSEREM Orgasmus, der ganz alleine uns gehörte und den wir unseren Müttern als Vertreterinnen einer kollektiven, repressiven Sexualmoral gleich vorweg abgesprochen hatten.
Heute bin ich mir dabei allerdings gar nicht mehr sicher, ob es unsere Mütter unter ihren pludrigen Daunenbettdecken mit unseren Vätern nicht mindestens ebenso spannend hatten und dieses Gefühl der Befriedigung, woraus auch immer es sich zusammensetzt, genauso erlebten wie wir, ihre sich um demonstrative Selbstbestimmung abmühenden Töchter.
Auch die Gestaltpsychologie nahmen wir in unseren Dienst und interpretierten die berühmte Aussage »Ich bin nicht da, um deinen Erwartungen zu entsprechen und sie zu erfüllen und du nicht, um die meinen zu bedienen«, gleich dergestalt um, dass wir den ersten Teil als argumentatives Mantra vor uns hertrugen und der zweite Teil in der täglichen Beziehungsabwicklung elegant unter den Tisch rutschte. In Wirklichkeit war unser Verhalten der Vorbote eines Infantilisierungsprozesses, in dem das losgelöste ICH bekommen, aber nicht geben will und raffiniert alle zur Verfügung stehenden Register zieht. Aber damals spürte sich dieser kollektive EGO-Trip einer sich intellektuell wähnenden Speerspitzenschicht sozialpsychologischer Heroen großartig an. Wir knusprigen 20-Jährigen saßen mit 15 oder 20 Jahre älteren respektablen, die große Welt verkörpernden Männern und ein paar gleichaltrigen Burschen in unseren Gestaltgruppen, während die dazugehörigen Frauen, einem nach wie vor sehr traditionell aufgesetzten Rollenbild entsprechend, daheim die Aufzucht der Kinderschar ohne eigenes Einkommen besorgten. Wir arbeiteten fieberhaft am Herausdestillieren UNSERER Bedürfnisse. Naheliegend, dass wir ziemlich häufig auf die fast magisch geschmeidig anmutende Übereinstimmung unserer wechselseitigen Bedürfnisse und bereitwillige Kooperation in ihrer Erfüllung mit diesen Männern stießen. Wir schienen mit dieser freien Selbstbestimmung in Zeiten, in denen wir an AIDS noch vorbeisehen konnten und uns die Pille breitflächig zur Verfügung stand, eindeutig den Stein der Weisen gefunden zu haben, zumindest in unseren Selbsterfahrungsgruppen. Während den uneinsichtigen, reklamierenden Ehefrauen attestiert wurde, Zwang ausüben zu wollen und in ihrer ICH-Entwicklung eindeutig nicht mehr am Puls der Zeit zu stehen. Das hat eine Menge der heute 70,75 Jahre alten Frauen produziert, die damals unter dem Druck wirtschaftlicher Abhängigkeit und traditioneller Rollenbilder laut hörbar die Zähne zusammenbissen, um heute wenigstens ihre gesicherten Witwenpensionen beziehen zu können.
Unterstützt und, meinem Empfinden nach, im kollektiven Unbewussten weiter fest verankert wurde dieses »losgelöste, zunehmend nur mehr sich selbst wahrnehmende ICH« durch die Entwicklungen der Weltpolitik. Ein rundes Vierteljahrhundert ist es her, dass die großen Blöcke aufgelöst, der Kampf des Westens mit dem Osten zu Ende gegangen ist und die letzten autokratischen Regime in unserer Nachbarschaft zum Sturz gekommen sind. Wir haben es alle live mitverfolgt und diesen historischen Wendepunkt freudentaumelnd gefeiert. Berechtigt, denn der Westen stand für die große Freiheit des selbstbestimmten Individuums, der Osten für ein repressives, die Seele des einzelnen Menschen verkrüppelndes und staatlichen Zwängen unterwerfendes System, das Individualität unterband. Auch wenn bei differenzierter Betrachtung durchaus Bedenken zu dieser Generalinterpretation anzumelden sind. Der Westen verfügte vielleicht nur über diffizilere, unterschwellig manipulative Vermassungsmethoden. Und in autokratischen Systemen erfolgte in selbstgeschaffenen Enklaven in manchen Bevölkerungssegmenten auch sehr bewusste Individualisierung. Dennoch genießt diese schwarz-weiße Sichtweise den Status von Wahrheit. Ja, und – nicht zu vergessen –, wir und all jene sind die Gewinner, denen es gelungen ist, unsere Denke und die ihr zugrunde liegenden Überzeugungen und Glaubensgrundsätze raschestens zu übernehmen. Das sind jene, die heute zum Beispiel in Bukarest in ihren Hummer-Limousinen oder Porsche-Cabrios an dreckigen verkrüppelten Straßenkindern vorbeidüsen, die sich darum balgen, ihre Windschutzscheiben putzen zu dürfen.
Der Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus steht gleichzeitig für die Überlegenheit des Individuums über das Kollektiv und wurde somin eindrucksvoll demonstriert. Damit hat allerdings gleichzeitig die Ideenwelt eines banalen Materialismus den Siegespreis errungen. Unser kapitalistisches Glaubensbekenntnis, eingemeißelt in unser Hirn und uns aufgeschweißt als scheinbar zwingender Filter und als Organisationsprinzip unseres Erlebens, ist der Dreifaltigkeit von Konsum, Steigerung und Konkurrenz verpflichtet und unser wirkliches tägliches Nachtgebet. Ein echter historischer »Booster« für unser kollektives Unbewusstes. Die Botschaft, dass wir die Krone der Schöpfung wären, hört sich in den letzten 25 Jahren zunehmend glaubwürdig und Lebensglück verheißend an. Und zwar nicht im Kollektiv, mit vereinten Kräften, und jeder auf jeden ein wenig schauend, damit sich die Kompetenzen und Fähigkeiten in einem derart fördernden Klima multiplizieren mögen, wie man es in zahlreichen gruppendynamischen Arbeitssettings beforscht hat. Sondern jeder für sich genommen und ganz auf sich allein achtend.
Und wir dürfen nicht vergessen, wie sehr uns diese Sichtweise schmeichelt. Werbung ist ein guter Indikator für gesellschaftliche Überzeugungen, denn Werbung muss dort abholen können, wo jeder Einzelne gerne wäre. Und die Werbung suggeriert uns nicht nur Einzigartigkeit, sondern vielmehr Großartigkeit. »Nimm dir, was du brauchst, nur das Beste ist gut genug für dich«, war eine äußerst erfolgreiche Botschaft, die wir alle gerne angenommen haben.
Schrittweise begann dieses zunehmend aus der Gemeinschaft in seiner Selbstverortung losgelöste ICH immer selbstsüchtigere Züge anzunehmen. Wir sprechen heute routinemäßig vom »gesunden« Egoismus im Brustton akzeptierter Wahrheit und meinen damit eigentlich bereits selbstbespiegelnden Narzissmus. Wenn mir eine junge Patientin und ehrgeizige Studentin an der Wirtschaftsuniversität von den hohen Durchfallquoten bei Prüfungen erzählt und mit großer Befriedigung hinzufügt, dass damit Konkurrenten um zukünftige Jobs ausscheiden, wird diese Überlegung nicht vom klitzekleinsten Einwand einer möglichen zarten Kameradschaft hinterfragt. Man muss die Nase eben immer vorn haben. Je mehr zurückbleiben, umso besser. Ist doch logo.
Ich frage mich allerdings mit einem leichten Kälteschauer, welches Klima unter Studenten heute wohl herrschen mag. Arbeitsbündnisse werden nur mehr nach unmittelbarem persönlichem Nutzen eingegangen. Nicht wie in unserer Zeit, als wir einander bei der Präparation der anstehenden Regionen bei der Leichensektion einfach unter die Arme griffen, wenn es für einen von uns einmal eng wurde und er sonst aus dem Kurs zu fallen drohte. Wir sahen einander nicht als potentielle Konkurrenten um eine zukünftige Arbeitsstelle, sondern als zukünftiges, in gemeinsamen Erlebnissen gewachsenes Kollegennetzwerk in einem, sicher naiv beseelten, »Kampf gegen Krankheit«.
Doch diese Haltung der Orientierung am Eigeninteresse erfuhr im euphorischen Klima des siegreichen Kapitalismus immer mehr die Zuschreibung evolutionärer Tauglichkeit. Während die Idee, Kollektivinteressen voranzustellen, zunehmend mehr in den Ruf einer rückwärtsgewandten, untauglichen Verstaubtheit geriet. Die unproduktiven und oft in skurriler Weise Leistung vorspiegelnden Kombinate und Kolchosen des ehemaligen kommunistischen Systems, dienten gerne als Referenz für die Unbrauchbarkeit einer Gesellschaft, die für die Entwicklung von Eigeninitiative, Entrepreneurship und Wettkampf zu wenig Raum gewährt, die Entwicklung von Individualität also blockiert hatte. Das klang vollkommen logisch in unseren Ohren. Und es hat in der Folge einem brutalen Raubtierkapitalismus den Boden geebnet. Man hätte allerdings hier auch genauer hinschauen können, um festzustellen, dass das eigentliche Gegensatzpaar nicht Kommunismus versus Kapitalismus heißt, sondern extraktives versus inklusives Wirtschaftskonzept.
Sowohl der Lebenszyklus aller Wirtschaftshabitate auf dem gesamten Globus, wie auch die historische Längsschnittbeobachtung der jeweiligen Entwicklung eines Staates oder Gebietes, legen nahe, dass weniger die auf die Flagge geheftete und benannte Ideologie eines Systems entscheidet, sondern vielmehr der Modus, wie diese gelebt wird. In extraktiven Gebilden, die auf die Bereicherung einer kleinen Nomenklatura, egal unter welchem Titel oder unter welchem Kleid versteckt, ausgerichtet sind, erlebt der Einzelne wenig Anreiz, innovativ und selbstbeteiligt zu sein. Alle Strukturen sind dort darauf ausgerichtet, die Früchte seiner Initiative und seines Einsatzes nicht in gerechter Form zwischen ihm und einer Gemeinschaft aufzuteilen, sondern durch ein zwingendes, oft an willkürlichen Kriterien eines Regelwerkes geknüpftes Verteilungssystem, nur einer kleinen Minderheit zukommen zu lassen.
In inklusiven Systemen ist das wirtschaftstragende Regelsystem dagegen darauf ausgerichtet, möglichst vielen Menschen Anreiz und Remuneration für ihre Beteiligung und Leistung zukommen zu lassen und in gerechter Form für die Schwächsten zu sorgen. Wir hätten also anlässlich des Zusammenbruchs des kommunistischen Systems vielleicht nicht unbedingt in arroganter Siegeslaune den Triumph des kapitalistischen Wirtschaftssystems stupide abfeiern, sondern uns vielmehr etwas genauer die dahinter stehenden Mechanismen ansehen sollen, um für unsere eigene Zukunft zu lernen. Aber sich selber zu feiern ist natürlich viel kurzweiliger, als sich die Ärmel aufzurollen. Aus der Niederlage eines anderen Selbstbestätigung und Bekräftigung für die eigene eingeschlagene Richtung zu beziehen, fühlt sich eben so viel bequemer an, als kritisch mit sich selbst zum eigenen Tun die jeweils notwendige begleitende Gewissenserforschung zu betreiben.
Und so haben wir zuerst leise und versuchsweise und dann immer lauter und selbstverständlicher behauptet, dass »Wirtschaft eben Krieg« ist, ein »zu akzeptierender Verdrängungskampf«. Wir haben damit einen elenden Vulgärdarwinismus unter dem geliehenen Banner des »survival of the fittest« mit neoliberaler Haltung installiert. Und wer dagegen ist, outet sich als Weichei und Warmduscher. Deswegen hören wir im zum Nachdenken anregenden, 2013 erschienenen Film »Alphabet« von Erwin Wagenhofer einen Manager auch unwidersprochen von Konkurrenzorientierung als allerwichtigstem Kriterium für seine Auswahl nachwachsender Jungmanager sprechen. Alles andere sei unnötiges Brimborium. Beinharte Killer-Mentalität gehört, seiner Meinung nach, herangezüchtet. Damit es auch für alle klar wird, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben, wenn sie im Rattenrennen um die besten Plätze vorne liegen sollen.
Immer mehr entstand in den letzten Jahren eine Rechtfertigungsideologie, die logische, wenngleich Züge von Unmenschlichkeit tragende Mechanismen im Wirtschaftsleben als scheinbar unumgänglich für die »evolutionäre Fitness« darstellt. Vordergründig war von einer »Befreiung des Marktes von Regulation« die Rede, dem freien Spiel der Kräfte, die den härtesten, schnellsten, gefräßigsten, schärfsten, rücksichtslosesten, also egoistischsten und damit besten Mitspieler in einem evolutionären Sinn den gerechtfertigten Sieg davontragen lässt. Sorry, tut leid, aber so funktioniert die Welt, das ist das Prinzip der Evolution. Da kann man dann nicht wirklich etwas entgegensetzen, wenn einem eine Haltung als Naturprinzip verkauft wird. Gleichzeitig wird damit Gefühlen der Stellenwert einer Behinderung gegeben. Denn da ist eben kein Platz für Gefühle, sonst bist du weg vom Fenster, einfach gefressen. Gefühle kann sich im Wirtschaftsleben ein verantwortlicher Manager gar nicht erlauben. Es wäre nahezu sträflich, Entscheidungen nicht emotionsbereinigt treffen zu wollen. (Ge)Fühllosigkeit wird so ein evolutionär definierter Erfolgsfaktor.
Ein fataler, wenngleich für ein paar Wenige äußerst lukrativer Denkfehler. Dem hätte Martin A. Nowak, Professor für Biologie und Mathematik in Harvard, in seinem gemeinsam mit Roger Highfield herausgegebenen Buch »Super Cooperators, Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other to Succeed« einiges sehr schlüssig entgegenzusetzen. Doch auf die Mahnungen von Wissenschaftlern wie ihm oder Richard Wilkinson, der in 30-jähriger Forschung die überragende Bedeutung von Verteilungsgerechtigkeit für unser aller psychische wie physische Gesundheit demonstriert, vermögen die wenigsten von uns zu hören. Das hat mit der sozialpsychologischen Wurzel des losgelösten, fühltauben ICHS zu tun. Und mit jenem kleinen Jungen, der uns im nächsten Kapitel begegnen wird, und der übrigens bevorzugt auf den Spielplätzen von Macht, Politik und Einfluss zu finden ist.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.