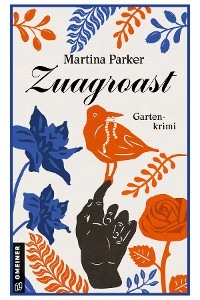Kitabı oku: «Zuagroast», sayfa 4
Finz räusperte sich und fuhr sich mit der Hand durch sein dichtes braunes Haar.
»Das Wichtigste, was ihr wissen solltet, ist, dass Erde ein Lebewesen ist. Unterirdisch wird zehn Mal so viel Leben ernährt wie oberirdisch. Pro Hektar gibt es 25 Tonnen Bodenleben – sofern die Erde intakt ist. Aber die klassische Landwirtschaft laugt den Boden aus. Egal ob Griechen oder Römer, alle großen Kulturen sind früher oder später am Boden gescheitert. Eine Zeit lang konnten sie das kompensieren, indem sie Kriege begannen und andere Länder eroberten. Trotzdem, älter als 1000 Jahre ist keine Kultur geworden. Wenn wir die Erde fruchtbar halten wollen, was gerade in Zeiten der Klimakrise und der Bevölkerungsexplosion ein riesen Thema ist, müssen wir ihr Substanz zurückgeben, und das geht nur über Humusaufbau. In Österreich haben sich bereit 3000 Landwirte diesem Ziel verschrieben, aber jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er anfängt, zu Hause zu kompostieren.«
Finz hatte eine ruhige Stimme, drückte sich klar aus, schien von dem überzeugt sein, was er vertrat. »Hier«, sagte er und griff zu einem Säckchen Erde, öffnete es und reichte es herum.
»Was ist das?« Vera befühlte den Inhalt mit den Fingern. Er fühlte sich grob und fasrig an und roch leicht nach Torf. »Fühlt sich an wie ganz normale Blumenerde.«
»Richtig«, sagte Finz und zog die Stirn in Falten. »Nur dass Blumenerde zumeist gar keine echte Erde ist, sondern ein Mix aus Torf und Nährstoffen. Torf – dafür werden jahrtausendealte Moorlandschaften zerstört. Das hat nichts mit Erde zu tun. Das ist tote Materie. Gemüse, das darauf angebaut wird, schmeckt fad. Es gibt sogar Wissenschaftler, die glauben, dass unsere modernen Zivilisationskrankheiten daher kommen, dass wir unser Gemüse auf künstlichem Substrat ohne jede Art von Bodenlebewesen anbauen. Und jetzt schaut euch das an.«
Das zweite Säckchen machte die Runde. Diesmal war der Inhalt feuchter, krümeliger. Die Erde wirkt irgendwie fetter, dachte Vera, echter.
»Das ist Kompost. In dieser Handvoll Erde stecken acht Milliarden Kleinstlebewesen.« Eva, die das Säckchen in der Hand hielt, zuckte erschrocken zurück, als hätte sie einen Sack voller Flöhe geöffnet. »Keine Angst, die beißen nicht«, sagte Finz und grinste. Eva lief rot an.
»Wer von euch hat einen Komposthaufen daheim?« Alle bis auf Vera zeigten auf. »Und was kommt da alles drauf?«
»Küchenabfälle«, sagte Mathilde.
»Zeitungen, Gartenabfälle, Grünschnitt, Laub«, ergänzten die anderen. Die burgenländischen Landfrauen schienen allesamt Kompostexpertinnen zu sein.
»Und was darf keinesfalls drauf?«, fragte Finz.
»Gespritzte Zitrusfrüchte, Unkraut, das Samen trägt, und Fleischabfälle«, sagte Vera, stolz, die Antwort zu kennen. Sie hatte zwar keinen Komposthaufen, aber einmal einen Artikel darüber geschrieben.
»Falsch«, sagte Finz. »Das liest man zwar überall, aber es ist Blödsinn. Alles Organische kann kompostiert werden. Der Kompost muss nur heiß genug werden. Dann werden Spritzmittel abgebaut, Samen getötet. Und Fleisch verfault nicht, sondern kompostiert. Und heiß wird euer Komposthaufen, wenn ihr ihn richtig aufsetzt. Ich kann euch den YouTube-Kanal ›Erdgeflüster‹ empfehlen, schaut euch den einmal an, da gibt es einen Film zur richtigen Anleitung.«
»Erdgeflüster«, flüsterte Vera Eva zu. Sie kam sich gerade vor wie eine schlechte Schülerin, die vom Lehrer getadelt wurde, und reagierte auf dieses peinliche Gefühl mit der gleichen Übersprungshandlung wie früher in der Schule: Sie begann, mit ihrer Sitznachbarin zu tratschen. Aber Eva ließ sich nicht darauf ein, sie nickte nur und schrieb eifrig weiter.
»Wenn ihr Heißkompost richtig herstellt, könnt ihr sogar kranke Pflanzen kompostieren, zum Beispiel Tomatenranken, die die Braunfäule haben«, erklärte Finz. »Die Natur findet dann eine Lösung, bildet aktive Gegenspieler im Kompost, so geht moderner Pflanzenschutz. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis sind die meisten Komposthaufen reine Abfallhaufen. Merkt euch eines: Wenn es stinkt, ist es kein Komposthaufen. Zu viel Rasenschnitt, zu viele Küchenabfälle, dann beginnt es zu stinken und zu faulen. Und das zieht dann nur die Schnecken an.«
Schnecken, immer nur Schnecken, dachte Vera. Irgendwie waren diese Viecher allgegenwärtig.
Gerade hatte Finz ein drittes Säckchen herumgereicht. Eine schwarze Komposterde, die er selbst nach einem geheimen Rezept der Inkas herstellte.
Nix Poncho und Panflöte. Daher kam also der Name seiner Firma.
Vera studierte Finz und fragte sich, wie es wohl gekommen war, dass ein junger Typ sich dermaßen brennend für Kompost interessierte.
9 Die Straßen sind aus Lehm, aber daheim ist daheim.
10 Ja schau, seid ihr auch schon da, kommt herein und drückt euch einen Kaffee herunter.
11 Jesus, die Schnecken
12 Ich weiß noch genau, wie die erste rote Schnecke in Oberwart eingezogen ist. Im Jahr 1987 war das. Die sind von Bocksdorf über Stegersbach zu uns heraufgekrochen. Ich bin nach hinten in meinen Garten, der beim Bach gelegen ist, und dort hat es nur so gewuselt, alles voller Schnecken. Mir hat es so gegraust.
13 Die Leute haben dann alle ihre Gärten geschleift wegen der Schnecken, weil die ihnen alles abgefressen haben, und dann ist auch die Zeit gekommen, wo sie alles im Supermarkt gekauft haben.
14 Ich hänge immer einen Strumpf mit Hühnermist in die Regentonne, so habe ich gleich ein gedüngtes Wasser. Früher, als ich jung war, habe ich immer die Pferdeäpfel aufsammeln müssen, wenn die Rösser vorbeigekommen sind, aber heute hat ja niemand mehr Pferde im Dorf. Darum habe ich heute die Hühner, und vielleicht nehme ich mir auch noch eine Ziege nach Hause.
Kapitel 5
Finz
Oxytocin gilt als das Hormon, das uns vertrauen lässt. Das Kuschelhormon findet sich nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Pferden, Ziegen und – Goldfischen. Somit ist die Ähnlichkeit zwischen Mensch und entwicklungsgeschichtlich weit entfernten Tieren vermutlich größer, als bislang angenommen.
Jeder Mensch hat eine besondere Begabung. Eine Stärke, Fähigkeit oder Leidenschaft, die seinen X-Faktor bestimmt. Etwas, das ihn einzigartig macht.
Veras X-Faktor war es, Menschen mit ihren Texten zu berühren, Johannas X-Faktor war ihr grüner Daumen, Evas X-Faktor war, dass sie durch ihre Sensibilität viel mehr wahrnahm als andere Menschen. Der X-Faktor von Serafin, den alle nur Finz nannten, war Sex.
Es war ihm lange nicht bewusst gewesen, dass er ausnehmend gut im Bett war. Wie hätte er sich auch messen und vergleichen sollen? Er merkte es einzig an den Reaktionen der Frauen, mit denen er schlief, die ihm eher früher als später allesamt verfielen. Sogar und gerade die, die ihn zuvor überheblich behandelt und unterschätzt hatten.
Tatsächlich war an Finz auf den ersten Blick nichts Besonderes. Ein Phantombildzeichner hätte wohl lange vergeblich nach seinen speziellen Merkmalen gefahndet. Finz war mittelgroß, mittelschwer, hatte mittelbraunes Haar. Er war weder besonders schön noch besonders hässlich. Er war fast schon auffällig unauffällig. Aber wenn es um Erotik ging, machte ihm niemand etwas vor. Er konnte Frauen lesen wie ein Buch. Er spürte ihre Wünsche, noch bevor die Frauen sich dieser bewusst waren. Wenn er mit ihnen intim war, ließ er sich von ihrem Atem leiten. Dieser verriet ihm immer, was den Frauen gefiel. Er fachte ihre Lust an, und statt sie zu erlösen, ließ er sie für eine gefühlte Ewigkeit in brennender Agonie schweben. Er weckte unbändiges Verlangen und ließ sich jede Menge Zeit, um dieses zu stillen. Und wenn er es dann endlich tat, führte er die Frauen zu orgiastischen Gipfeln und erotischen Abgründen, die jenseits ihrer bisherigen Vorstellungskraft lagen.
Alle Frauen reagierten auf den Sex mit Finz auf die gleiche Weise: Sie verwechselten Lust mit Liebe. Sie wollten es noch mal erleben, und noch mal und noch mal. Ihre Geilheit überschritt durch Finz’ X-Faktor alle Grenzen. Die Frauen taten schon nach kürzester Zeit Dinge mit ihm, die sie sich niemals hätten träumen lassen. Das schockierte sie. Und deshalb suchten sie nach einer Lösung, um das, was sie taten, vor sich selbst moralisch zu rechtfertigen. Der Ausweg hieß Liebe. Jede einzelne Frau, die Finz vögelte, verliebte sich in ihn. Und jedes Mal geschah es mit einer Heftigkeit, die Finz Angst machte und ihm die Luft zum Atmen raubte.
In der Schulzeit hatten ihn die Mädchen, mit denen er geschlafen hatte, an der Bushaltestelle abgepasst, ihn mit Zettelchen und Anrufen bombardiert. Jetzt war Finz 31, und seine Wirkung auf Sexpartnerinnen hatte sich nicht verändert, nur die Methoden ihres postkoitalen Aufmerksamkeitsterrors – dank WhatsApp, Facebook, Messenger und Instagram.
Wäre Finz’ X-Faktor nicht Sex gewesen, hätte er vermutlich irgendwann eine ganz normale Beziehung gehabt, die sich langsam und natürlich entwickelt hätte. Er hätte die Zeit und den Raum gehabt, selbst tiefere Gefühle aufzubauen. Durch die heftigen Reaktionen der Frauen fühlte er sich aber innerhalb kürzester Zeit emotional so bedrängt, dass er nur einen Gedanken hatte: Flucht.
Das alles hatte in der Vergangenheit zu unschönen Szenen geführt: Vorwürfe, Tränen, Beschimpfungen. Frauen, die behaupteten, er würde sie nur ausnutzen.
Eine Aussage, die Finz paradox erschien. Sie wollten ihn ja immer und immer wieder.
Eine Zeit lang hatte er sich ganz von Frauen ferngehalten. Aber ein Talent, das ein X-Faktor ist, lässt sich nicht langfristig unterdrücken. Durch Zufall fand er die Lösung für sein Problem. Und diese Lösung hatte ihren Ursprung in Finz’ Kindheit.
Finz’ Vater war ein Künstler gewesen, bekannt für seine ausdrucksstarken Porträts im Stil des Russen Yaroslav Kurbanov. Als Elfjähriger hatte Finz stundenlang vor den halbfertigen Kunstwerken gestanden. Eines hatte es ihm besonders angetan: Es zeigte eine Frau mit großen flehenden Augen, die verschwörerisch einen Finger auf ihre Lippen legte. So, als würde sie den Betrachter bitten, ihr Geheimnis niemandem zu verraten. Die Frau auf dem Bild faszinierte Finz. Er kam täglich heimlich ins Atelier, um sie zu betrachten. Er suchte nach einer Möglichkeit, mit ihr in Verbindung zu treten. Irgendwann wusste er, wie. Er griff zum Pinsel und malte an einer unauffälligen Stelle einen winzigen Punkt in das Bild. Als der Vater am nächsten Morgen ins Atelier ging, hatte Finz Todesangst. Würde der Vater etwas bemerken? Finz wusste, dann würde ihm ein riesen Donnerwetter drohen, vielleicht sogar Schläge. Aber der Vater bemerkte nichts. Und als die »Frau mit Geheimnis« vollendet war, war Finz’ geheimer Punkt für immer ihr und sein Geheimnis.
Finz wiederholte seine Tat fortan bei jedem Porträt seines Vaters, das ihm gefiel. Es bescherte ihm eine heimliche Freude, unbemerkt Teil der Bilder zu werden. Jetzt, rund 20 Jahre später, tat er eigentlich genau dasselbe. Er war der geheime Farbtupfer im Leben von Frauen, die nicht ihm gehörten.
Er datete ausschließlich verheiratete Frauen. Finz schätzte diese geheimen Liaisonen, weil sie ihm genug Freiraum ließen. Verheiratete Frauen wollten und konnten ihn nicht jeden Tag sehen. Jedes Telefonat, jede Textnachricht war für sie ein potenzielles Risiko, ihren Mann, ihre Kinder, ihre Existenz zu verlieren. Der Kontakt musste deshalb auf ein für beide Seiten zuträgliches Maß beschränkt werden. Und das Beste: Verheiratete Frauen wollten weder bei ihm einziehen noch wollten sie ihn groß verändern oder ihm vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hatte. Das gefiel ihm. Denn er mochte sein Leben, so wie es war.
Finz hatte sich lange Zeit gelassen, erwachsen zu werden. Dann hatte er durch Zufall einen Job gefunden, der ihn nicht zu sehr forderte, aber abwechslungsreich genug war, um ihn nicht zu langweilen. Bei einer seiner Reisen in den Amazonas Regenwald war er im wahrsten Sinne des Wortes darüber gestolpert. Er flog bei einer Dschungelwanderung über eine Bodenunebenheit und landete in schwarzem Dreck. Sein Guide erzählte ihm, das sei Terra Preta – die geheime Schwarze Erde.
Im Regenwald entlang des Amazonas ist ein ganz bestimmtes Gebiet meterdick mit dieser schwarzen nährstoffreichen Erde bedeckt. Man konnte sich ewig nicht erklären, wie die dort überhaupt hingekommen war, denn geologisch hätte das Gebiet Wüste sein sollen. Wissenschaftler fanden dann nach langem Suchen eine Erklärung: Die Inkas hatten diese Indianererde aus Holz- und Pflanzenkohle, Tonscherben, Knochen, Fischgräten und tierischen und menschlichen Fäkalien über Jahrhunderte geschaffen, um den nährstoffarmen Boden am Amazonas fruchtbar zu machen. Das »Warum« war nun geklärt. Mit dem Aussterben der Ureinwohner war aber das genaue Wissen über das »Wie« verloren gegangen.
Kohle, Küchenabfälle und jede Menge Scheiße. Finz dachte darüber nach, wie er das zu Geld machen konnte. Er musste diese Erde nachbauen. Terra Preta aus Brasilien auszuführen, ist bei Gefängnisstrafe verboten, aber Finz hatte sich schon immer gerne über Gesetze hinweggesetzt. Als sein Guide nicht herschaute, füllte er die Taschen seiner Cargohosen unbemerkt mit dem Schwarzen Gold.
Zurück in Österreich recherchierte er das Potenzial der Inkaerde als natürlicher Dünger, und das, was er herausfand, war vielversprechend. »In Terra Preta gepflanzte Tomaten bringen viermal mehr Ertrag«, las er. »Ist der Kohlenstoff einmal im Boden, bleibt er mehr als 1.000 Jahre verfügbar. Ein Perpetuum Mobile der Fruchtbarkeit.«
War das nicht genau die Sache, die man all diesen Zuagroasten, die für jeden Bioscheiß ein Vermögen ausgaben, teuer verkaufen konnte?
Finz versuchte, aus verkokelter Grillkohle, Biomüll und seiner eigenen Pisse Terra Preta herzustellen. Ein Experiment, das nicht sofort von Erfolg gekrönt war. Er brauchte einen Profi als Partner und fand diesen. Der Bruder eines alten Schulfreundes, der im Südburgenland eine Biomasseanlage betrieb und Klärschlamm und Grünschnitt der umliegenden Gemeinden kompostierte. Der Betreiber der Kompostanlage war es längst leid, immer nur den Dreck anderer zu entsorgen. Finz konnte ihn für die Idee, gemeinsam lokale Inkaerde herzustellen, im Nu begeistern. Drei Jahre lang tüftelten die beiden an dem ultimativen Rezept für ihr Schwarzes Gold. Dann war die Inkaerde marktreif.
Ein tolles Produkt, eine Geschichte, die man super vermarkten konnte. Die Lokalpresse war begeistert. Die Zuagroasten waren es auch. Sie zahlten, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Euro pro Liter Schwarzerde.
Finz kam mit dem Liefern gar nicht mehr nach. Er schaffte sich einen alten Pick-up mit großer Ladefläche an, um der ständigen Nachfrage nachkommen zu können. Um Geld musste er sich nun keine Sorgen mehr machen. Um sein Sexleben auch nicht. Denn das Gros seiner Kundinnen waren verheiratete Frauen.
Trauerarbeit
Akt 3
Am Tag der Beerdigung war ich richtig wütend. Ich fand die Grabrede verlogen, das Essen beim Leichenschmaus billig, das Wetter unangemessen. Es waren nur Kleinigkeiten, aber ich wusste, was mich wütend machte. Diese Heuchelei.
Irgendwann habe ich diese Farce nicht mehr ertragen und gesagt, was ich mir denke. Da haben sie mich weggebracht. Als ob ich einen Fehler gemacht hätte. So kann man mit mir nicht umgehen. So nicht!
Kapitel 6
Vera zu Besuch bei Paul und Eva
Bei den Laubenvögeln bauen die Männchen eine Art Verführungstheater, eine Laube, die sie mit hübschen Gegenständen wie Blumen, Schmetterlingen oder weißen Steinen ausstatten. Seidenlaubenvögel errichten solche Lauben mit zwei parallelen Wänden. Das Weibchen sitzt dazwischen und schaut vorn heraus. Wenn das Männchen sich paaren will, muss es um die Laube herumgehen, um das Weibchen von hinten zu besteigen. Aber wenn ihr das nicht gefällt, schlüpft sie einfach zur Vorderseite wieder hinaus.
Gepflegte Unterkühltheit, moderne Sachlichkeit – dafür steht die Bauhaus-Schule auch noch 100 Jahre nach ihrer Gründung. Was 1919 in Weimar als Experiment begann, um Kunst und Handwerk zu verbinden, entwickelte sich zu einer einflussreichen Stilrichtung, die die Architektur bis heute prägt. Der Bauhausstil: nüchtern, schnörkellos, reduziert. Betonkästen. Flachdach. Fertigteile. Glatte Fassaden. Glasvorhänge.
Erschwinglicher Wohnraum war knapp in der Weimarer Republik. Bauhaus-Gründer Walter Gropius schien die Antworten zu kennen. Er brüstete sich mit der Aussage, er könne preiswerten Wohnraum für alle schaffen. Die Stadtväter von Dessau waren begeistert und beauftragten ihn 1926, eine Wohnsiedlung zu bauen. Das Ganze sollte ein Vorzeigeprojekt werden. Modern, sozial, günstig. Denn Gropius hatte versprochen, billiger zu sein als die Konkurrenz – und schneller. Häuser quasi am Fließband. Das Tempo, in dem diese Siedlung aus dem Boden wuchs, war tatsächlich atemberaubend – in kürzester Zeit entstand Wohnraum für Tausende Menschen. Doch schon bald nach dem Einzug bemerkten die Bewohner massive Baumängel. Die Wärmedämmung war miserabel, die Wände viel zu dünn. Risse entstanden. Die Reparatur- und Umbaukosten verschlangen mehr Geld, als geplant. Das Sozialprojekt wurde zu einem sozialen Problem. Es eskalierte. Die Sozialdemokratie wandte sich vom Bauhaus ab. Und Gropius verließ die Stadt und das Bauhaus.
Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Hätte Paul nur sein Architekturstudium beendet. Vielleicht wäre er dann klüger gewesen. Doch so wiederholte sich die Story eins zu eins bei ihm und seinem »Seewinkler Inselparadies«.
Paul war von dort weggezogen. Er hatte seine Baufirma in den Konkurs geschickt und am nächsten Tag als Planungsunternehmen neu gegründet. Er war jetzt als One-Man-Show unterwegs. Er war ein Visionär: Planen, konzipieren, andere begeistern – das konnte er immer schon besser, als Sachen praktisch umsetzen. Er hatte die Baumängel auf die Subfirmen geschoben. Es gab ein paar Bürgermeister und Kommunalpolitiker, die viel Geld und eine Menge Wählerstimmen verloren hatten, und denen er besser nicht mehr über den Weg lief. Aber mitgefangen hieß mitgehangen. Wer mit Paul gepackelt hatte und sich auf korrupte Grundstücksbeschaffungen und -umwidmungen eingelassen hatte, hielt die Goschn. Fakt war: Paul war ohne größeren persönlichen Imageschaden aus der ganzen Sache herausgekommen.
Nur die Käufer gaben keine Ruhe. Es war schon gut, dass er jetzt in Buchschachen saß.
Paul pfiff fröhlich vor sich hin, während er sich anzog. Er wusste immer schon, wie er sich am besten in Szene setzte. Für das heutige Treffen mit dem Zieserl und dem Bürgermeister wählte er einen kakifarbenen Anzug von Dsquared2, dazu ein hellblaues Hemd über einem weißen T-Shirt, beides von Arket, und teure weiße Sneakers von Yeezy. Er war sicher, dass diese Marken den Hinterwäldlern hier nichts sagten, deshalb band er sich seine Vintage Rolex ums Handgelenk. Ein diskreter Hinweis für die ganz Blöden, dass er ein Erfolgstyp war.
Er sprühte sich ein bisschen Terre d’Hermès auf, fuhr sich durch die Haare und betrachtete sich zufrieden im Spiegel. Die Irene, mit der er im Nordburgenland ein Pantscherl gehabt hatte, hatte gemeint, er sähe ein bisschen aus wie eine Mischung aus Leo Hillinger und Ryan Gosling, nur mit längeren Haaren. Sie war unglaublich verbrunzt in ihn gewesen. An die Irene hatte er jetzt schon länger nicht mehr gedacht. Aber die würde sich eh auch nicht mehr so schnell bei ihm melden. Schade eigentlich, er hatte sie gemocht. Sie war lustig und unkompliziert gewesen.
Eva beobachtete Paul, wie er sich umständlich fertig machte. Könnte er bitte endlich das Haus verlassen? Sie hatte Vera und Johanna eingeladen, weil sie ein paar Fragen zu den Obstbäumen hatte, die sie gekauft hatte und in den nächsten Tagen pflanzen wollte. Und sie wollte partout nicht, dass die beiden Paul in die Arme liefen.
Paul bemerkte, dass Eva ihn beobachtete.
»Du stehst grad so gemütlich, mach mir noch einen Kaffee, bevor ich fahr«, feixte er.
Eva lief zur Küchenzeile und tat, wie ihr geheißen. Die Anrichte war schon wieder voller Fliegen, dabei hatte sie nur kurz gelüftet.
Es läutete an der Tür. Evas Gebete waren nicht erhört worden. Die Gäste waren schon da. Überpünktlich wie alle hier im Süden. Sie öffnete.
»Wer ist da?«, fragte Paul.
»Johanna und Vera vom Gartenklub.«
Paul bedachte den Besuch nur mit einem flüchtigen Blick und einem kurzen Hallo, hörte aber ganz genau zu, als Eva die beiden begrüßte und das Gespräch begann.
Paul hielt sich nicht nur für einen ausgezeichneten Menschenkenner, sondern insbesondere für einen hervorragenden Frauenkenner.
Sein Urteil zu den beiden lautete schlicht: »Uninteressant.« Die eine mit den grünen Holzpantoffeln, dem Leinenkleid und den roten Haaren fiel für ihn in die Kategorie »burgenländische Landpomeranze«, die andere, eine schlanke Brünette mit Pferdeschwanz, sah zwar nicht schlecht aus, wirkte aber so, als ob sie gerne zurückredete. Und Frauen, die zurückreden, fand er anstrengend.
»Ich lass euch Ladies alleine, ich hab einen wichtigen Termin mit der ›Pannonia Bau‹ und der Gemeinde«, sagte Paul. »Würmchen, du kannst ja die Hausführung machen.«
»Wir wollten in den Garten gehen«, sagte Eva hastig und navigierte ihren Besuch an Paul vorbei.
Der warf demonstrativ lässig seinen BMW-Schlüssel in die Luft und fing ihn wieder auf, während er zur Garage schlenderte. »Vergiss nicht, dass du noch meine Post machen wolltest. Die Förderungsanträge müssen bis nächste Woche raus.«
»Ich weiß«, sagte Eva leicht genervt. Paul machte wieder mal auf: Wer ist hier der Boss? Das war so typisch, dass er sich vor den neuen Freundinnen deppert aufspielen musste.
Yeezy Turnschuhe, der macht wohl auf Berufsjugendlicher. Was für ein Einefetzer, dachte Vera, als sie Paul nachschaute. Dank Letta war sie bei den aktuellen Trendmarken up to date. Die Achleitners müssen echt gstopft sein. Bei Johanna kam die Botschaft überhaupt nicht an. Sie hatte nur Augen für die leuchtend orangegelbe Rose an der Garagenwand. »Eine ›Gebrüder Grimm‹, wie im Märchen, super, dass die hier Halbschatten hat, dadurch bleibt die Blütenfarbe schöner«, bemerkte sie.
Eva war froh über die Ablenkung. »Ich hab ein paar Blüten abgezupft und daraus eine Rosenbowle gemacht, mit Sekt und Erdbeeren. Darf ich euch was einschenken?« Sie verteilte das eiskalte Getränk gleichmäßig in drei bauchigen Gläsern. Vera nahm einen Schluck. Die Bowle schmeckte gut, nicht zu süß, nicht zu stark. Genau richtig für einen Frühlingstag wie heute. »Die Obstbäume, die ich gekauft habe, stehen gleich da drüben. Ich war extra in einer lokalen Baumschule, die auf alte Sorten spezialisiert ist.«
Vera studierte die Etiketten an den Stämmchen. »Klaräpfel, die liebe ich seit meiner Kindheit. Die bekommt man nie im Supermarkt, weil die gleich nach dem Pflücken mehlig werden. Aber frisch vom Baum sind sie knackig und zitronig frisch. Die besten Sommeräpfel der Welt. Und unsere Urlioma hat daraus immer Apfelmus gemacht, zu den Grumperndatschi.«
»Wie, was?« Eva verstand nur Bahnhof.
»Grumperndatschi sind Kartoffelpuffer, und die Urlioma ist die Uroma von der Letta, meine Großmutter. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Wir leben jetzt in ihrem ehemaligen Haus.«
»Du hast nicht ernsthaft einen Holler gekauft«, stieß Johanna überrascht heraus und machte kugelrunde Augen.
»Ja, hab ich«, sagte Eva. »Was ist daran verkehrt? Ich mag Holler. Gekochte Hollerbeeren sind gesund, und aus den Blüten kann man Saft machen.«
»Aber einen Holler kauft man doch nicht.«
»Warum nicht?«
»Ja, weil der eh überall wild aufgeht. Hier drüben zum Beispiel.« Sie zeigte auf ein paar Sträucher auf der anderen Straßenseite. »Da geht man einfach hin und grabt ihn aus.«
Johanna schüttelte verwundert den Kopf. Holler kaufen. Diese Zuagroasten waren wirklich leicht übers Ohr zu hauen. Mehr Geld als Verstand. Aber die kauften ja auch Bärlauch, obwohl die Wälder voll davon waren, und die Löwenzahnsamen, die der Supermarkt seit Kurzem anbot. Wahrscheinlich würden sie auch Brennnesseln kaufen, wenn jemand ein Preispickerl dran anbringen würde.
»Wo sollen denn die Bäume hin?«, fragte Vera.
»Ich hab mir gedacht, ich pflanze sie hier entlang der Mauer«, sagte Eva. »Dann kann ich beim Pflücken auf der Mauer stehen und bequem in die Baumkrone greifen.«
»Der Plan geht aber nur auf, wenn du Hochstämme gekauft hast«, sagte Johanna. »Mittel- und Niederstämme in diesem Alter wachsen nicht mehr in die Höhe, sondern nur mehr in die Breite. Außerdem wird es eh fünf bis sieben Jahre dauern, bis du die ersten Äpfel ernten kannst.«
Eva schwirrte von den ganzen Informationen schon der Kopf. Sie hatte ein abgeschlossenes Studium als Landschaftsarchitektin und schien dennoch von nichts eine Ahnung zu haben. Allerdings hatte sie sich in ihrem Studium eher auf Grünflächen im urbanen Raum konzentriert und sich mehr mit Park- und Alleebäumen beschäftigt als mit den Besonderheiten diverser Obstbäume.
»Zumindest beim Holler geht’s schneller«, tröstete Vera. »Da kannst heuer schon Saft machen.«
Ein Lieferwagen parkte sich vor dem Raumschiff ein. »Das wird der Finz mit der Inkaerde sein«, sagte Eva. »Er hat gesagt, er bringt mir Komposterde für die Pflanzlöcher.«
So schnell sieht man sich wieder, dachte Vera. Und beobachtete Finz, der die Auffahrt heraufschlenderte. Schlendern war das richtige Wort. Alles an Finz war leicht und selbstverständlich. Während die meisten Menschen die Last der Welt auf ihren Schultern zu tragen schienen, schien Finz komplett unbelastet zu sein.
Finz hatte nicht nur die versprochenen Säcke mit Inkaerde dabei, sondern auch einen Plan. »Eigentlich sollte man Bäume im Februar pflanzen, aber die, die du gekauft hast, sind ja nicht wurzelnackt, sondern im Topf, das geht auch jetzt noch. Kann ich mir bitte die Hände waschen?« Finz’ Hände waren vom Hantieren mit den Erdsäcken ganz schmutzig.
»Natürlich, wir können alle reingehen. Ich hab Salzstangerln und ein Verhackertes gekauft, hat jemand Hunger?«
»Und ich hab einen Apfelkuchen mitgebracht«, sagte Johanna und lüftete ihren Korb. »Oder habt ihr geglaubt, ich komm mit leeren Händen?«
Dieses ewige Auftischen hier im Süden wird noch meine Figur ruinieren, dachte Vera. Finz schien diese Angst nicht zu haben, er wusch seine Hände in der Spüle und griff dann ordentlich zu.
Vera fand das Haus beeindruckend, aber nicht ungewöhnlich. Viele ihrer früheren Bekannten in den Wiener Nobelbezirken oder in Klosterneuburg hatten so gewohnt. Offene Designerküche, viel Stein und Edelmetall, edle Ecksofas, dazwischen ausgesuchte Designklassiker wie der Loungechair vom Eames. Teure Bilder an den Wänden und statt einzelner Fenster ganze Glasfronten.
Johanna folgte Veras Blick: »So große Fenster. Die möchte ich nicht putzen müssen.«
»Paul sagt, die Fenster sind mit irgendeinem Lotuseffekt ausgestattet, damit das Wasser besser abperlt«, sagte Eva. »Die Aussicht ist toll, aber umgekehrt kann uns auch jeder reinschauen. Ich komm mir vor wie in der Auslage, vor allem, wenn es dunkel ist. Manchmal fürchte ich mich sogar ein bisschen, wenn ich alleine bin. Aber für Paul kommen Vorhänge nicht infrage.«
Finz beteiligte sich nicht am Gespräch. Ihm waren die Fenster, gelinde gesagt, wurscht. Aber Eva fand er süß. Eva trug dunkelblaue Jeans, die ihre zierliche Figur betonten, weiße Turnschuhe und eine weiße Bluse. Sie sah aus wie eines dieser Models aus der Ralph-Lauren-Werbung. Fehlten nur mehr das Pferd und der Labrador. Er schätzte, sie war fünf, sechs Jahre älter als er selbst. Und verheiratet. Sein Beuteschema.
Zurzeit gab es keine spannende Frau in seinem Leben. Klar könnte er die eine oder andere Ex reanimieren. Aber seine letzte fixe Geliebte hatte mit ihm Schluss gemacht, als sie unerwartet schwanger geworden war. Hoffentlich sah das Kind ihrem Mann ähnlich und nicht ihm.
Er studierte Evas Gesicht. Es war oval und blass. Es waren die Augen, die sie so hübsch machten. Riesige blaue Augen, die aussahen, als würden in ihrer Iris Tausende Saphirsplitter funkeln. Das satte, tiefe Blau war ein spannender Kontrast zu ihrem hellen Teint und ihren dunklen Haaren. Die Augen faszinierten ihn. Es waren Augen, die lachten, aber nicht spöttisch, sondern liebevoll. Verständnisvolle Augen. Finz bemerkte, dass er Eva anstarrte, und wandte schnell den Blick ab.
Die Eingangstür ging auf. Paul stand im Türrahmen. War die Zeit wirklich so schnell vergangen? Er war kaum eine Stunde weg gewesen. Eva bemerkte sofort, dass er schlechte Laune hatte. »Dieser Bürgermeister ist so ein Pleampl«, schimpfte er statt einer Begrüßung. »Null Visionen, der Zieserl und ich werden es jetzt auf der steirischen Seite probieren, die haben hoffentlich mehr im Hirn als die dummen Südburgenlandler hier.«
Eva versank fast in den Erdboden. Ihr war die Szene mega peinlich. »Wer ist das?« Paul hatte Finz entdeckt, der seelenruhig in sein Salzstangerl biss und Paul in aller Ruhe studierte.
Den Typ cholerischer Ehemann kannte er nur zu gut. Dass Paul offenbar ein Arschloch war, tat ihm leid für Eva.
»Herr Kreishofer hat uns Erde geliefert«, sagte Eva.
»In die Küche?«, fragte Paul süffisant. Aber mit einem Lieferburschen wollte er sich ohnehin nicht abgeben. Seine Aufmerksamkeit konzentrierte sich wieder auf seine Frau: »Du warst hoffentlich schon auf der Post?«
»Nein, aber ich wollt … also, ich hab nicht vergessen, ich muss eh gleich los, also, ich fahr eh gleich.« Eva stotterte. Vera überlegte, wie sie die Stimmung entspannen konnte, aber ihr fiel nichts ein. Wahnsinn, war das unangenehm. Sie konnte Evas Verlegenheit fast körperlich fühlen. Die Stimmung war dahin.
Da ergriff Johanna das Wort. »Sie sollten die Wand hinter dem Herd in einer anderen Farbe streichen lassen«, sagte sie freundlich lächelnd zu Paul. »Orange zieht Fliegen an. Das kann im Sommer unglaublich lästig sein.«