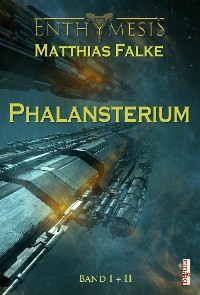Kitabı oku: «Phalansterium», sayfa 4
Wir hatten Wert darauf gelegt, dass kein großer Bahnhof stattfand. Die lokale Kaserne schickte einen jungen Stabsoffizier, der uns gelangweilt in Empfang nahm. Er geleitete uns durch die Kontrollen und brachte uns nach draußen. Dort reichte er uns an einen einheimischen Zivilangestellten weiter. Es war ein junger Bursche von achtzehn oder neunzehn Jahren. Sein Name war Tashi. Er steuerte einen viersitzigen Scooter, in dem wir mit unserem bescheidenen Gepäck bequem Platz fanden. Dann brausten wir auch schon nach Norden.
»Ich weiß nicht, was Sie vorhaben«, rief er, als wir die letzten Einrichtungen des Raumhafens hinter uns gelassen hatten. »Aber Sie müssen auf alle Fälle vorsichtig sein.«
Es war ein diesiger Tag. Der Himmel war grau und verhangen. Von den mächtigen Bergen, für die Musan berühmt war, war nichts zu erkennen.
»Wir wollen nur ein bisschen wandern«, sagte ich nach vorne.
Eine mittelalterliche Kraftfeldkuppel hielt den Fahrtwind ab. Dafür knatterte der Feldgenerator ohrenbetäubend.
»Nach ...«
Jennifer verpasste mir einen Boxhieb. Ich biss mir auf die Zunge.
»Wir waren schon öfter hier«, sagte ich ausweichend. »Wir kennen uns hier aus.«
Ich sah keinen Grund, weshalb ich dem Jungen nicht trauen sollte. Aber es waren schwierige Zeiten. Manch einer verkaufte seine Seele, um seiner Familie zu einem warmen Abendessen zu verhelfen.
»Seien Sie vorsichtig«, wiederholte er. »Die Union hat nicht alle Laya vertrieben!«
»Was heißt das?«
»Einige der Besatzungssoldaten, die Sin Pur auf unsere Welt gebracht hat, haben sich in die Berge geschlagen, ehe Ihre Leute kamen.«
Er nahm den Blick für einen Moment von der unbefestigten Piste, auf der wir mit viel Getöse und unter Aufwirbelung enormer Staubmassen dahinrumpelten, und sah über die Schulter.
»Diese Leute haben ihre Computer zerstört, damit niemand mehr die Daten abgleichen kann, und ihre Uniformen ausgezogen. Aber sie sind noch da.«
»Wie viele können das sein?«, dachte ich laut nach. Die ganze Besatzungsmacht hatte ja höchstens einige hundert Mann betragen.
»Wenn es fünf sind, ist es vielleicht schon genug.« Er senkte einen drohenden Blick in mich und widmete sich dann wieder der Schotterpiste.
»Wollen Sie mir Angst machen?«
»Ich glaube, dazu bin ich nicht der Mann.« Er lachte das helle kindliche Lachen, für das die Menschen dieser friedlichen Welt berühmt waren.
»Es ist ein ganzer Planet«, sagte ich noch. »Wir entfernen uns nicht weiter als ein paar Tagesmärsche von der Stadt.«
»Mögen die Götter Sie beschützen!«
Wenig später erreichten wir den letzten kleinen Ort am Rand der Ebene. Es war wirklich schade, dass der Dunst vor den Bergen hing. Wir hatten sie nur während des Landeanfluges kurz gesehen. Dann war die Fähre in die Glocke aus Smog und Nebel eingetaucht, die über dem Talkessel hing. Die Stadt und der nahe gelegene Feba See erzeugten einen eigentümlichen Qualm aus Ruß und Feuchtigkeit, der den Himmel beschlug wie warmer Atem eine kalte Glasscheibe. Am nächsten Morgen würden wir das Panorama umso prachtvoller erleben!
Wir verabschiedeten uns von dem Fahrer, der knatternd zur Kaserne zurück raste. Dann standen wir in dem sich langsam absetzenden Staub. Ich begann mich nach einer Dusche zu sehnen. Dabei hatten wir die Wanderung noch gar nicht angetreten. Es lohnte auch nicht mehr, an diesem Tag noch etwas zu unternehmen. In dem Dorf, in dem Tashi uns abgesetzt hatte, gab es eine kleine Pension, ein Rasthaus für Pilger. Es wurde von Ran Darjen betrieben, einem ehemaligen einfachen Lama der Prana Bindu. Er war aus dem Orden ausgeschieden und hatte stattdessen dieses Gasthaus an einer der wichtigsten Pilgerrouten aufgemacht.
Wir ließen uns ein Zimmer geben. Im Speiseraum waren wir die einzigen Gäste. Es war gemütlich. Alles war mit Teppichen aus dicker Naturwolle ausgelegt. Die Tische und Stühle bestanden aus echtem Holz, das mit Schnitzereien verziert war. Als das letzte Tageslicht vor den Fenstern verschwunden war, entzündete Ran ein Feuer aus getrockneten Torfsoden und Dung. Er bewirtete uns zuvorkommend mit Suppe, Reis und Gemüse. Dazu gab es ein dünnes heimisches Bier, das ebenfalls aus Reis gebraut wurde. Und allmählich fingen wir an, es zu glauben.
Wir hatten Urlaub!
Als ich aufwachte, war der Platz neben mir leer. Ich streckte mich und sah mich um. Das Zimmer enthielt nur zwei Betten und eine Kommode. Die Vorhänge waren zugezogen. Ich erinnerte mich dunkel, in der Nacht noch an den widerspenstigen Kordeln genestelt zu haben. Aber draußen schien es schon hell zu sein. Der karierte Stoff teilte dem Licht eine rötliche Farbe mit.
Ich stand auf und zog mich an. Jennifers Bett war leer, aber ungemacht. Sie musste sich, wie es ihre Art war, in aller Frühe aus dem Raum gestohlen haben.
Ich ging aus dem Zimmer. Im Treppenhaus war es kühl und roch nach Kalk. Bis zu unserer Etage bestanden die Treppenstufen aus kaltem, abgewetzten Stein. Eine hölzerne Stiege führte weiter hinauf. Einer spontanen Eingebung folgend, ging ich nicht nach unten, Richtung Gastraum, sondern nach oben. Es folgte noch eine Etage, dann noch eine, dann eine noch schmalere Treppe, schon mehr eine Leiter. Sie endete vor einer waagerechten Klappe, die in die Decke eingelassen war. Ich öffnete sie, zwängte mich hindurch und stand im Freien.
Mein Instinkt hatte nicht getrogen. Jennifer saß in Meditationshaltung auf dem flachen Dach. Ein wenig Feuerholz, das hier zum Trocknen gestapelt war, bildete eine Art Geländer; auf einer Seite bestand es auch aus säuberlich aufgeschichteten Dungfladen.
»Störe ich dich?«
Ich schloss behutsam die Klappe hinter mir. Jennifer hatte die Augen geöffnet. Ich sah an ihrem Blick, dass sie die Trance abgeschüttelt hatte.
»Gar nicht.«
Sie schaute mich lauernd an. Die Sonne kam eben im Osten durch den Morgendunst und beschien ihr hageres Gesicht.
»Was?«, fragte ich.
»Nichts.« Sie schmunzelte in sich hinein.
Ich spürte, dass da etwas hinter mir war. Langsam drehte ich mich um. Dann war mir, als habe jemand auf einen Knopf gedrückt und die künstliche Schwerkraft abgestellt. Ich fiel. Ich schwebte!
Vor uns stand die Hauptkette des Ilaya-Gebirges in ihrer ganzen Pracht, von der Morgensonne in safranfarbenes Licht getaucht.
»Wow!«
»Guten Morgen!«
Jennifer stand auf und kam an meine Seite. Arm in Arm nahmen wir das Panorama in uns auf. Felswände, Bergfluchten, Eismassen türmten sich viele Kilometer hoch vor uns auf und reichten von Westen nach Osten einmal quer über den Horizont. Die Kette zog sich einmal rund um den Planeten herum, aber was vor uns stand, war der zentrale Teil in einer Breite von zweihundert Kilometern.
»Hier wuchs ein Gebirge aus der Erde«, sagte Jennifer.
Ich nickte. Wussten wir noch, was das war? Wir hatten Planeten, Sonnen, ganze Galaxien aus dem Raum gesehen, aber wann zuletzt ein Gebirge so wahrgenommen?
»Gewaltig.«
Der Wind frischte auf. Wir fröstelten, obwohl die Sonne rasch höher stieg. Aber wir konnten uns nicht von dem mächtigen Anblick losreißen.
»Hast du keinen Hunger?«, fragte Jennifer irgendwann.
»Und wie!«
»Dann lass uns runter gehen!«
Aber wir standen immer noch da und schauten und schauten.
Sowie die Sonne sich durch die Morgennebel gekämpft hatte, begannen sich Wolken um die höchsten Gipfel zu bilden, und schnell entzogen sie sich unseren Blicken. Das machte uns den Abschied leichter. Wir kletterten ins Treppenhaus zurück und gingen frühstücken.
»Wie hast du geschlafen?« Jennifer schlürfte den dünnen Kaffee, den Ran Darjen gekocht hatte, und bestrich eines der omelette-artigen Fladenbrote mit gelber Butter.
»Wie ein Bär. Und du?«
»So gut wie lange nicht mehr!«
Sie zwinkerte mir gutgelaunt zu. Dann biss sie in den Teigfladen, dass die dicke geschmolzene Butter über ihr Handgelenk lief.
»Hoppla!«
Sie leckte sich die Finger.
»Hier kann man es aushalten, was?« Ich probierte den heimischen Tee, der in einem ganz ordentlichen Ruf stand und der auch wirklich genießbar war.
Wir waren auch jetzt die einzigen Gäste in der kleinen Stube. Zwar hatten auch andere Leute in Rans Rasthaus übernachtet, einheimische Pilger hauptsächlich. Aber sie waren längst unterwegs, da sie vor dem Morgengrauen aufbrachen und traditionell das Frühstück verschmähten.
Ich sah mich in dem Raum mit seiner niedrigen Balkendecke und seinen abgewetzten Teppichen um. Alles trug die Zeichen des höchsten Alters. Wie lange mochte diese Welt von Menschen besiedelt sein? Das Doppelsystem von Sin Pur und Musan war von der ersten Welle von Sprungschiffen kolonisiert worden. Seitdem waren hier einige Jahrhunderte vergangen.
Zur seltsamen Tragik der Goldenen Generation um Rogers und Laertes gehörte es ja, dass die erste MARQUIS DE LAPLACE sich immer noch bei Unterlichtgeschwindigkeit von ihrem Jungfernflug zurückkämpfte, während längst bessere Aggregate entwickelt worden waren, die ein Vielfaches der Reichweite hatten. Laertes war einer der letzten lebenden Veteranen jener Pioniertat. Die alte MARQUIS DE LAPLACE war das erste und einzige Schiff, das je mit Unterlichtantrieb zu einem anderen Stern aufgebrochen war. Immer wenn es wieder zurück kam, war es trotz der Updates ein Oldtimer, der der neuen Generation von Prospektoren und Admiralen vorsintflutlich erschien. Mit der Verbesserung der Sprungtechnik verringerte sich auch der Dilatationseffekt. Trotzdem umspannte Laertes’ Leben ein halbes Jahrtausend irdischer Zeit, und er war nach jeder Reise von der Entwicklung überrollt worden. Er und Rogers waren lebende Fossilien aus einem unbegreiflich fernen Äon. Und so entstand das Paradox, dass wir die Helden des interstellaren Aufbruchs noch persönlich kannten, die jetzt in ihren Siebzigern standen, während wir auf Welten wandelten, die vor drei oder vier Jahrhunderten von der menschlichen Rasse in Besitz genommen worden waren.
Nach dem Frühstück unternahmen wir einen kleinen Gang durch das Dorf, wenn man die lockere Zusammenballung einer Handvoll halbverfallener Gehöfte so nennen wollte. Es war ein Weiler, der nur deshalb zu einer gewissen Bedeutung gekommen war, weil er einen der Ausgangspunkte der klassischen Pilgerrouten darstellte. Hier heuerten die Pilger Führer, Träger oder Lasttiere an. Hier versorgten sie sich mit Lebensmitteln und festem Schuhwerk. Es gab eine Art Hauptplatz, eine natürliche Halle unter einem breitschattenden Bodhibaum, wo ein paar Männer herumlungerten und ihre Dienste anboten. Es gab auch einen Verkaufstand, wo die Pilger und die Einheimischen sich mit Obst, Gemüse, Reis und Gerstenmehl versorgen konnten. Wir verschafften uns einen Überblick über das Angebot an Waren und Dienstleistungen, kamen aber noch nicht zu einem Abschluss. Wir mussten uns erst darüber klar werden, was wir nun hier anfangen wollten. Das eine aber wussten wir: Wir wollten allein bleiben. Den ortskundigen Guides, die sich uns unterwürfig präsentierten, mussten wir daher eine Absage nach der anderen verpassen, obwohl sie uns in den schaurigsten Tönen die immergleiche Mär von den versprengten Laya-Soldaten erzählten, die angeblich noch das Hinterland unsicher machten. Nachdem wir zum zehnten Mal auf unsere Offizierspistolen gedeutet hatten, änderten sie ihre Strategie und berichteten mit aufgerissenen Augen und verzerrten Mündern von wilden Tieren, giftigen Pflanzen, Lawinen, Erdrutschen und anderen Gefahren, die das Gebirge für uns bereithalte. Irgendwann wurde es uns zu dumm. Wir kehrten zu unserer Unterkunft zurück.
Wir blieben mehrere Tage in dem beschaulichen Weiler. Allmählich begannen wir uns in der bescheidenen, aber liebenswürdigen Pension einzuleben. Wir mussten unsere Körper an diese Welt akklimatisieren. Die Schwerkraft war geringer, die Luft wesentlich dünner als der Standard, den wir gewohnt waren. Und auch unsere Seelen bedurften einiger Zeit der Anpassung. Wie es war, in einem Bett zu schlafen! Unter normalen atmosphärischen Bedingungen zu leben. Keine Entscheidungen treffen zu müssen und nicht permanent in Lebensgefahr zu sein! Mit Beginn der zweiten Woche stellte ich eine tiefe Entspannung bei mir fest.
Auch mit Jennifer ging eine Wandlung vor. Sie wurde ruhiger. Sie konnte eine Viertelstunde lang da sitzen, ohne mit dem Fuß zu wippen und Pläne zu schmieden, einfach nur so.
»Was denkst du?«, fragte ich dann manchmal
»Es ist seltsam«, sagte sie, ohne mich anzusehen, »aber ich will mit dir zusammen sein.«
»Ich bin da.«
»Wir waren so lange getrennt.«
»Spielst du auf alte Geschichten an?«
»Nicht, was du meinst. Ich habe einfach nur Sehnsucht nach dir.«
»Ich bin da«, wiederholte ich.
»Lass uns nach vorne schauen, lass uns den Augenblick leben, lass uns diese paar Jahre genießen, die uns vielleicht noch bleiben.«
»So kenne ich dich gar nicht.«
»Du weißt, worum es geht.«
»Ich weiß es.«
»Es ist keine Sache der Zeit, nichts von Tagen oder Wochen oder Monaten.«
»Du hast alle Zeit der Welt.«
»Kommst du mit mir?«
»Wohin du willst. Aber ich glaube, ich weiß schon, wohin es dich zieht.«
»Ich würde gerne eine Pilgerfahrt unternehmen.«
»Du hast die Warnungen gehört!«
»Es ist eine ganze Welt, und ich kenne die Seitentäler und Klöster.«
»Wie du meinst. Du willst nach Loma Ntang?«
»Auch. Aber ich will zu Fuß dorthin gehen.«
»Durch diese schreckliche Schlucht?«
»Nicht durchs Kali Gan. Es gibt auch andere Wege, längere, aber sanftere Wege, einsame Täler, abgelegene Dörfer, menschenleere Landschaften.«
»Klingt verlockend.« Ich dachte an die kilometerhohe Mauer aus Fels und Eis, die scheinbar unüberwindlich hinter dem Dorf aufragte. Aber ich wusste, dass es Schleichwege gab, uralte heilige und geheime Pfade. Das gewundene, tief eingesägte Tal des Masyan! »Was immer du willst!«
»Halt mich fest, Frank!«
Sie wurde immer weicher. Etwas in ihr war zerbrochen. Ich ertappte sie dabei, wie sie leer vor sich hinstarrte. Die Geiselhaft bei den Zthronmic hatte etwas in ihr angerichtet, dem sie sich bis jetzt nicht hatte stellen können. Die unsichtbare innere Wunde zehrte und fraß an ihr, sie vergiftete ihre Seele, wenn sie sie nicht dem hellen Licht ihres Bewusstseins aussetzte und ein für allemal verödete. Aber es hatte keine Gelegenheit dazu gegeben. Keine vierundzwanzig Stunden nach ihrer Rettung hatten wir die nächste Schlacht schlagen müssen. Die Zthronmic mussten besiegt werden. Die Laya hatten sich erhoben. Die Tloxi hatten gemeutert. Jetzt, endlich, so schien es, jetzt war die Zeit gekommen, dem Schrecklichen, das noch immer in ihr war, die Stirn zu bieten, ihm ins Angesicht zu schauen, und ich wusste, dass sie diesen Gang nur wagen würde, wenn ich ihr dabei zur Seite stand.
Also nach Loma Ntang.
Kapitel 2: Aufbruch nach Loma Ntang
Und eines Morgens brachen wir tatsächlich auf. Wir hatten uns auf dem kleinen Markt mit Vorräten versehen. Und mit Bargeld! In den Tornistern trugen wir das Zelt und die Schlafsäcke, sowie ein paar Kilo Kartoffeln, Zwiebeln und Mehl, Reis, Nudeln und Gewürze. Auch unterwegs, so hatte man uns versichert, würden wir uns mit Lebensmitteln versorgen können. Es war das Ende des Sommers, überall wurden die Felder abgeerntet. Das Wetter war stabil. Einer langen Wanderung auf die andere Seite des Ilaya und das lange Tal des Masyan hinauf zum uralten Hauptkloster des Prana-Bindu-Ordens stand nichts im Wege. Trotz flehender Appelle der Einheimischen, die einen einträglichen Job suchten, gingen wir ohne Führer. Wir wollten für uns sein. Die hysterisch ausgeschmückten Warnungen schlugen wir in den Wind.
Ich dachte darüber nach, ob das nicht doch vielleicht zu leichtsinnig gewesen sein mochte, als Jennifer stehen blieb. Wir überquerten gerade eine kleine Brücke. Unter uns rauschte der Masyan, der hier aus dem Gebirge hervortrat und in die Ebene von Feba einbog. Es war ein stattlicher Wildfluss. Er hatte schon einiges hinter sich, wenn er hier um die Biegung kam. Ihn ohne Brücke oder technische Hilfsmittel zu überwinden wäre unmöglich. Wir standen an dem wackligen Geländer aus notdürftig ineinander verflochtenen Bambusstangen und sahen in die lehmgrauen Fluten, in denen man das Knacken und Krachen mitgewälzter Felsblöcke hörte. Wer dort hineinfiel, würde in Augenblicken zu Hackfleisch zermahlen.
Jennifer zog etwas aus der Tasche und ließ es in die brodelnden Wassermassen fallen. Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass es ihr HandKom gewesen war.
Ich unterdrückte den Schrei so schnell, wie er sich aus mir losringen wollte. Dennoch entging ihr nicht das verständnislose Grunzen, das ich ausstieß. Sie lächelte milde.
»Hätte es nicht gereicht, das Ding auszuschalten?«, fragte ich.
»Das ist nicht dasselbe!«
»Nein, ist es nicht!« Ich starrte fassungslos in das Mahlwerk aus tosendem Wasser und kollernden Steinen.
»Wir haben ja noch deinen«, sagte sie.
»Willst du ihn auch wegschmeißen?«
»Von mir aus!« Sie lächelte mir in ihrer aufreizenden Art zu.
»Das lass gefälligst bleiben!«
»Fühlt es sich nicht viel besser an so?«
»Solange nichts passiert.«
»Was soll denn passieren?«
Noch immer hätte man meinen können, sie provoziere nur, aber ihre Tat sprach für sich.
»Meiner hat keine Qbox«, sagte ich. Nur ihr Gerät war von Reynolds auf Quantenkommunikation aufgerüstet worden. Das meine musste mit konventioneller Technik auskommen. Unter den hier waltenden Bedingungen – keine Satelliten, kein weltumspannendes Netz – konnte ein Funkspruch ins nächste Dorf zu einer technischen Herausforderung werden.
»Bis vor ein paar Jahren hatte das niemand.«
»Das waren andere Zeiten!«
»Als wir damals nach Loma Ntang gegangen sind, hatten wir auch keine Koms dabei.«
»Das war vor dem Krieg«, sagte ich.
»Und jetzt ist nach dem Krieg.« Sie zuckte mit den Achseln, stieß sich von dem wenig vertrauenerweckenden Geländer ab, das ein unangenehmes Quietschen hören ließ, und ging weiter. Ich folgte ihr seufzend. Vermutlich hatte sie recht. Es gab nichts zu befürchten. Die Leute hatten uns nur verrückt gemacht, weil sie ihre Dienste anpreisen wollten. Versuchten wir, das Hier und Jetzt zu leben!
Aber dann prüfte ich doch den Ladezustand meines Koms und vergewisserte mich, dass ich eine Verbindung zum Raumhafen hatte.
Es wurde heiß. Die Automatik meines Anzugs begann selbsttätig zu kühlen. Wenig später musste ich sie anweisen, ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken. Dennoch konnte ich nicht verhindern, dass ich weit zurückfiel. Jennifer wanderte munter voran.
Dann überholte ich sie wieder. Sie kauerte am Rand des Weges im Unterholz und musterte eine kleine unscheinbare Pflanze, als habe sie in ihrem Leben noch keine Blume gesehen. Ihr Gesichtsausdruck war entrückt. Sie war ganz in den Anblick dieses unauffälligen Gewächses versunken. Ich ging vorbei, ohne etwas zu sagen.
Später schloss sie ihrerseits zu mir auf. Ich hörte ihre raschen leichten Schritte. Dann war sie neben mir. Schulter an Schulter wanderten wir dahin. Es war ein nicht allzu breiter Weg, der tiefer und tiefer in einen dichten Wald eindrang. Die Luft war dunkel und feucht, es roch nach Moder und verfaulten Früchten und exotischen Blüten. Insekten schwirrten unter dem Laubdach. Ab und zu tschilpte ein unsichtbarer Vogel.
»Ein Seidelbast«, sagte sie.
Ich dachte zuerst, sie meine den Vogel, bis mir einfiel, dass das der Name einer Pflanze war.
»Wirklich?«
»Ja!« Sie klang, als wäre es eine großartige Entdeckung. »Ich hätte nicht damit gerechnet, hier so etwas zu finden.«
»Wohl sehr selten?«
»Extrem! Selbst bei uns sind sie scheu wie junge Rehe. Die Siedler müssen sie mit eingeschleppt haben, als sie Nutzpflanzen importierten. Aber offenbar vertragen sie das Klima und haben sich mit den endemischen Flora arrangiert. Trotzdem wundert es mich, dass sie unmittelbar am Wegesrand wachsen!«
Ich brummte eine Art Zustimmung.
Wenig später wurde ich ihr wieder zu langsam. Sie schaltete einen Gang nach oben und ließ mich einfach stehen. Gemessenen Schrittes weiterwandernd, sah ich zu, wie sie den Abstand zwischen uns vergrößerte und bald ganz im schwarzgrünen Dämmer dieses Bergwaldes verschwand. Ich stapfte vor mich hin, in meine Gedanken eingesponnen, aber wenn mich unvermittelt jemand gefragt hätte, hätte ich nicht sagen können, woran ich gerade dachte.
Es wurde immer noch dunkler. Schließlich donnerte es, lang nachrollend und krachend, und es begann zu regnen. Schon während der letzten Tage hatten wir beobachten können, wie sich jeden Tag um die Mittagszeit die Wolken um die Berge ballten, um sich später in schweren Gewittern zu entladen. Bis zum Abend kam in der Regel die Sonne wieder heraus, um dann in melancholischen Untergängen hinter den Westbergen zu verscheiden.
Die Blitze hatten sich in irgendwelchen Felsklüften versteckt. Man hörte nur das Donnergrollen, satt und berstend, als rissen Fabelwesen die Bergzinnen aus, um mit ihnen zu kegeln. Minutenlang hallte es in der engen Schlucht des Masyan nach, dem wir nun flussaufwärts folgten und der sich hier seinen Weg durch die kilometerhohe Masse des Gebirges gebrochen hatte. Der Regen kam irregulär und versprengt, wie eine in Auflösung geratene feindliche Truppe durch das ölige Blätterdach, das unter seinen Attacken schwankte und taumelte. Aber die Reihe der Laubkronen hielten stand, wie sehr der Gegner auch auf sie einschlug und sie mit seiner nassen Artillerie beharkte.
Gewaltige Wasserfälle stürzten von den Felswänden herab und überfluteten teilweise den Weg. Ich musste von Stein zu Stein springen und aufpassen, nicht auf zerfetztem Laub auszurutschen. Einmal musste ich durch einen Sturzbach waten, der den Pfad auf einer Länge von zwanzig Metern überschwemmt hatte. Der Regen fiel ohne Unterlass, wie ein Vorhang, und der Wald gebärdete sich wie eine Armee von Trollen, die wütend tobte und gestikulierte, aber nicht einen Schritt dabei gewann. Es wurde immer noch finsterer. Das Wasser war allgegenwärtig und klebrig wie die Nacht. Ohne den Anzug wäre mir der Mut gesunken. So kämpfte ich mich weiter, mit einem Gefühl, als rudere ich unterhalb des Meeresspiegels einen Steilhang hinauf, der von widerspenstigen Wesen bestanden war.
Der Weg endete an einer Brücke, die von den Wassermassen mitgerissen worden war. Ich unterdrückte den Impuls, die Navigationsfunktion meines Koms zurate zu ziehen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte sie sowieso nicht funktioniert, es gab ja auf dieser Welt keine planetare Netzabdeckung. Außerdem wollte ich Jennifer zuliebe die Herausforderung annehmen und ohne diese Hilfsmittel zurecht kommen. In meinem Kopf entstand der Kalauer, dass ich auf vorsintflutliche Weise in der Sintflut unterwegs war. Ich entdeckte einen schmalen Pfad, der neu ausgetreten zu sein schien und der rechts ab den Hang hinunter führte. Mit einem albernen Grinsen im Gesicht, über das mir der Regen schoss wie über eine defekte Windschutzscheibe, arbeitete ich mich den kaum zu erkennenden Trampelpfad entlang, der dem Wildbach folgte. Weglos, im immer noch undurchdringlicher werdenden Wald, während die steil eingeschnittene Schlucht die Abenddämmerung um mehrere Stunden vorwegzunehmen drohte. Der Gewitterbach war die einzige Orientierung. Irgendwo musste er in den Masyan münden, der dann wiederum die Hauptrichtung vorgab.
Ein umgetretenes Pflänzchen hier, ein paar abgerissene Blätter dort – das waren die einzigen Hinweise darauf, dass schon einmal Menschen hier gewesen waren. Ab und zu eine Fußspur im knöcheltiefen Morast. Meist waren es die profillosen Sandalen der Eingeborenen, die diese Löcher in den Schlamm getreten hatten. Manchmal erkannte ich aber auch Jennifers charakteristischen Stiefelabdruck und war dann jedesmal wieder erleichtert.
Der Pfad knickte ein und schickte sich an, den Sturzbach zu überqueren, ehe dieser in einem hohen Katarakt in den Masyan hinunter schoss. Der Waldboden bildete eine Art Canyon, der den Wildfluss fasste, und an einer Stelle ergab sich eine Furt, wo große Felsblöcke es möglich machten, trockenen Fußes auf die andere Seite zu gelangen. Nicht, dass noch ein trockener Faden an mir gewesen wäre!
Ich kletterte hinunter, und dort, an der tiefsten Stelle, in dieser Schlucht-in-der-Schlucht, auf einem Felsbrocken, der mitten im Bachbett lag und auf allen Seiten von strudelnden Wassermassen umbrandet wurde, dort saß Jennifer.
Ich stakte, von Stein zu Stein springend, an ihr vorbei, konnte ihren erhabenen Sitz aber nicht erreichen. Der fragende Blick, den ich ihr zuwarf wie ein Lasso einem Ertrinkenden, prallte an ihr ab. Sie saß in Meditationshaltung auf diesem klatschnassen Block. Dabei war sie ganz still. Kein Schluchzen, kein Jammern, keine Bewegung. Wie eine Statue war sie in diese Landschaft aus Wasser und Dämmerung gepflanzt und ließ die Tränen strömen. Die Natur weinte, schien sie sich zu sagen, warum nicht ein bisschen mittun.
»Geh weiter«, sagte sie, als ich unschlüssig stehen blieb.
Ihre Stimme klang mechanisch, wenn sie auch nicht aus der Trance zu kommen schien. Inzwischen konnte ich Dutzende Schattierungen und Abstufungen ihrer Versenkung unterscheiden.
»Ich bin da«, sagte ich.
Dann ging ich weiter.
Jennifer hockte im Regen und heulte.
Auf der anderen Seite ging es steil und pfadlos wieder hinauf. Mehr als einmal steckte ich bis zur Brust im nassen Laub, mit den Armen rudernd wie ein Verunglückter im Treibsand. Endlich gewann ich wieder den Hauptweg. Langsam wanderte ich weiter. Das Gewitter verzog sich. Die Abendsonne kämpfte sich durch die Wolken. Hoch über dem Blätterdach leuchtete eine Felswand im strahlenden Licht, immer noch höher und glühender. Darüber war reiner Himmel. Hier und da tropfte es noch, jeder Schritt schmatzte, alles, wirklich alles war nass. Aber das Wissen, dass es dieses andere gab, reichte aus, die Stimmung wieder zu heben, nachdem die Versuchung schon sehr groß geworden war, die ganze Unternehmung zu verfluchen.
Irgendwann war Jennifer wieder da. Schweigend holte sie mich ein und ging dann neben mir. Ich sagte nichts. Wir sprachen beide immer weniger.
Der Weg wurde schmaler und führte auf einem handbreiten Sims dahin, das an der mauerglatten Architektur der Felswände entlang schnürte. Tief unten brodelte der Fluss. Ein totes Muli lag im Masyan, ein Packtier, das zu einer Karawane gehört hatte und weiter oben abgestürzt war. Der Kadaver war an einer Stelle hängen geblieben, wo der Fluss noch einmal breiter, flacher, steiniger wurde und vernehmlich Atem schöpfte, ehe er das Katarakt hinunterbrach. Zwei Langhals-Geier waren bereits zur Stelle und taten sich an dem Muli gütlich. Ein schwarzer Königsgeier hockte drohend auf den Uferfelsen. Der rotbraune Kadaver war an der Flanke geöffnet. Einer der beiden großen Geier, die später gelandet waren, ihren Konkurrenten aber sofort vertrieben hatten, räumte die Innereien aus. Der tote Körper verschmolz fast mit dem rötlichen Gestein der ausholenden Geröllstufe, an der er angelandet war und die vom Fluss in schaumgrauer Furt durchströmt wurde. Der helle Schädel des Tiers sah aus wie einer der Felsbrocken, die aus dem seichten Wasser ragten.
Wir standen lange da und betrachteten dieses Bild, das von starker meditativer Kraft war, ließen uns selbst von ihm durchströmen.
»Tod und Vergänglichkeit«, sagte ich leise.
»Ja.« Jennifer nickte. »Aber eingebettet und durchströmt vom Fluss, vom Ewigen Werden.«
Ich sah sie an.
»Der Einzelne«, sagte sie, »ist nur ein Teil des großen Plans, aus dem er hervorgeht und in den er wieder eingeschmolzen wird.«
Wenig später trat der Wald auseinander. Wir kamen auf eine künstliche Lichtung. Ein winziges Dorf, nur zwei oder drei ärmliche Höfe, und rings herum terrassenförmig dem Gelände abgerungene Felder. Obwohl die Berge hoch über uns noch leuchteten, dämmerte es hier unten schon . Die Felder mussten dieser Tage abgeerntet worden sein. Man verbrannte Laub und Stroh in qualmenden Feuern. Die Rauchschwaden krochen zäh und lauernd am Rand der Siedlung herum. Es schien niemand auf den Wegen zu sein, aber als wir uns näherten, kamen einige Erwachsene und eine unübersehbare Schar von Kindern aus den armseligen Hütten. Sie musterten uns scheu. Wir waren fremd hier. Unsere weißen Anzüge, die Uniformen der Fliegenden Crew für Außeneinsätze, machten uns auffälliger als Aliens. Eigentlich hätten wir sie gegen einheimische Kleidung tauschen sollen, aber dann hätten wir auf die vielen Annehmlichkeiten der integrierten Funktionen verzichten müssen, die ich gerade in diesem Augenblick genoss, die automatische Heizung etwa, die gegen die einsickernde Feuchtigkeit ankämpfte.
Die Alten beäugten uns misstrauisch, wobei mir auffiel, dass die Männer noch feindseliger wirkten als die Frauen. Diese betrachteten uns schweigend, aber mit offenen, abwartenden Gesichtern, während die bärtigen Männer eine Phalanx der Abweisung bildeten. Lediglich die Kleinen kamen auf uns zu. Sie stellten sich am Rand des Weges auf, wo dieser zwischen den Häusern hindurch führte, und bildeten ein Spalier des Lachens und der Fröhlichkeit. Wie sie es sich bei durchkommenden Pilgerzügen angewöhnt hatten, streckten sie die Hände vor. Es war mehr ein Spiel als echte Bettelei. Sie standen da, kicherten und stießen sich gegenseitig mit den Schultern. Dabei starrten sie vor Schmutz und Ungeziefer. Ihre schwarzen Haare waren steif vor Dreck. Wenn nicht eine natürliche, ungezwungene Fröhlichkeit wie ein bunter Vogelschwarm um sie geflattert wäre, hätte der Anblick niederschmetternd sein müssen.
So versuchten wir uns auf den spielerischen Charakter des Ganzen einzulassen. Wir kramten alles aus den Tornistern, was wir an Obst und Süßigkeiten mit uns führten. Jennifer veranstaltete ein Quiz und drehte es so, dass jeder einmal der Sieger war, der dann eine Banane oder einen Schokoriegel zugesteckt bekam. Dabei brachte sie noch Einiges aus den Kleinen heraus. Wie das Dorf hieß, wie weit es auf dieser Route zu den Klöstern war und anderes mehr. Als sie, eine Tafel Energienahrung in der Rechten, fragte, ob auch schon andere »Astronauten« durchgekommen waren, schritt einer der Väter ein und ermahnte uns, die Kinder in Ruhe zu lassen. Wir steckten auch ihm noch etwas zu und gingen weiter. Den Gedanken, hier um Obdach zu bitten, verwarf ich angesichts des schreienden Elends dieser Behausungen aus Bambusmatten und Bast, der mit Lehm und Dung beworfen war. Wir fragten, ob wir am Rande der kleinen Lichtung, auf einem der abgeernteten Felder, unser Zelt aufschlagen konnten. Das wurde uns bewilligt. Wir bezahlten dem Eigentümer des Platzes einen Obolus und verabschiedeten uns von den Kleinen, die vom finsteren Auftritt des Dorfältesten nicht im geringsten eingeschüchtert waren.