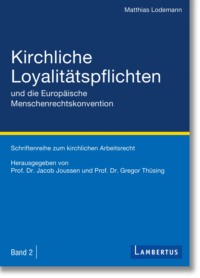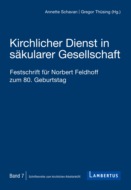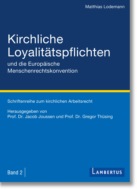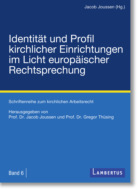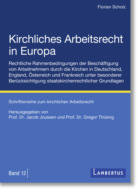Kitabı oku: «Kirchliche Loyalitätspflichten und die Europäische Menschenrechtskonvention», sayfa 6
§ 4 REICHWEITE DER VERFASSUNGSRECHTLICHEN SELBSTVERWALTUNGSGARANTIE
Eine Bewertung dieser Kritik kann nur durch die Untersuchung der Reichweite der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie erfolgen. Fraglich ist also, inwieweit die kirchliche Dienstgemeinschaft in ihrem rechtlichen Gewand und somit das Auferlegen kündigungsrelevanter Loyalitätsobliegenheiten von den Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 III WRV gedeckt ist. Ebenso fraglich ist, inwieweit sie ihrerseits wieder eingeschränkt werden kann, denn Antidiskriminierung ist immer auch Grundrechtsminderung.267
A. Grundlagen: Die Weimarer Kirchenartikel
Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage sind selbstverständlich die Kirchenartikel, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 III 1 WRV. Bei ihnen handelt es sich nach ihrer Inkorporation ins Grundgesetz um vollgültiges Verfassungsrecht; sie stehen damit auf demselben Rang wie übriges Verfassungsrecht,268 mit dem sie ein organisches Ganzes bilden.269 Inhaltlich sind sie als Konkretisierung und logische Weiterführung der Religionsfreiheit (Art. 4 I, II GG) anzusehen,270 indem sie die organisatorischen Voraussetzungen für kollektive Religionsausübung beinhalten.271 Die Religionsfreiheit bildet insoweit ein Gesamtgrundrecht.272 Es handelt sich bei der Selbstverwaltungsgarantie nicht um eine vom Staat abzuleitende Gewährleistung, sondern vielmehr um eine Sicherung kirchlicher Rechte.273 Geregelt wird also das Verhältnis der vom Staat anerkannten societas perfecta zu eben diesem Staat. Die hierzu ursprünglich vertretene strenge Koordinationstheorie, die Staat und Kirche als gleichermaßen souveräne Partner sah,274 wird so heute nicht mehr vertreten. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass eine vollständige Trennung schon nicht möglich ist, weil die teilnehmenden Subjekte – die Menschen – identisch seien.275 Dennoch begeht man wohl keinen Fehler, wenn man die verfassungsgerichtliche Rechtsprechungsentwicklung im Staatskirchenrecht als „kirchenfreundlich“ bezeichnet.276
Der Staat respektiert die Eigenständigkeit der Kirchen für einen begrenzten Bereich, was keine Ausklammerung aus der staatlichen Rechtsordnung, sondern vielmehr eine „Sonderstellung innerhalb der staatlichen Rechtsordnung“ bedeutet.277 Beispielsweise formuliert etwa Art. 50 der Hessischen Landesverfassung:
(1) Es ist Aufgabe von Gesetz oder Vereinbarung, die staatlichen und kirchlichen Bereiche klar gegeneinander abzugrenzen.
(2) Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie der Staat, jeder Einmischung in die Angelegenheiten des anderen Teiles zu enthalten.
Ähnlich formuliert die Präambel des Güstrower Vertrages278, dass „die Trennung von Staat und Kirche gleichermaßen Distanz und Kooperation gebietet.“ Die zwei Säulen aus der Religionsfreiheit einerseits sowie dem Trennungsprinzip andererseits bilden schließlich die religiöse Neutralität des Staates, die diesen zur Zurückhaltung verpflichtet, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 I WRV.279
Nun kann die staatliche Zurückhaltung nicht grenzenlos sein. Rechtsfrieden und Rechtsgleichheit gebieten eine – zumindest rudimentäre280 – Kontrolle, widrigenfalls die staatliche Grundstruktur als solche in Frage gestellt würde.281 Ob eine Rahmenkontrolle, zumindest bei den Großkirchen, wenig Sinn macht, da diese den anzuwendenden Rahmen ja wesentlich mitgestalten und prägen, wie von Isensee vertreten,282 erscheint vor dem aktuellen Wertewandel283 fraglich, ist aber auch nicht entscheidungserheblich; denn eine geringe praktische Relevanz hat keinen Einfluss auf die rechtliche Notwendigkeit. Das folgende Kapitel wird also einen Überblick über die verfassungsrechtlichen Vorgaben geben und deren beiderseitige Reichweite, auch gerade konkret im Arbeitsrecht, untersuchen.
I. Religionsgesellschaften
Träger des durch Art. 140 GG i.V.m. 137 III 1 WRV garantierten Selbstbestimmungsrechts sind die Religionsgesellschaften. Die jeweilige Rechtsform als Körperschaft des öffentlichen Rechts (Art. 137 V WRV) oder als Vereinigungen des Privatrechts hat keinen Einfluss auf die Reichweite des Schutzbereichs, sofern die in Rede stehende Gemeinschaft ein Mehr gegenüber lediglich religiös motivierten Vereinen oder Gesellschaften aufweist.284
Bereits an dieser Stelle wird oftmals betont, dass das Privileg aus Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 III 1 WRV nicht nur der organisierten Amtskirche, sondern auch den ihr zugeordneten Einrichtungen zugute kommen kann.285 Dies geht zurück auf die bestätigte Rechtsprechung des BVerfG. Wurde dies zunächst mit dem Hinweis, dass Maßstab hierfür die institutionelle Verbindung oder die Art der verfolgten Ziele sei, nur angedeutet,286 wurden die genannten Einrichtungen in der Folge als Angelegenheiten der Kirche (und damit gerade nicht als Mit-Träger des Selbstverwaltungsrechts, sondern eben erst als „eigene Angelegenheiten i.S.d. Art. 137 III 1 WRV) bezeichnet.287 Es handele sich um Objekte, bei deren Verwaltung die Kirche grundsätzlich frei sei, sofern und solange die „Einrichtungen nach kirchlichem Selbstverständnis ihrem Zweck oder ihrer Aufgabe entsprechend berufen sind, ein Stück des Auftrags der Kirche wahrzunehmen und zu erfüllen.“288 Die Organisationsformen des staatlichen Rechts oder die Einbeziehung und Mitwirkung von Laien hebt die Zuordnung zur Kirche also nicht auf.289
Dies ist aus zwei Gründen zumindest missverständlich. Zum einen ist zu konstatieren, dass die verselbständigten Einrichtungen keinesfalls eigene Regelungen aufstellen dürfen. Unterfallen sie der Selbstverwaltungsgarantie, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die Regelungen der übergeordneten Gemeinschaft, namentlich der Kirchengemeinde, für sie gelten.290 Abweichende Regelungen sind nicht möglich.291 Die Einrichtungen sind also keine selbständigen Träger der Selbstverwaltungsgarantie.
Einen zweiten Kritikpunkt bietet Wieland, der die dargestellte dogmatische Ungenauigkeit kritisiert und prägnant formuliert, dass die „Einrichtungen, die eben noch Objekt des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts waren, […] zum Subjekt des Selbstverwaltungsrechts“ erhoben werden.292
Praktische Folgen hat dies freilich nicht. Ob nun die entsprechenden Gesellschaften zu den Trägern der Selbstverwaltungsgarantie hinzuzurechnen sind oder aber die Kirche eben in ihnen ihr originäres Selbstverwaltungsrecht wahrnehmen kann, spielt de facto keine Rolle. Zusammenfassend kann der weite persönliche Schutzbereich der einheitlichen Selbstverwaltungsgarantie betont werden.293
II. Eigene Angelegenheiten nach dem religiösen Selbstverständnis
Die Regelungskompetenz der Religionsgemeinschaften erstreckt sich auf ihre eigenen Angelegenheiten. Bereits oben wurde dargelegt, dass auch der Kirche zugehörige, aber rechtlich verselbständigte Einrichtungen der Selbstverwaltungsgarantie unterfallen können.
In früherer Rechtsprechung wurde hier nach der Aufteilung in innerkirchliche Angelegenheiten, die insoweit auch nicht nach staatlichem Recht justiziabel sind, und Angelegenheiten mit Außenbezug zum nichtkirchlichen Bereich differenziert.294 Diese nach objektiven Kriterien anzuwendende Bereichsscheidungslehre erscheint jedoch kaum praktikabel, da selten eine kirchliche Angelegenheit jemals ohne jeden staatlichen Bezug auftreten kann und wird.295 Zudem erscheint sie in Hinblick auf eine durch die staatlichen Gerichte wahrgenommene ekklesiologische Kompetenz zumindest zweifelhaft.296
Aus diesen Gründen vertritt die h.M. heute eine Bestimmung nach Wertungsgesichtspunkten. Um eben einer Religionshoheit des Staates nicht Vorschub zu leisten, orientiert sich die Definition der kircheneigenen Angelegenheiten nach dem Selbstverständnis der Kirchen und was für dessen Vollzug unentbehrlich ist.297 Darlegungspflichtig für die Zugehörigkeit zu den eigenen Angelegenheiten bleiben bei dieser „vergleichsweise großzügigen“298 Respektierung des Selbstbestimmungsrechts freilich die Kirchen.299
Dies bedeutet zunächst, dass die Religionsgemeinschaften hier selbst für die Grenzziehung verantwortlich sind; ihnen steht die Kompetenz-Kompetenz zu.300 Während dies wie dargelegt einerseits nötig erscheint, um nicht zurück ins überkommene Schema der Subordination zwischen Kirche und Staat zu fallen, ist dies gleichzeitig auch Ansatzpunkt für die einsetzende Kritik: Die staatliche Ordnung würde so von der kirchlichen Ordnung abhängig. Der Wortlaut des Art. 137 III WRV verlange aber objektive Kriterien, die Frage seiner Reichweite sei damit eine Frage der Verfassungsauslegung, nicht aber des Selbstverständnisses der Religion.301 Das Selbstverwaltungsrecht führe so von kirchlicher Autonomie zu kirchlicher Souveränität.302
Diese Kritik vermag aber letztlich nicht zu überzeugen. Richtig ist, dass die Grenzen nicht von Seiten des Staates gezogen werden dürften, widrigenfalls die staatliche Religionshoheit wieder hergestellt wäre. Auch der Hinweis auf einen anderenfalls entstehenden rechtsleeren Raum ist verfehlt.303 Ebenso hat die Kirchenautonomie sich auch nicht zur Souveränität gewandelt. Diese Meinung verkennt die Tatsache, dass das kirchliche Selbstbestimmungsrecht noch dem Vorbehalt der allgemeinen Gesetze unterliegt.304 Kritik an der vorherrschenden Meinung krankt daher oft an einer mangelhaften Differenzierung zwischen der Zuordnung zu den eigenen Angelegenheiten der Kirche und der richtigerweise erst im nächsten Prüfungsschritt erfolgenden Frage nach dem Vorbehalt der allgemeinen Gesetze.305 So verbleibt die Letztentscheidungskompetenz bei den staatlichen Gerichten – freilich nicht als freie Entscheidungskompetenz, sondern unter Zugrundelegung religiöser Vorgaben.306 Pauschale Grenzziehungen sind abzulehnen.307
Von der Selbstverwaltungsgarantie umfasst sind also u.a. Kultus und Lehre, Kirchenverfassung, Organisation und Vermögensverwaltung, Rechtsstellung von Geistlichen, Mitgliedschaftsrecht, erzieherische und karitative Tätigkeiten und Mission und eben auch das so genannte kirchliche Arbeitsrecht.308
III. Ordnen und Verwalten
Garantiert ist das selbständige Ordnen und Verwalten eigener Angelegenheiten. Ordnen umfasst dabei die originäre, nicht vom Staat abgeleitete Kompetenz zur Rechtsetzung in innergemeinschaftlichen Angelegenheiten.309 Überschneidungen zu staatlichen Kompetenzen gibt es hierbei nicht, sodass dem Staat insoweit auch kein Eingreifen ermöglicht werden soll. Der Begriff der Verwaltung umfasst dagegen „die freie Betätigung der Organe (der Religionsgemeinschaften) zur Verwirklichung der jeweiligen Aufgaben“.310 Zusammenfassend lässt sich also eine weite Begriffsdefinition resümieren.
IV. Schrankenvorbehalt: Das für alle geltende Gesetz
Die somit im Schutzbereich sehr weit reichende Selbstverwaltungsgarantie wird jedoch nicht schrankenlos gewährt. So garantiert Art. 137 III 1 WRV den Kirchen ihr Selbstverwaltungsrecht lediglich innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Wie dieser Begriff aber materiell mit Leben zu füllen ist, blieb über die Dekaden umstritten; Einigkeit besteht lediglich darüber, dass nur formelle Gesetze imstande sind, die Reichweite des Selbstverwaltungsrechts einzuschränken.311
1. Ursprüngliche Interpretation und Heckel’sche Formel
Zunächst formulierte Anschütz, dass das für alle geltende Gesetz als das für jedermann geltende Gesetz zu verstehen sei.312 Staatliche Eingriffe, die kein religionsspezifisches Sonderrecht beinhalten, wären somit zulässig, was auch der gegen diese Meinung vorgebrachten Kritik entspricht.313 So entwickelte sich alsbald die so genannte Heckel’sche Formel, die besagte, dass ein für alle geltendes Gesetz ein solches sei, „das trotz grundsätzlicher Bejahung der kirchlichen Autonomie vom Standpunkt der Gesamtnation als sachlich notwendige Schranke der kirchlichen Freiheit anerkannt werden muss; m.a.W. jedes für die Gesamtnation als politische Kultur- und Rechtsgemeinschaft unentbehrliche Gesetz, aber auch nur ein solches Gesetz.“314 Dieser Ansatz verkannte jedoch den strukturell unlösbaren Zusammenhang von Selbstverwaltungsgarantie und der Glaubensfreiheit des Art. 4 GG, der belegt, dass das bekenntnismäßige Verständnis der Kirchen zu respektieren ist.315 Auch Gesetze, die der Sozialordnung ihre Struktur geben, können also nicht automatisch als begrenzende Gesetze i.S.d. Art. 137 III 1 WRV verstanden werden.316 Die Heckel’sche Formel wird daher so gar nicht mehr und modifiziert nur noch vereinzelt vertreten.317
2. Jedermann-Formel des BVerfG
Das BVerfG entwickelte in der Bremer Pastorenentscheidung eine neue Formel zur Bestimmung des allgemeinen Gesetzes. Während bei rein innerkirchlichen Angelegenheiten die Schranke überhaupt keine Rolle spielen könne,318 sei es im Übrigen entscheidend, ob das in Rede stehende Gesetz einen besonderen Einfluss auf die Kirche habe. Mit anderen Worten: „Trifft das Gesetz die Kirche nicht wie den Jedermann, sondern in ihrer Besonderheit als Kirche härter, ihr Selbstverständnis, insbesondere ihren geistig-religiösen Auftrag beschränkend, also anders als den normalen Adressaten, dann bildet es insoweit keine Schranke.“319 Es könne also nicht jede abstrakt-generelle Rechtsetzung des Staates, die nicht als unvernünftig erscheint, in den Bereich der kirchlichen Autonomie eingreifen.320 Verboten sind damit also zweierlei: zum einen Gesetze, die sich direkt gegen die Kirche als solche richten, sowie zum anderen Gesetze, die für die Kirche zwar eine vordergründig rechtlich neutrale Aussage treffen, sie aber in ihrer tatsächlichen Auswirkung härter treffen als andere.321
Kritik bot diese Meinung insbesondere aufgrund einer unverhältnismäßigen Beschneidung der staatlichen Kompetenzen; beispielsweise würden so Eherecht und das Recht zum Kirchenaustritt, da sie die Kirche in ihrer Besonderheit härter treffen, niemals Schranken darstellen können.322 Die Kirchen – auf die sich das BVerfG ohnehin fälschlicherweise konzentriert habe, andere Religionsgemeinschaften oder Sekten außer Acht lassend – drohten damit gänzlich der Verbindlichkeit der staatlichen Rechtsordnung zu entfliehen.323 „Dadurch wird aus dem Recht der Religionsgesellschaften, nicht diskriminiert zu werden, ein Privileg.“324 Im Ergebnis ähnelt die vorgebrachte Kritik also der beschriebenen Kritik an der Bereichsscheidungslehre, deren Weiterentwicklung die Jedermann-Formel darstellt.325
3. Abwägungslehre
Folgerichtig blieb die Rechtsprechung an dieser Stelle nicht stehen. Vielmehr entwickelte das BVerfG die Formel, dass die Reichweite der kirchlichen Autonomie nach einer Abwägung in Wechselwirkung mit den auf der anderen Seite betroffenen Rechtsgütern, seien sie staatliche Interessen oder aber kollidierende Rechte Dritter, festzulegen sei.326
a. Allgemeines
Das BVerfG erkennt hier die Gefahr einer starren, durch staatliche Gerichte zu ziehenden Grenze. Daher treffe „jedes in diesem Sinne dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht Schranken ziehende Gesetz seinerseits auf eine ebensolche Schranke, nämlich auf die materielle Wertentscheidung der Verfassung, die über einen für die Staatsgewalt unantastbaren Freiheitsbereich hinaus die besondere Eigenständigkeit der Kirchen und ihrer Einrichtungen gegenüber dem Staat anerkennt.“327 Folglich sei dieser „Wechselwirkung von Kirchenfreiheit und Schrankenzweck […] durch besondere Güterabwägung Rechnung zu tragen. Dabei ist dem Selbstverständnis der Kirchen ein besonderes Gewicht beizumessen.“328 Ein formelles Gesetz sei damit zwar notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine wirksame Einschränkung der Reichweite der Selbstverwaltungsgarantie.329
Es handelt sich bei diesem Ansatz insoweit um eine Weiterentwicklung der Jedermann-Formel. Diese wird durch einen weiteren Prüfungsschritt, der Auslegung der Schranke selbst im Lichte der Kirchenautonomie, gewandelt: von einer starren Pauschal-Grenzziehung zur flexiblen Rechtsanwendung. Inhaltlich stellt dies den Kompromiss zwischen der kirchlichen und der staatlichen Position dar, indem weder einer staatlichen Kirchenaufsicht noch einer kirchlichen Souveränität Vorschub geleistet wird.330
Daher sei die Reichweite des Selbstverwaltungsrechts zu bestimmen, indem die Schranke selbst wiederum im Lichte des Art. 137 III 1 WRV ausgelegt wird. Nur dann sei eine allseitig interessengerechte Lösung zu ermitteln, was im Übrigen auch durch das Neutralitätsgebot des Staates so vorgegeben ist.331
b. Umfang der Berücksichtigung des kirchlichen Selbstverständnisses
Problematisch an dieser Lösung erscheint insbesondere, dass sie nur wenig griffige Kriterien bietet. So ist insbesondere nicht klar, inwiefern das „besondere Gewicht“ des religiösen Selbstverständnisses zu berücksichtigen ist, oder auch nur, wie schwer es nun tatsächlich wiegt.332 Klar ist lediglich, dass ein „besonderes Gewicht“ nicht gleichbedeutend ist mit einem „generellen Vorrang“, denn dieser würde eine Abwägung obsolet und die vom BVerfG gewählte Begrifflichkeit damit absurd werden lassen.333 Eine automatische Privilegierung ist daher abzulehnen.
aa. Wechselwirkungslehre in Anlehnung an Art. 5 II GG
Hieraus könnte zunächst der Schluss gezogen werden, dass kirchliches Selbstverwaltungsrecht und kollidierende Rechtsgüter einer (annähernd) gleichberechtigten Abwägung zu unterziehen sind.334 Begründet werden könnte dies mit dem Hinweis auf die Natur der Selbstverwaltungsgarantie als grundrechtsabgeleitet.335 Der gebotene Schutz würde also ähnlich dem Art. 5 I GG, einem verwandten Grundrecht, gestaltet werden. Dies würde hier bedeuten, dass in wesentlichen, die Kirche berührenden Fragen eine Vermutung zugunsten der Kirchenfreiheit bestehen bliebe.336 Inhaltlich fände eine Güterabwägung der beeinträchtigten Güter statt, die sodann in praktische Konkordanz zu bringen wären.
Überzeugend ist diese Meinung jedoch keineswegs. Die Besonderheit des kirchlichen Schutzes würde nämlich gerade verkannt. Wäre das kirchliche Selbstbestimmungsrecht nach diesen Vorgaben einzuschränken, so wären die Religionsgemeinschaften nicht besser geschützt als der normale Verein337 oder eben Tendenzbetrieb. Die qualitativen und quantitativen Unterschiede der Kirchenautonomie zum Tendenzschutz sind aber bereits oben dargelegt worden.338 Eine solche Schrankeninterpretation würde also die verfassungsrechtlich garantierte Reichweite der Kirchenautonomie verkennen.339 „Die Anhänger dieser in der Literatur vertretenen Ansicht negieren […] das Eigenverständnis der Religionsgesellschaften als maßgeblichen Anknüpfungspunkt für die Umgrenzung des Selbstbestimmungsrechts.“340 Nicht zuletzt wäre die Inkorporation der Kirchenartikel aus der WRV in das GG ja schlichtweg überflüssig, wenn sich der durch sie gewährte Schutz nicht vom normalen Grundrechtsschutz unterscheiden sollte. Weitergehend noch: Da der zugrunde liegende Art. 4 GG die Religionsfreiheit vorbehaltlos gewährt, würden damit i.E. die Kirchenartikel eine Schwächung der Religionsfreiheit bedeuten.
Zudem zeigt der Wortlaut hier einen zwar kleinen, aber eben doch entscheidenden Unterschied: Spricht Art. 5 II GG noch von den allgemeinen Gesetzen und zeigt so durch den Plural, dass hier formelle Gesetze im Mittelpunkt stehen (die dann freilich im Sinne der Wechselwirkung wieder beeinflusst werden), so nennt Art. 137 III 1 WRV das für alle geltende Gesetz im Singular und betont so eine höhere Hemmschwelle, das allgemeine Gesetz.341
Folgerichtig und inhaltlich nicht zu beanstanden urteilte also auch das BVerfG in an Eindeutigkeit nicht zu überbietender Weise: „Die Formel „innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ kann nicht im Sinne des allgemeinen Gesetzesvorbehalts in einigen Grundrechtsgarantien oder im Sinne des „allgemeinen Gesetzes“, das eine Schranke der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 2 GG) bildet, oder im Sinne der Formel „im Rahmen der Gesetze“ bei der Gewährleistung des Rechts der Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln, verstanden werden. Das verbietet sich schon in Rücksicht darauf, dass die Kirchen zum Staat ein qualitativ anderes Verhältnis besitzen als irgendeine andere gesellschaftliche Großgruppe (Verband, Institution); das folgt nicht nur aus der Verschiedenheit, dass jene gesellschaftlichen Verbände partielle Interessen vertreten, während die Kirche ähnlich wie der Staat den Menschen als Ganzes in allen Feldern seiner Betätigung und seines Verhaltens anspricht und (rechtliche oder sittlich-religiöse) Forderungen an ihn stellt, sondern insbesondere auch aus dem Spezifikum des geistig-religiösen Auftrags der Kirchen.“342