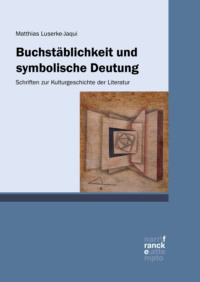Kitabı oku: «Buchstäblichkeit und symbolische Deutung», sayfa 40
Und damit schließt sich der Bogen, das Ende fügt sich zum Anfang. Jenes „meinest du […] / Es solle so gehen, / Wie damals?“ der ersten Zeilen, als ein Reich der Kunst in der Antike gestiftet war und dort die Wissenschaften blühten, verknüpft nun in einer geschichtlichen Klammer die durchaus idealisierte Vergangenheit mit der defizitären Gegenwart. Denn die Situation ist anders in dieser Gegenwart („jetzt“, V. 9), aber er, HölderlinHölderlin, Friedrich, will dennoch nicht „Bilder […] stürmen“ (V. 21). Es bleibt die Hoffnung auf das Brautlied, die Hoffnung auf eine Wiederherstellung der Einheit, auf ein Reich der Kunst in der Neuzeit, das ein Reich der Religion werden wird.
Mörike Er ists (1832), Auf eine Lampe (1846)
Er ists
„Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bists!
Dich hab ich vernommen!“1
Der schwäbische Pfarrer und Dichter Eduard MörikeMörike, Eduard (1804–1875) hat dieses Gedicht am 9. März 1829 geschrieben. 1832 wurde es in seinem Roman Maler NoltenMaler Nolten erstmals gedruckt. Den meisten Leserinnen und Lesern ist der Text aus Schultagen vertraut, Er ists gehört zu den bekanntesten Gedichten Mörikes. Auch die Vertonungen etwa durch Robert FranzFranz, Robert, Robert SchumannSchumann, Robert und Hugo WolfWolf, Hugo trugen maßgeblich zu seiner rezeptionsgeschichtlichen Bekanntheit und Bedeutung bei. In der formalen Analyse zeigt sich, dass besonderes Augenmerk auf den Vers 7 zu richten ist. Das neunzeilige Gedicht ist in Trochäen verfasst. Die ersten vier Verse sind vierhebige Trochäen, die Verse 5 und 6 sind dreihebig, Vers 7 ist als einziger fünfhebig und die letzten beiden Verse 8 und 9 schließen wieder mit dreihebigen Trochäen das Gedicht ab. Aus dieser formal-metrischen Anordnung ragt also Vers 7 deutlich durch seine Länge hervor: „– Horch, von fern ein leiser Harfenton!“
Der Autor spricht damit ein fiktives Du an, entweder sagt er dies zu sich selbst (insofern würde es sich dann um ein verstecktes lyrisches Ich handeln) oder er redet ein tatsächliches anderes Du an. Wenn das Gedicht als Liebesgedicht gelesen wird, dann könnte dieses andere Du die Geliebte – oder im literarischen Rollenspiel, wonach der Autor weiblich und die angesprochene Person dann männlich wäre: der Geliebte – sein. Als dritte Deutungsmöglichkeit könnte der Leser selbst gemeint sein. Das Gedicht also als Liebesgedicht zu verstehen, setzt voraus, dass wir den Frühling als AllegorieAllegorie der Liebe begreifen. Die Frühlingssehnsucht wäre demnach zugleich Liebessehnsucht. Jedenfalls wird dieses Du in einem Imperativ zum Hören des „Harfentons“ aufgefordert, der als Zeichen für die sphärische Entrücktheit des Vorgangs, der sowohl Naturvorgang als auch Liebesphänomen sein kann, dient.
In Mörikes Lyrik greifen Naturgedicht und Liebesgedicht oft ineinander. Auf der Folie des offensichtlichen Liebesgedichts bildet sich dann ein Naturgedicht ab. Natur und Liebe erhalten dadurch denselben Bezugswert für die Leser. Wenn wir das Gedicht ausschließlich als Naturgedicht lesen, verstehen wir den Text im wörtlichen, buchstäblichen Sinn. Der Ausruf „Frühling, ja du bists!“ wird zum Bekenntnis für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt. Dieses Bekenntnis wird verstärkt durch die Gedichtüberschrift Er istsEr ists. Der Frühling ist Zeichen eines Beginns, eines Neubeginns, er ist ein Aufbruchsignal und Ausdruck von Sehnsucht – jahreszeitlich und lebensgeschichtlich gesehen. Das „blaue Band“ mag den blauen Frühlingshimmel bezeichnen – auch in der Erbaulichen BetrachtungErbauliche Betrachtung(1847) spricht MörikeMörike, Eduard von „der blausten Frühlingsmitternacht“2 –, es kann aber auch ein blaues Hutband oder ein blaues Kleiderband meinen. Im Gedicht Der PetrefaktensammlerDer Petrefaktensammler (1847) notiert Mörike:
„Wie die blaue Nacht am Tag!
Blau, wie nur ein Traum es zeigen,
Doch kein Maler tuschen mag“3.
„Süße Düfte“ künden von Frühlingsblumen, aber auch von Verführung und von Neubeginn. Ähnlich heißt es in dem Gedicht An einen LiebendenAn einen Liebenden (1867): „Bald wehen laue Lüfte den Frühling her“4. Und schließlich sind die „Veilchen“, die schon „träumen“, im Volksglauben von jeher Pflanzen, denen neben ihren magischen Kräften auch eine besondere Heilkraft zugeschrieben wird, sie schützen vor Fieber und Krankheit.5 MörikeMörike, Eduard beschreibt dies sehr eindringlich in seinem Märchen Die Hand der JezerteDie Hand der Jezerte (1853).
Wird das Gedicht Er ists hingegen als ein Liebesgedicht gelesen, dann enthält es ein Liebesversprechen („balde kommen“, „Dich hab ich vernommen“). Literaturgeschichtlich gesehen steht Mörikes Er istsEr ists in einer Reihe von weiteren Frühlings-Liebes-Gedichten. Vornehmlich romantische Lyriker haben diese Jahreszeit besungen, Frühling gehörte zu ihren bevorzugten Themen. Mit diesem Leitbegriff konnte auch die Verbindung von Jahreszeit und Liebesleid hergestellt werden. Friedrich Heinrich Baron de la Motte FouquéFouqué, Friedrich Heinrich Baron de la Motte (1777–1843) ist hier mit seinem Gedicht Frühlingsblüte, Maienwind (1812) ebenso zu nennen wie Joseph Karl Freiherr von EichendorffsEichendorff, Joseph Karl Freiherr von (1788–1857) Gedichte Laue Luft kommt blau geflossenLaue Luft kommt blau geflossen (1815) mit den Anfangszeilen „Laue Luft kommt blau geflossen, / Frühling, Frühling soll es sein!“, FrühlingsfahrtFrühlingsfahrt (1818), FrühlingsmarschFrühlingsmarsch (1837) und FrühlingsnachtFrühlingsnacht (1837) zu erwähnen sind. Man kann also mit einigem Recht sagen, Mörike schreibt mit Er ists ein durch und durch romantisches Gedicht. Eine ähnliche Verschränkung von Natur- und Liebesgedicht zeigt sich auch in seinem Gedicht Im FrühlingIm Frühling, das am 17. Juli 1828 geschrieben wurde und das der Autor in seiner Gedichtsammlung gleich dem Gedicht Er ists folgen lässt, möglicherweise aufgrund der thematischen Ähnlichkeit:
„Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel:
Die Wolke wird mein Flügel,
Ein Vogel fliegt mir voraus.
Ach, sag mir, all-einzige Liebe,
Wo du bleibst, daß ich bei dir bliebe!“6
Mörike bietet aus der Perspektive des männlichen lyrischen Ichs seine Variation des biblischen Verses aus dem alttestamentlichen Buch Rut 1, Vers 16, „wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch“7, schon im 19. Jahrhundert einer der gebräuchlichsten Hochzeitsverse.
Verschränken wir die Aussageform des Gedichts als Liebesgedicht mit der Aussageform des Gedichts als Naturgedicht, so ruft MörikeMörike, Eduard mit Er istsEr ists dazu auf, unsere Sinne zu schärfen, darauf zu achten, wie sich der Frühling oder generell die Jahreszeiten ankündigen, zu bemerken, welche Veränderungen in der Natur vorgehen. Und wir wissen heute und können nicht mehr zurück in den Stand der Unschuld, dass diese Naturveränderungen zum großen Teil auch vom Menschen selbst verursacht sind: Klimawandel, ansteigender Meeresspiegel, Dürre- und Hitzeperioden, Abschmelzen der Polkappen, landwirtschaftliche Monokulturen, Umweltgifte usf. Wandel und Veränderung unterliegen durchaus auch einer natürlichen Gesetzmäßigkeit, nichts existiert, was nicht zuvor verändert worden war. Nichts bleibt so, wie es ist. Und gerade deshalb sind wir Menschen ganz besonders aufgerufen wachsam zu sein, aufmerksam zu bleiben, auf Veränderungen, die eintreten, nicht weniger zu achten als auf Veränderungen, die sich abzeichnen. Wir tragen Verantwortung gegenüber der Natur so wie wir Verantwortung tragen gegenüber einer geliebten Person.
Mörike hat mit seinem Gedicht Er ists aus unsrer heutigen Sicht die Literatur für diesen Verantwortungsimpuls genutzt. In seiner Doppeldeutigkeit, einmal das Gedicht als Liebesgedicht lesen zu können und einmal das Gedicht als Natur- und Umweltgedicht zu verstehen, unterstreicht es die ästhetische Bedeutung, die ihm innewohnt. Es lohnt sich, regelmäßig in die scheinbar alten Texte zu schauen und sich auf überraschende Begegnungen mit ihnen einzulassen – nachdenklich-ernst oder nachdenklich-humorvoll, wie Robert GernhardtGernhardt, Robert (1937–2006):
„Zu einem Satz von Mörike
Ein Tännlein grünet wowerweiß im Walde –
doch wer weiß heut noch, wer dies Weiß ersann?
Vor hundert Jahren war’s, als Erwin Wower
vor Erwin Zink und Erwin Kremser hintrat
und sprach: ‚Ich hab ein neues Weiß erfunden,
in Zukunft wird man mit ihm rechnen müssen.‘
Und in der Tat, das Weiß von Erwin Wower
trifftst heutzutage du auf Schritt und Tritt:
Die junge Braut, die wowerweiß errötet,
der Hagestolz, der wowerweiß ergraut,
die nackte Haut, die wowerweiß gebräunt wird,
der Enzian, der wowerweiß erblaut –
sie alle, samt dem Tännlein, eint ein Band:
Das Weiß, das Erwin, wo, wer weiß, erfand.“8
Können Zwerge dichten? Diese Frage hat uns der marxistische Philosoph Georg LukácsLukács, Georg hinterlassen, der meinte, die bürgerliche Literaturwissenschaft bevorzuge kleinere, unbedeutendere Dichter, eben „niedliche Zwerge, wie zum Beispiel Mörike“9. Dies hat dazu verleitet, das Ansehen MörikesMörike, Georg in der LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft insgesamt unter Generalverdacht zu stellen. Er galt bei Vielen als betulicher, biedermeierlicherBiedermeier Autor, der lieber eine Lampe besinge, als sich um die Themen des Jungen DeutschlandJunges Deutschland zu kümmern. Mit dazu beigetragen haben auch Germanisten wie Friedrich GundolfGundolf, Friedrich, der nur recht dürre und nur wenig konkrete Ergebnisse zu formulieren in der Lage ist. Mörikes beste Gedichte kämen „aus der jähen Erschütterung des Herzens, das sich der gerade begegnenden Erscheinungen bemächtigte mit den Bannformeln der deutschen Sprache. Oder sie halten den dauernden Naturgottesdienst Mörikes in schönen Gleichnissen und Sinnbildern fest, ‚selig in sich selbst‘, bis hinunter zur Qual des Ich-seins mitten im Allwirbel“10.
Das heutige Mörike-Bild in der Wissenschaft und Lehre ist relativ einheitlich. Mörike ist längst als ernstzunehmender, je nach Position klassischer oder klassizistischer Autor rehabilitiert, der Vorwurf der gefühligen, selbstbezüglichen Biedermeierlichkeit ist vom Tisch. Neben dem Lyriker Mörike ist inzwischen auch der Romanschreiber und Prosaist Mörike anerkannt, und weitere, bislang übersehene oder kaum beachtete Facetten seines Werks werden sukzessive erschlossen, gleichsam eine Art schwebende Anerkennung wurde ihm zuteil. Und diesem Zwerg ist es gelungen, unserem Fach eine der schwierigsten Aufgaben mitzugeben, die es in der Textinterpretation zu lösen gibt, das Gedicht Auf eine LampeAuf eine Lampe.
Bevor ich mich dem Text und meiner Fragestellung zuwende, möchte ich vorweg die informellen Regeln meines Textzugangs und die Voraussetzungen darlegen. Ich habe dieses Mörike-Gedicht ausgewählt, da es über die engen Grenzen der Mörike-Leser hinaus bekannt ist, durch seine strittige Interpretationsgeschichte in Verruf geraten ist und zudem in Schule und Hochschule zu den am meisten gelesenen Gedichten des 19. Jahrhunderts gehört. Obwohl festgestellt wurde, man streife mit dem Gedicht Auf eine Lampe in der RezeptionsgeschichteRezeption bereits die „Grenzen exegetischen Überdrusses“11, werde ich kontextualistisch interpretieren und dabei die Leitthese entwickeln, dass kontextualistisches Interpretierenkontextualistisches Interpretieren in der Lage ist, neue Fragen an alte Texte zu stellen und aus den Texten neue Bedeutungsebenen zu generieren.
Ich gliedere also diese Ausführungen in vier Abschnitte und folge dem methodischen Grundsatz, dass Interpretieren immer das Zusammenspiel von Beschreiben und Deuten ist. Am Anfang steht die Kenntnissicherung, danach folgt die Deutungsgeschichte bisheriger Interpretationsansätze: Es gilt also, die diversen Deutungen oder divergierenden Deutungsansätze zu sichten und zu bewerten. Der Deutungsstreit um MörikesMörike, Eduard Auf eine LampeAuf eine Lampesagt uns ganz nebenbei auch etwas über die WissenschaftsgeschichteWissenschaftsgeschichte der Germanistik nach 1945. Als Drittes folgt die Klärung des Problembegriffs KunstautonomieKunstautonomie. Und viertens wird das kontextualistische Interpretieren am Beispiel der literaturgeschichtlichen Vernetzung vorgestellt.
„Auf eine Lampe
Noch unverrückt, o schöne Lampe, schmückest du,
An leichten Ketten zierlich aufgehangen hier,
Die Decke des nun fast vergeßnen Lustgemachs.
Auf deiner weißen Marmorschale, deren Rand
Der Efeukranz von goldengrünem Erz umflicht,
Schlingt fröhlich eine Kinderschar den Ringelreihn.
Wie reizend alles! lachend, und ein sanfter Geist
Des Ernstes doch ergossen um die ganze Form –
Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet sein?
Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst.“ (S. 85)
Ich möchte mich bei der Kenntnissicherung nicht mit kleinteiligen Schritten aufhalten. Die einzelnen methodisch-didaktischen Schritte habe ich in meinem Buch Einführung in das Studium der Neueren deutschen Literaturwissenschaft dargelegt, die bei einer Gedichtinterpretation zu beachten sind. Die philologischen, insbesondere die textphilologischen Fakten sind dürr und schnell berichtet, wir orientieren uns dabei an drei Standards einer literaturwissenschaftlichen Textinterpretation von ProduktionProduktion, DistributionDistribution und RezeptionRezeption eines Textes.
Entstanden ist das Gedicht vor dem 30. November 1846, der Erstdruck erfolgte am 30. November 1846 im Morgenblatt für gebildete Leser, das insgesamt in den Jahren 1807 bis 1865 verlegt wurde. Erster Druck in einer von MörikeMörike, Eduard autorisierten Sammelausgabe: Gedichte von Eduard Mörike. Zweite, vermehrte Auflage. Stuttgart, Tübingen 1848. Erneuter Druck, letztgültige Fassung in: Gedichte von Eduard Mörike. Vierte vermehrte Auflage. Stuttgart 1867. Enthalten in allen Mörike-Gesamtausgaben. Derzeitiger Textstatus: Die innerhalb der Werke und Briefe. Historisch-kritischen Gesamtausgabe projektierten Bände mit den Gedichten, Lesarten, Überlieferungs- und Druckgeschichte etc. liegen noch nicht vollständig vor. Seit den 1960er-Jahren wird um eine kritische Edition der Gedichte Mörikes gerungen.12 Im Einzelnen sind dies Band 1,1: Gedichte. Ausgabe von 1867. Text. Hgg. v. Hans-Henrik Krummacher (2003), Band 1,2: Gedichte. Ausgabe von 1867. Lesarten und Erläuterungen. Hgg. v. Hans-Henrik Krummacher (in Vorbereitung), Band 2,1: Gedichte. Nachlese. Text. Hgg. v. Hans-Henrik Krummacher (in Vorbereitung), und Band 2,2: Gedichte. Nachlese. Lesarten und Erläuterungen. Hgg. v. Hans-Henrik Krummacher (in Vorbereitung).13
Das Gedicht Auf eine LampeAuf eine Lampe ist ein Dinggedicht, um diesen 1926 von Kurt Oppert eingeführten und längst bewährten Begriff zu nennen. Mörike hat eine ganze Reihe sogenannter Auf-Gedichte geschrieben, und damit entscheide ich mich bereits für das methodische Verfahren der KontextualisierungKontextualisierung, ein Begriff, den ich am Ende dieses Beitrags nochmals aufgreifen werde. Wenn wir uns die Liste dieser Auf-Gedichte betrachten, springt sofort ins Auge, dass es ausnahmslos Ding- oder Gelegenheits- bzw. Alltagsgedichte sind, u.a. Auf Cleversulzbacher Pfarrvikare, Auf das Grab von Schillers Mutter, Auf den Tod eines Vogels, Auf die Nürtinger Schule, Auf die Prosa eines Beamten, Auf ein altes Bild, Auf eine Christblume und eben auch Auf eine Lampe. Wenn man – und in dieser Einschränkung liegt eine wichtige methodische Begrenzung –, in diese Reihe auch das Gedicht Auf eine Lampe stellt, dann bekommt es von vornherein keinen exklusiven Charakter im Sinne eines Programmgedichts der KunstautonomieKunstautonomie. Das vertrüge sich nicht mit dem Anspruch der Alltagsdinge.
Zur Deutungsgeschichte einer geistesgeschichtlich-werkimmanenten Interpretation: Vom heutigen Standpunkt aus können wir uns fragen, ob das Gedicht Auf eine LampeAuf eine Lampe erst durch die intensive Debatte um die richtige Deutung zwischen Emil StaigerStaiger, Emil und Martin HeideggerHeidegger, Martin rezeptionsgeschichtlich geadelt worden ist.14 Allein die historischen Daten lassen aber keinen Zweifel zu, MörikesMörike, Eduard Auf eine Lampe war schon zu Lebzeiten des Autors eines seiner bekanntesten und beliebtesten Gedichte überhaupt. Und die bildungsgeschichtliche Kanonisierung im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert schuf überhaupt erst die Voraussetzungen, dass sich der Germanist Staiger und der Philosoph Heidegger um eine ‚richtige‘ Auslegung bemühten.
Aus dem etwa halben Hundert Deutungen dieses Gedichts ragen die Interpretationen von Staiger, Heidegger und dem Romanisten Leo SpitzerSpitzer, Leo hervor. Die entscheidende Frage, an der sich die kontroversen Deutungen entzünden, lautet: Was wollte Mörike unter seiner Formulierung „Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst“ (vgl. Schlusszeile) verstanden wissen? Dies berührt die Frage nach der AutorintentionAutorintention. Vielleicht wäre es angebracht, demgegenüber den Begriff der TextintentionTextintention geltend zu machen, so verstanden, dass der Text durchaus etwas anderes zu intendieren vermag als sein Autor ursprünglich wollte. Die Gefahr dabei ist, dass wir den Textbegriff damit ontologisieren.
Für Emil Staiger, den ‚Vater‘ der werkimmanenten Textinterpretation, diente 1950 Mörikes Gedicht als Demonstrationsobjekt, um seine Kunst der InterpretationKunst der Interpretation – und das meint bei Staiger die Kunst der richtigen Interpretation – vor Augen zu führen.15 Staiger kommt zu dem Schluss, das deutsche Verb scheinen müsse mit dem lateinischen videtur wiedergegeben werden, im Sinne von: es hat den Anschein, möglicherweise.16 Das Kunstgebilde „scheint in sich selber selig zu sein und unser gar nicht zu bedürfen“17. Martin HeideggerHeidegger, Martin, der sich StaigersStaiger, Emil Freiburger Vortrag angehört hatte, widerspricht brieflich und reklamiert, scheinen bedeute lucet, er prädiziert das deutsche Wort scheinen als Epiphanie, als leuchten. Heidegger sieht in den beiden letzten Versen des Gedichts HegelsHegel, Georg Wilhelm Friedrich Philosophie in nuce angesprochen. Die Lampe sei SymbolSymbol des Ideals, „das Gedicht selbst ist als sprachliches Kunstgebilde das in der Sprache ruhende Symbol des Kunstwerkes überhaupt“18, Einheit von sinnlichem Scheinen und dem Scheinen der Idee als Wesen des Kunstwerks. Heidegger mahnt Staiger, in Hegels Ästhetik nachzulesen und paraphrasiert entsprechende Textstellen. Er begründet seine Hegel-Referenz mit dem Hinweis, einer der engsten Freunde MörikesMörike, Eduard, Friedrich Theodor VischerVischer, Friedrich Theodor, sei Hegel-Schüler gewesen. Ein biografisches Faktum – denn unstrittig ist die Vischer-Referenz richtig – wird also zum Kriterium einer qualitativ-analytischen Aussage gemacht. Natürlich ist es grundsätzlich legitim, mögliche Bezüge zur hegelschen Ästhetik herzustellen. Aber dann sollte auch nicht verschwiegen werden, was Mörike von Hegels Philosophie hielt, nämlich gar nichts. In einem Paralipomenon zu seinem großen Roman Maler NoltenMaler Nolten notiert Mörike: „Die Hegelschen Begriffs<bewegungen?> Spiegelfechterei“19. Vielleicht hat es Mörike aber auch mit dem Verweis auf philosophische Autoritäten so gehalten wie Erasmus von RotterdamRotterdam, Erasmus von, von dem die erhellenden Verse stammen: „Wozu […] braucht man […] Autoritäten, / wenn, ach, die Lebenserfahrung nur allzu guter Beweis ist“20. Sylvain Guardas (1999) Annahme, Mörikes Gedicht sei formlos, bleibt problematisch. Überhaupt dient ihm das Gedicht eher als Anlass, Hegels ästhetische Anschauungen ausladend zu referieren, mit dem Ergebnis, das Gedicht enthalte „in sich alle notwendigen Bedingungen zu seiner Auslegung und fordert in Form eines ästhetischen Spiels zum Nachdenken über das Symbolische der Lampe auf“21. Methodenkritisch betrachtet bedeutet dies die Rückkehr zur Textimmanenz.
Emil StaigerStaiger, Emil schreibt dann, dass er sich nach dieser philosophischen Verunsicherung daran gemacht habe, seinen gefühlsmäßigen Eindruck über die Richtigkeit seiner Deutung, „mit literaturwissenschaftlichen Mitteln“22 auszubreiten. Anders formuliert kann man auch sagen, Staiger versucht seine Deutung zu verifizieren. Er macht für MörikeMörike, Eduard geltend, dass dieser kein systematischer Denker gewesen sei. Etwas spitz schreibt er HeideggerHeidegger, Martin: „Die Art, wie Sie an den fraglichen Vers herangehen, scheint mit für diesen Dichter zu scholastisch zu sein“23. Staiger stilisiert den Dissens zu einer grundsätzlichen Differenz zwischen philosophischer und dichterischer Sprache, als deren Statthalter er sich selbst versteht.
Heidegger wiederum rechtfertigt seinen HegelHegel, Georg Wilhelm Friedrich-Rückgriff. In langwierigen Erörterungen, die er ein hermeneutisches Vorspiel nennt, steuert er auf den entscheidenden Punkt im Deutungsstreit zu. Nur wer so komplex wie Hegel und nach ihm Heidegger denkt, vermag die dichterische Sprache richtig zu deuten. In Heideggers Worten: Es bedürfe „schon einer großen Sorgfalt“, „um sich auch nur in den Wesensverhältnissen des eigentlichen und uneigentlichen Scheinens, des Erscheinens und des bloßen Scheines im Sinne des schwankenden Meinens zurechtzufinden und die entsprechenden Wortbedeutungen klar und sicher zu gebrauchen“.24 Es versteht sich von selbst, dass sich Heidegger als Sachwalter dieser Sorgfaltspflicht begreift.
Man bekommt nachträglich den Eindruck, je länger der Disput dauert, desto weiter entfernen sich die beiden Interpreten von dem, was ursprünglich und durchaus in guter Absicht richtig erklärt werden sollte, nämlich Mörikes Verse. Zunehmend wird es notwendig, die eigenen Anschauungen umständlich zu erklären, die als missverstanden aufgenommen betrachtet werden. Soweit der Briefwechsel zwischen Staiger und Heidegger.
Noch in demselben Jahr 1951, in dem dieser Disput veröffentlicht wird, meldet sich Leo SpitzerSpitzer, Leo zu Wort. „Das echte Kunstwerk ist nach Mörike“, so schreibt er, „immer in sich geschlossen, lachend-ernst, wohltemperiert“.25 Das leitet er aus dem Dingsymbol der Lampe und ihrer Beschreibung im Gedicht ab. Obwohl sich Spitzer eher an HeideggersHeidegger, Martin Worterklärung von scheinen hält, wirft er diesem doch preziösen Wortprunk vor.26 Er kommt zu folgender Deutungsvariante des Schlussverses: „Das Schöne prangt selig in sich selbst“27. Spitzer beruft sich auf das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm, worin unter dem Lemma scheinen die schwäbische Bedeutung von scheinen im Sinne von schön sein belegt ist.28 Sigurd Burckhardt (1957/58) schließt sich Spitzer an und macht den Spielbegriff geltend. Enthobene Selbstgenügsamkeit kennzeichne MörikesMörike, Eduard Gedicht als Kinderspiel, das lächelnd und schelmisch allen Deutungsversuchen trotze.29 Demgegenüber betont Staiger die Wehmut, die aus dem Gedicht spräche. Er resümiert die Interpretationsdifferenzen zwischen Heidegger, Spitzer und sich mit dem einsichtigen Satz: „Schon unser Briefwechsel hat das Gedicht allzu schwer belastet“30. Das sollten wir in Schule und Hochschule anders sehen, denn Interpretieren heißt auch, wir kennen dies aus der HermeneutikHermeneutik, die Bedeutungsfülle, also die Komplexität eines Textes anzuerkennen, im Gegensatz zum reinen kontemplativen Lesen.
Zur Deutungsgeschichte 2: Formgeschichtlich-gattungstypologische Interpretation:
Werner von Nordheim (1956) sieht MörikeMörike, Eduard als „Schöpfer des Dinggedichts“31. Er definiert diesen Gattungstypus folgendermaßen: „Ein ‚Dinggedicht‘ ist ein Gedicht, welches ein ‚Ding‘ […] um seiner selbst willen in vorwiegend beschreibender Weise behandelt, und zwar ausdrücklich mit dem Anspruch eines Kunstwerkes“32. Als vollkommenstes Beispiel dieser Dingdichtung erscheint ihm Auf eine LampeAuf eine Lampe. Von Nordheim operiert dabei mit Begriffen wie „reine Verkörperung der Idee des Schönen“ und „Wesenheit des Schönen“,33 die deutlich machen, dass hier die Dingdichtung auf eine immaterielle, ja idealistisch-substanzialistische Ebene gehebelt werden muss, um ihre Botschaft herausschütteln zu können.
Zur Deutungsgeschichte einer psychologischen Interpretation: Wilhelm Schneider (1952) liest scheinen als erscheinen und ansehen. Die schöne Lampe bedeute das „Sinnbild der Geschlossenheit, Einheit und Harmonie des echten Kunstwerks und weiterhin als Sinnbild der harmonischen Menschenseele, dann kann von dem Gedicht eine sanft wirkende Kraft ausgehen, die uns mit uns selbst und mit der Welt in Harmonie setzt“34. Das steht in deutlichem Kontrast zu Staigers Lesart der Wehmut, die sich in den Schlussversen ausdrücke. Spitzer erkannte eine idyllische Gelassenheit im letzten Vers.35 HeideggerHeidegger, Martin und StaigerStaiger, Emil hingegen kennzeichneten Wehmut als Grundstimmung des Gedichts, da die Achtung der Menschen vor dem Wesen des Kunstwerks verlorengegangen sei und auch der Dichter selbst sich nicht mehr als Eingeweihter fühlen könne.36 Schneider macht aber auf die Versform aufmerksam und benennt sie analytisch als Trimeter bzw. Senar. Er sieht darin Mörikes bewussten Formwillen am Werk, den Geist der Antike spürbar zu machen.37 Das geht sicherlich zu weit, denn gerade der Rückgriff auf ein antikes Versmaß stiftet eine Spannung zum biedermeierlichen Gegenstand, der besungen wird. Hier wird der Gegenstand geadelt in der Form, dass Mörikes Poetik des Gegenstands ein klassisches Versmaß der hohen Literatur in makelloser Vollendung einem Alltagsgegenstand angedeihen lässt.
In den sechziger, siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts scheint es ruhig geworden zu sein im Wettstreit um die richtige Textinterpretation. Einzelinterpretationen gibt es in diesem Zeitraum so gut wie keine. Moriz Enzinger legt zwar 1965 eine Akademieabhandlung vor, um zu dem Schluss zu gelangen, „nichts wesentlich Neues“38 erarbeitet zu haben, dies aber umso gelehrter. Irmgard Weithases sprechwissenschaftliche Interpretation (1967)39 greift jenseits der rein formalen Silben- und Konsonantenzählung auf die bis dahin erschienenen Interpretationen zurück, und das bedeutet auf die Interpretationen der 1950er-Jahre.40
Das Unbehagen an den bisherigen geistesgeschichtlichen und werkimmanenten Textinterpretationen veranlasste Albrecht Holschuh (1991) die durchaus naheliegende Frage zu stellen, wem MörikesMörike, Eduard Lampe eigentlich leuchte.41 In dieser bemerkenswert textgenauen philologischen Studie gewinnt der Autor Erkenntnisse, die für die Erforschung des LampenAuf eine Lampe-Gedichts außerordentlich wichtig sind. Zugleich markieren sie auch – wissenschaftsgeschichtlich gesehen – deutlich den Unterschied zwischen der Germanistik der 1950er-Jahre und der GermanistikGermanistik am Ende des vorigen Jahrtausends. Auch wenn es nicht gleich um die Darlegung ganzer ästhetischer Theorien bei dieser Gedichtinterpretation geht, wie Holschuh befürchtet, so hat er doch immerhin darin recht, dass die Textinterpretationen der 1950er-Jahre vor allem dazu dienten, eigene ästhetische Reflexionen zu exemplifizieren. Das gilt für HeideggerHeidegger, Martin ebenso wie für StaigerStaiger, Emil, SpitzerSpitzer, Leo, Schneider und Guardini.
Holschuhs Ansatz ist zunächst irritierend, er möchte aus dem Dinggedicht Auf eine Lampe eine Art Erlebnisgedicht machen und sieht sich – aufgrund fehlender biografischer Fakten – gezwungen, gleich Einschränkungen zu formulieren. Ob MörikeMörike, Eduard diese im Gedicht beschriebene Szene wirklich in Bad Mergentheim (seinem damaligen Wohnort) oder sonst wo erlebt habe, sei ungewiss. Allerdings, so muss man kritisch hinzufügen, ist dies für die Textinterpretation auch nebensächlich. Das biografische Detail kann als Moment der biografistischen Methode in der LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft nur insoweit von Interesse sein, als es zur ProduktionProduktion, DistributionDistribution oder RezeptionRezeption eines Textes zusätzliche Erkenntnisse gewinnen lässt. Dasselbe gilt übrigens auch von sozialgeschichtlichen Kontextualisierungsformen.
Holschuh bemerkt ferner, über die Lampe als Haushaltsgerät falle im Gedicht kein Wort. Abgesehen davon, dass eine Deckenlampe schwerlich ein Haushaltsgerät zu sein vermag, ist doch das Gedicht insgesamt eine einzige Rede über dieses, nämlich den Alltagsgegenstand Lampe. Man muss kritisch festhalten, dass die MikrolektüreMikrolektüre eines Textes zum korrigierenden Ausgleich des beständigen Blicks auf den Gesamttext bedarf. Die Reflexion über das Zusammenspiel von Teil und Ganzem und Ganzem und Teil bis hin zu den kontemporären Text-und-Kontext-Variationen bildet die theoretische Grundlage jeglichen literaturwissenschaftlichen Reflektierens. Eine Binsenweisheit ist dies, niedergelegt in der Lehre vom Verstehen, der HermeneutikHermeneutik, das Stichwort vom hermeneutischen Zirkel hat hier seinen Ursprung.
Die positivistische Genauigkeit ist unverzichtbar, aber in Maßen. Die positivistische Methode findet dort ihre Grenzen, wo Genauigkeit unter der Hand durch Faktenspekulation ersetzt wird. Natürlich ist Literaturwissenschaft nur zum ganz geringen Teil eine Tatsachenwissenschaft, immer noch und vor allem ist sie Deutungsarbeit. So bemüht also Holschuh auf der Suche nach Mörikes Lampe die Tatsache (das Faktum), dass Mörike 1845 in der damals im Entstehen begriffenen Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, dem sogenannten Großen Pauly, gelesen hat. Im Band vier findet sich ein Artikel über antike Lampen. Gleichwohl nimmt Holschuh an, Mörike habe nicht einen antiken Gegenstand in Gestalt einer Lampe besungen. Die Suche nach Mörikes Lampe nimmt teils schon groteske Züge an. Man müsste aber nur einmal in ein Antiquitätengeschäft gehen, um eine solche Lampe als biedermeierlicheBiedermeier Dutzendware auszumachen.