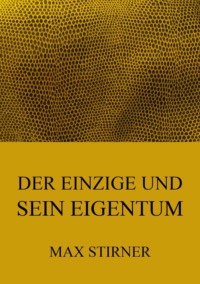Kitabı oku: «Der Einzige und sein Eigentum», sayfa 2
Der Christ hat geistige Interessen, weil er sich erlaubt, ein geistiger Mensch zu sein; der Jude versteht diese Interessen in ihrer Reinheit nicht einmal, weil er sich nicht erlaubt, den Dingen keinen Wert beizulegen. Zur reinen Geistigkeit gelangt er nicht, einer Geistigkeit, wie sie religiös z.B. in dem allein, d.h. ohne Werke rechtfertigenden Glauben der Christen ausgedrückt ist. Ihre Geistlosigkeit entfernt die Juden auf immer von den Christen; denn dem Geistlosen ist der Geistige unverständlich, wie dem Geistigen der Geistlose verächtlich ist. Die Juden haben aber nur den »Geist dieser Welt«.
Der antike Scharfsinn und Tiefsinn liegt so weit vom Geiste und der Geistigkeit der christlichen Welt entfernt, wie die Erde vom Himmel.
Von den Dingen dieser Welt wird, wer sich als freien Geist fühlt, nicht gedrückt und geängstigt, weil er sie nicht achtet; soll man ihre Last noch empfinden, so muß man borniert genug sein, auf sie Gewicht zu legen, wozu augenscheinlich gehört, daß es einem noch um das »liebe Leben« zu tun sei. Wem alles darauf ankommt, sich als freier Geist zu wissen und zu rühren, der fragt wenig danach, wie kümmerlich es ihm dabei ergehe, und denkt überhaupt nicht darüber nach, wie er seine Einrichtungen zu treffen habe, um recht frei oder genußreich zu leben. Die Unbequemlichkeiten des von den Dingen abhängigen Lebens stören ihn nicht, weil er nur geistig und von Geistesnahrung lebt, im übrigen aber, fast ohne es zu wissen, nur frißt oder verschlingt, und wenn ihm der Fraß ausgeht, zwar körperlich stirbt, als Geist aber sich unsterblich weiß und unter einer Andacht oder einem Gedanken die Augen schließt. Sein Leben ist Beschäftigung mit Geistigem, ist – Denken, das übrige schiert ihn nicht; mag er sich mit Geistigem beschäftigen, wie er immer kann und will, in Andacht, in Betrachtung oder in philosophischer Erkenntnis, immer ist das Tun ein Denken, und darum konnte Cartesius, dem dies endlich ganz klar geworden war, den Satz aufstellen: »Ich denke, das heißt: – ich bin«. Mein Denken, heißt es da, ist mein Sein oder mein Leben; nur wenn ich geistig lebe, lebe ich; nur als Geist bin ich wirklich oder – ich bin durch und durch Geist und nichts als Geist. Der unglückliche Peter Schlemihl, der seinen Schatten verloren hat, ist das Porträt jenes zu Geist gewordenen Menschen: denn des Geistes Körper ist schattenlos. – Dagegen wie anders bei den Alten! Wie stark und männlich sie auch gegen die Gewalt der Dinge sich betragen mochten, die Gewalt selbst mußten sie doch anerkennen, und weiter brachten sie es nicht, als daß sie ihr Leben gegen jene so gut als möglich schützten. Spät erst erkannten sie, daß ihr »wahres Leben« nicht das im Kampfe gegen die Dinge der Welt geführte, sondern das »geistige«, von diesen Dingen »abgewandte« sei, und als sie dies einsahen, da wurden sie – Christen, d.h. die »Neuen« und Neuerer gegen die Alten. Das von den Dingen abgewandte, das geistige Leben, zieht aber keine Nahrung mehr aus der Natur, sondern »lebt nur von Gedanken«, und ist deshalb nicht mehr »Leben«, sondern – Denken.
Nun muß man jedoch nicht glauben, die Alten seien gedankenlos gewesen, wie man ja auch den geistigsten Menschen sich nicht so vorstellen darf, als könnte er leblos sein. Vielmehr hatten sie über alles, über die Welt, den Menschen, die Götter usw. ihre Gedanken, und bewiesen sich eifrig tätig, alles dies sich zum Bewußtsein zu bringen. Allein den Gedanken kannten sie nicht, wenn sie auch an allerlei dachten und »sich mit ihren Gedanken plagten«. Man vergleiche ihnen gegenüber den christlichen Spruch: »Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Gedanken höher, denn eure Gedanken«, und erinnere sich dessen, was oben über unsere Kindergedanken gesagt wurde.
Was sucht also das Altertum? Den wahren Lebensgenuß, Genuß des Lebens! Am Ende wird es auf das »wahre Leben« hinauskommen.
Der griechische Dichter Simonides singt: »Gesundheit ist das edelste Gut dem sterblichen Menschen, das nächste nach diesem ist Schönheit, das dritte Reichtum, ohne Tücke erlanget, das vierte geselliger Freuden Genuß in junger Freunde Gesellschaft.« Das sind alles Lebensgüter, Lebensfreuden. Wonach anders suchte Diogenes von Sinope, als nach dem wahren Lebensgenuß, den er in der möglichst geringen Bedürftigkeit entdeckte? Wonach anders Aristipp, der ihn im heiteren Mute unter allen Lagen fand? Sie suchen den heitern, ungetrübten Lebensmut, die Heiterkeit, sie suchen »guter Dinge zu sein«.
Die Stoiker wollen den Weisen verwirklichen, den Mann der Lebensweisheit, den Mann, der zu leben weiß, also ein weises Leben; sie finden ihn in der Verachtung der Welt, in einem Leben ohne Lebensentwicklung, ohne Ausbreitung, ohne freundliches Vernehmen mit der Welt, d.h. im isolierten Leben, im Leben als Leben, nicht im Mitleben: nur der Stoiker lebt, alles andere ist für ihn tot. Umgekehrt verlangen die Epikuräer ein bewegliches Leben.
Die Alten verlangen, da sie guter Dinge sein wollen, nach Wohlleben (die Juden besonders nach einem langen, mit Kindern und Gütern gesegneten Leben), nach der Eudämonie, dem Wohlsein in den verschiedensten Formen. Demokrit z.B. rühmt als solches die »Gemütsruhe«, in der sich's »sanft lebe, ohne Furcht und ohne Aufregung«.
Er meint also, mit ihr fahre er am besten, bereite sich das beste Los und komme am besten durch die Welt. Da er aber von der Welt nicht loskommen kann, und zwar gerade aus dem Grunde es nicht kann, weil seine ganze Tätigkeit in dem Bemühen aufgeht, von ihr loszukommen, also im Abstoßen der Welt (wozu doch notwendig die abstoßbare und abgestoßene bestehen bleiben muß, widrigenfalls nichts mehr abzustoßen wäre): so erreicht er höchstens einen äußersten Grad der Befreiung, und unterscheidet sich von den weniger Befreiten nur dem Grade nach. Käme er selbst bis zur irdischen Sinnenertötung, die nur noch das eintönige Wispern des Wortes »Brahm« zuläßt, er unterschiede sich dennoch nicht wesentlich vom sinnlichen Menschen.
Selbst die stoische Haltung und Mannestugend läuft nur darauf hinaus, daß man sich gegen die Welt zu erhalten und zu behaupten habe, und die Ethik der Stoiker (ihre einzige Wissenschaft, da sie nichts von dem Geiste auszusagen wußten, als wie er sich zur Welt verhalten solle, und von der Natur [Physik] nur dies, daß der Weise sich gegen sie zu behaupten nahe) ist nicht eine Lehre des Geistes, sondern nur eine Lehre der Weltabstoßung und Selbstbehauptung gegen die Welt. Und diese besteht in der »Unerschütterlichkeit und dem Gleichmute des Lebens«, also in der ausdrücklichsten Römertugend.
Weiter als zu dieser Lebensweisheit brachten es auch die Römer nicht (Horaz, Cicero usw.).
Das Wohlergehen (Hedone) der Epikuräer ist dieselbe Lebensweisheit wie die der Stoiker, nur listiger, betrügerischer. Sie lehren nur ein anderes Verhalten gegen die Welt, ermahnen nur, eine kluge Haltung gegen die Welt sich zu geben: die Welt muß betrogen werden, denn sie ist meine Feindin.
Vollständig wird der Bruch mit der Welt von den Skeptikern vollführt. Meine ganze Beziehung zur Welt ist »wert- und wahrheitslos«. Timon sagt: »Die Empfindungen und Gedanken, welche wir aus der Welt schöpfen, enthalten keine Wahrheit.« »Was ist Wahrheit?!« ruft Pilatus aus. Die Welt ist nach Pyrrhons Lehre weder gut noch schlecht, weder schön noch häßlich usw., sondern dies sind Prädikate, welche ich ihr gebe. Timon sagt: »An sich sei weder etwas gut noch sei es schlecht, sondern der Mensch denke sich's nur so;« der Welt gegenüber bleibe nur die Ataraxie (die Ungerührtheit) und Aphasie (das Verstummen – oder mit andern Worten: die isolierte Innerlichkeit) übrig. In der Welt sei »keine Wahrheit mehr zu erkennen«, die Dinge widersprechen sich, die Gedanken über die Dinge seien unterschiedslos (gut und schlecht seien einerlei, so daß, was der eine gut nennt, ein anderer schlecht findet); da sei es mit der Erkenntnis der »Wahrheit« aus, und nur der erkenntnislose Mensch, der Mensch, welcher an der Welt nichts zu erkennen findet, bleibe übrig, und dieser Mensch lasse die wahrheitsleere Welt eben stehen und mache sich nichts aus ihr.
So wird das Altertum mit der Welt der Dinge, der Weltordnung, dem Weltganzen fertig; zur Weltordnung oder den Dingen dieser Welt gehört aber nicht etwa nur die Natur, sondern alle Verhältnisse, in welche der Mensch durch die Natur sich gestellt sieht, z.B. die Familie, das Gemeinwesen, kurz die sogenannten »natürlichen Bande«. Mit der Welt des Geistes beginnt dann das Christentum. Der Mensch, welcher der Welt noch gewappnet gegenübersteht, ist der Alte, der – Heide (wozu auch der Jude als Nichtchrist gehört); der Mensch, welchen nichts mehr leitet als seine »Herzenslust«, seine Teilnahme, Mitgefühl, sein – Geist, ist der Neue, der Christ.
Da die Alten auf die Weltüberwindung hinarbeiteten und den Menschen von den schweren umstrickenden Banden des Zusammenhanges mit Anderem zu erlösen strebten, so kamen sie auch zuletzt zur Auflösung des Staates und Bevorzugung alles Privaten. Gemeinwesen, Familie usw. sind als natürliche Verhältnisse lästige Hemmungen, die meine geistige Freiheit schmälern.
2. Die Neuen
»Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden«4.
Wurde oben gesagt: »den Alten war die Welt eine Wahrheit,« so müssen wir sagen: »den Neuen war der Geist eine Wahrheit,« dürfen aber, wie dort, so hier den Zusatz nicht auslassen: eine Wahrheit, hinter deren Unwahrheit sie zu kommen suchten und endlich wirklich kommen.
Ein ähnlicher Gang, wie das Altertum ihn genommen, läßt sich auch am Christentum nachweisen, indem bis in die die Reformation vorbereitende Zeit hinein der Verstand unter der Herrschaft der christlichen Dogmen gefangen gehalten wurde, im vorreformatorischen Jahrhundert aber sophistisch sich erhob und mit allen Glaubenssätzen ein ketzerisches Spiel trieb. Dabei hieß es denn, zumal in Italien und am römischen Hofe: wenn nur das Herz christlich gesinnt bleibt, so mag der Verstand immerhin seine Lust genießen.
Man war längst vor der Reformation so sehr an spitzfindiges »Gezänk« gewöhnt, daß der Papst und die meisten auch Luthers Auftreten anfänglich für ein bloßes »Mönchsgezänk« ansahen. Der Humanismus entspricht der Sophistik, und wie zur Zeit der Sophisten das griechische Leben in höchster Blüte stand (Perikleisches Zeitalter), so geschah das Glänzendste zur Zeit des Humanismus, oder, wie man vielleicht auch sagen könnte, des Macchiavellismus (Buchdruckerkunst, Neue Welt usw.). Das Herz war in dieser Zeit noch weit davon entfernt, des christlichen Inhalts sich entledigen zu wollen.
Aber die Reformation machte endlich, wie Sokrates, mit dem Herzen selber Ernst, und seitdem sind die Herzen zusehends – unchristlicher geworden. Indem man mit Luther anfing, sich die Sache zu Herzen zu nehmen, mußte dieser Schritt der Reformation dahin führen, daß auch das Herz von der schweren Last der Christlichkeit erleichtert wird. Das Herz, von Tag zu Tag unchristlicher, verliert den Inhalt, mit welchem es sich beschäftigt, bis zuletzt ihm nichts als die leere Herzlichkeit übrig bleibt, die ganze allgemeine Menschenliebe, die Liebe des Menschen, das Freiheitsbewußtsein, das »Selbstbewußtsein«.
So erst ist das Christentum vollendet, weil es kahl, abgestorben und inhaltsleer geworden ist. Es gibt nun keinen Inhalt mehr, gegen welchen das Herz sich nicht auflehnte, es sei denn, daß es unbewußt oder ohne »Selbstbewußtsein« von ihm beschlichen würde. Das Herz kritisiert alles, was sich eindrängen will, mit schonungsloser Unbarmherzigkeit zu Tode, und ist keiner Freundschaft, keiner Liebe (außer eben unbewußt oder überrumpelt) fähig. Was gäbe es auch an den Menschen zu lieben, da sie allesamt »Egoisten« sind, keiner der Mensch als solcher, d.h. keiner nur Geist. Der Christ liebt nur den Geist; wo wäre aber einer, der wirklich nichts als Geist wäre?
Den leibhaftigen Menschen mit Haut und Haaren lieb zu haben, das wäre ja keine »geistige« Herzlichkeit mehr, wäre ein Verrat an der »reinen« Herzlichkeit, dem »theoretischen Interesse«. Denn man stelle sich die reine Herzlichkeit nur nicht vor wie jene Gemütlichkeit, die jedermann freundlich die Hand drückt; im Gegenteil, die reine Herzlichkeit ist gegen niemand herzlich, sie ist nur theoretische Teilnahme, Anteil am Menschen als Menschen, nicht als Person. Die Person ist ihr widerlich, weil sie »egoistisch«, weil sie nicht der Mensch, diese Idee, ist. Nur für die Idee aber gibt es ein theoretisches Interesse. Für die reine Herzlichkeit oder die reine Theorie sind die Menschen nur da, um kritisiert, verhöhnt und gründlichst verachtet zu werden: sie sind für sie nicht minder, als für den fanatischen Pfaffen, nur »Dreck« und sonst dergleichen Sauberes.
Auf diese äußerste Spitze interesseloser Herzlichkeit getrieben, müssen wir endlich inne werden, daß der Geilt, welchen der Christ allein liebt, nichts ist, oder daß der Geist eine – Lüge ist.
Was hier gedrängt und wohl noch unverständlich hingeworfen wurde, wird sich im weiteren Verlauf hoffentlich aufklären.
Nehmen wir die von den Alten hinterlassene Erbschaft auf und machen wir als tätige Arbeiter damit so viel, als sich – damit machen läßt! Die Welt liegt verachtet zu unseren Füßen, tief unter uns und unserem Himmel, in den ihre mächtigen Arme nicht mehr hineingreifen und ihr sinnbetäubender Hauch nicht eindringt; wie verführerisch sie sich auch gebärde, sie kann nichts als unsern Sinn betören, den Geist – und Geist sind wir doch allein wahrhaft – irrt sie nicht. Einmal hinter die Dinge gekommen, ist der Geist auch über sie gekommen, und frei geworden von ihren Banden, ein entknechteter, jenseitiger, freier. So spricht die »geistige Freiheit«.
Dem Geiste, der nach langem Mühen die Welt los geworden ist, dem weltlosen Geiste, bleibt nach dem Verluste der Welt und des Weltlichen nichts übrig, als – der Geist und das Geistige.
Da er jedoch sich von der Welt nur entfernt und zu einem von ihr freien Wesen gemacht hat, ohne sie wirklich vernichten zu können, so bleibt sie ihm ein unwegräumbarer Anstoß, ein in Verruf gebrachtes Wesen, und da er andererseits nichts kennt und anerkennt, als Geist und Geistiges, so muß er fortdauernd sich mit der Sehnsucht tragen, die Welt zu vergeistigen, d.h. sie aus dem »Verschiß« zu erlösen. Deshalb geht er, wie ein Jüngling, mit Welterlösungs- oder Weltverbesserungsplänen um.
Die Alten dienten, wir sahen es, dem Natürlichen, Weltlichen, der natürlichen Weltordnung, aber sie fragten sich unaufhörlich, ob sie denn dieses Dienstes sich nicht entheben könnten, und als sie in stets erneuten Empörungsversuchen sich todmüde gearbeitet hatten, da ward ihnen unter ihren letzten Seufzern der Gott geboren, der »Weltüberwinder«. All ihr Tun war nichts gewesen als Weltweisheit, ein Trachten, hinter und über die Welt hinaus zu kommen. Und was ist die Weisheit der vielen folgenden Jahrhunderte? Hinter was suchten die Neuen zu kommen? Hinter die Welt nicht mehr, denn das hatten die Alten vollbracht, sondern hinter den Gott, den jene ihnen hinterließen, hinter den Gott, »der Geist ist«, hinter alles, was des Geistes ist, das Geistige. Die Tätigkeit des Geistes aber, der »selbst die Tiefen der Gottheit erforscht«, ist die Gottesgelahrtheit. Haben die Alten nichts aufzuweisen als Weltweisheit, so brachten und bringen es die Neuen niemals weiter als zur Gottesgelahrtheit. Wir werden später sehen, daß selbst die neuesten Empörungen gegen Gott nichts als die äußersten Anstrengungen der »Gottesgelahrtheit«, d.h. theologische Insurrektionen sind.
§ 1. Der Geist
Das Geisterreich ist ungeheuer groß, des Geistigen unendlich viel: sehen wir doch zu, was denn der Geist, diese Hinterlassenschaft der Alten, eigentlich ist.
Aus ihren Geburtswehen ging er hervor, sie selbst aber konnten sich nicht als Geist aussprechen: sie konnten ihn gebären, sprechen mußte er selbst. Der »geborene Gott, der Menschensohn«, spricht erst das Wort aus, daß der Geist, d.h. er, der Gott, es mit nichts Irdischem und keinem irdischen Verhältnisse zu tun habe, sondern lediglich mit dem Geiste und geistigen Verhältnissen.
Ist etwa mein unter allen Schlägen der Welt unvertilgbarer Mut, meine Unbeugsamkeit und mein Trotz, weil ihm die Welt nichts anhat, schon im vollen Sinne der Geist? So wäre er ja noch mit der Welt in Feindschaft, und all sein Tun beschränkte sich darauf, ihr nur nicht zu unterliegen! Nein, bevor er sich nicht allein mit sich selbst beschäftigt, bevor er es nicht mit seiner Welt, der geistigen, allein zu tun hat, ist er nicht freier Geist, sondern nur der »Geist dieser Welt«, der an sie gefesselte. Der Geist ist freier Geist, d.h. wirklich Geist erst in einer ihm eigenen Welt; in »dieser«, der irdischen Welt, ist er ein Fremdling. Nur mittels einer geistigen Welt ist der Geist wirklich Geist, denn »diese« Welt versteht ihn nicht und weiß »das Mädchen aus der Fremde« nicht bei sich zu behalten.
Woher soll ihm diese geistige Welt aber kommen? Woher anders als aus ihm selbst! Er muß sich offenbaren, und die Worte, die er spricht, die Offenbarungen, in denen er sich enthüllt, die sind seine Welt. Wie ein Phantast nur in den phantastischen Gebilden, die er selber erschafft, lebt und seine Welt hat, wie ein Narr sich seine eigene Traumwelt erzeugt, ohne welche er eben kein Narr zu sein vermöchte, so muß der Geist sich seine Geisterwelt erschaffen, und ist, bevor er sie erschafft, nicht Geist.
Also seine Schöpfungen machen ihn zum Geist, und an den Geschöpfen erkennt man ihn, den Schöpfer: in ihnen lebt er, sie sind seine Welt.
Was ist nun der Geist? Er ist der Schöpfer einer geistigen Welt! Auch an dir und mir erkennt man erst Geist an, wenn man sieht, daß wir Geistiges uns angeeignet haben, d.h. Gedanken, mögen sie uns auch vorgeführt worden sein, doch in uns zum Leben gebracht haben; denn solange wir Kinder waren, hätte man uns die erbaulichsten Gedanken vorlegen können, ohne daß wir gewollt oder imstande gewesen wären, sie in uns wiederzuerzeugen. So ist auch der Geist nur, wenn er Geistiges schafft: er ist nur mit dem Geistigen, seinem Geschöpfe, zusammen wirklich.
Da wir ihn denn an seinen Werken erkennen, so fragt sich's, welches diese Werke seien. Die Werke oder Kinder des Geistes sind aber nichts anderes als – Geister.
Hätte ich Juden, Juden von echtem Schrot und Korn vor mir, so müßte ich hier aufhören und sie vor diesem Mysterium stehen lassen, wie sie seit beinahe zweitausend Jahren ungläubig und erkenntnislos davor stehen geblichen sind. Da du aber, mein lieber Leser, wenigstens kein Vollblutsjude bist – denn ein solcher wird sich nicht bis hierher verirren –, so wollen wir noch eine Strecke Weges miteinander machen, bis auch du vielleicht mir den Rücken kehrst, weil ich dir ins Gesicht lache.
Sagte dir jemand, du seiest ganz Geist, so würdest du an deinen Leib fassen und ihm nicht glauben, sondern antworten: ich habe wohl Geist, existiere aber nicht bloß als Geist, sondern bin ein leibhaftiger Mensch. Du würdest dich noch immer von »deinem Geiste« unterscheiden. Aber, erwidert jener, es ist deine Bestimmung, wenn du auch jetzt noch in den Fesseln des Leibes einhergehst, dereinst ein »seliger Geist« zu werden, und wie du das künftige Aussehen dieses Geistes dir auch vorstellen magst, so ist doch so viel gewiß, daß du im Tode diesen Leib ausziehen und gleichwohl dich, d.h. deinen Geist, für die Ewigkeit erhalten wirst; mithin ist dein Geist das Ewige und Wahre an dir, der Leib nur eine diesseitige Wohnung, welche du verlassen und vielleicht mit einer andern vertauschen kannst.
Nun glaubst du ihm! Für jetzt zwar bist du nicht bloß Geist, aber wenn du einst aus dem sterblichen Leibe auswandern mußt, dann wirst du ohne den Leib dich behelfen müssen, und darum tut es not, daß du dich vorsehest und beizeiten für dein eigentliches Ich sorgest. »Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele!«
Gesetzt aber auch, Zweifel, im Laufe der Zeit gegen die christlichen Glaubenssätze erhoben, haben dich längst des Glaubens an die Unsterblichkeit deines Geistes beraubt: einen Satz hast du dennoch ungerüttelt gelassen, und der einen Wahrheit hängst du immer noch unbefangen an, daß der Geist dein besser Teil sei, und daß das Geistige größere Ansprüche an dich habe, als alles andere. Du stimmst trotz all deines Atheismus mit dem Unsterblichkeitsgläubigen im Eifer gegen den Egoismus zusammen.
Wen aber denkst du dir unter dem Egoisten? Einen Menschen, der, anstatt einer Idee, d.h. einem Geistigen zu leben, und ihr seinen persönlichen Vorteil zu opfern, dem letzteren dient. Ein guter Patriot z.B. trägt seine Opfer auf den Altar des Vaterlandes, daß aber das Vaterland eine Idee sei, läßt sich nicht bestreiten, da es für geistesunfähige Tiere oder noch geistlose Kinder kein Vaterland und keinen Patriotismus gibt. Bewährt sich nun jemand nicht als einen guten Patrioten, so verrät er in bezug aufs Vaterland seinen Egoismus. Und so verhält sich's in unzähligen andern Fällen; wer in der menschlichen Gesellschaft ein Vorrecht sich zunutze macht, der sündigt egoistisch gegen die Idee der Gleichheit; wer Herrschaft übt, den schilt man einen Egoisten gegen die Idee der Freiheit usw.
Darum verachtest du den Egoisten, weil er das Geistige gegen das Persönliche zurücksetzt, und für sich besorgt ist, wo du ihn einer Idee zu Liebe handeln sehen möchtest. Ihr unterscheidet euch darin, daß du den Geist, er aber sich zum Mittelpunkte macht, oder daß du dein Ich entzweist und dein »eigentliches Ich«, den Geist, zum Gebieter des wertloseren Restes erhebst, während er von dieser Entzweiung nichts wissen will, und geistige und materielle Interessen eben nach seiner Lust verfolgt. Du meinst zwar nur auf diejenigen loszuziehen, welche gar kein geistiges Interesse fassen, in der Tat aber fluchst du auf alle, welche das geistige Interesse nicht für ihr »wahres und höchstes« ansehen. Du treibst den Ritterdienst für dieses Schöne so weit, daß du behauptest, sie sei die einzige Schönheit der Welt. Du lebst nicht dir, sondern deinem Geiste und dem, was des Geistes ist, d.h. Ideen.
Da der Geist nur ist, indem er Geistiges schafft, so sehen wir uns nach einer ersten Schöpfung um. Hat er diese erst vollbracht, so folgt fortan eine natürliche Fortpflanzung von Schöpfungen, wie nach der Mythe nur die ersten Menschen geschaffen zu werden brauchten, das übrige Geschlecht sich von selbst fortpflanzte. Die erste Schöpfung hingegen muß, »aus dem Nichts« hervorgehen, d.h. der Geist hat zu ihrer Verwirklichung nichts weiter als sich selber, oder vielmehr, er hat sich noch nicht einmal, sondern muß sich erschaffen: seine erste Schöpfung ist daher er selber, der Geist. So mystisch dies auch klinge, so erleben wir's doch als eine alltägliche Erfahrung. Bist du eher ein Denkender, als du denkst? Indem du den ersten Gedanken erschaffst, erschaffst du dich, den Denkenden; denn du denkst nicht, bevor du einen Gedanken denkst, d.h. hast. Macht dich nicht erst dein Singen zum Sänger, dein Sprechen zum sprechenden Menschen? Nun so macht dich auch das Hervorbringen von Geistigen erst zum Geiste.
Wie du indes vom Denker, Sänger und Sprecher dich unterscheidest, so unterscheidest du dich nicht minder vom Geiste und fühlst sehr wohl, daß du noch etwas anderes als Geist bist. Allein wie dem denkenden Ich im Enthusiasmus des Denkens leicht Hören und Sehen vergeht, so hat auch dich der Geist-Enthusiasmus ergriffen, und du sehnst dich nun mit aller Gewalt, ganz Geist zu werden und im Geiste aufzugehen. Der Geist ist dein Ideal, das Unerreichte, das Jenseitige: Geist heißt dein – Gott, »Gott ist Geist«.
Gegen alles, was nicht Geist ist, bist du ein Eiferer, und darum eiferst du gegen dich selbst, der du einen Rest von Nichtgeistigem nicht los wirst. Statt zu sagen: »ich bin mehr als Geist,« sagst du mit Zerknirschung: »ich bin weniger als Geist, und Geist, reinen Geist, oder der Geist, der nichts als Geist, den kann ich mir nur denken, bin es aber nicht, und da ich's nicht bin, so ist's ein anderer, existiert als ein anderer, den ich ›Gott‹ nenne.«
Es liegt in der Natur der Sache, daß der Geist, der als reiner Geist existieren soll, ein jenseitiger sein muß, denn da ich's nicht bin, so kann er nur außer mir sein, da ein Mensch überhaupt nicht völlig in dem Begriffe »Geist« aufgeht, so kann der reine Geist, der Geist als solcher, nur außerhalb der Menschen sein, nur jenseits der Menschenwelt, nicht irdisch, sondern himmlisch.
Nur aus diesem Zwiespalt, in welchem ich und der Geist liegen, nur weil ich und Geist nicht Namen für ein und dasselbe, sondern verschiedene Namen für völlig Verschiedenes sind, nur weil ich nicht Geist und Geist nicht ich ist: nur daraus erklärt sich ganz tautologisch die Notwendigkeit, daß der Geist im Jenseits haust, d.h. Gott ist.
Daraus geht aber auch hervor, wie durchaus theologisch, d.h. gottesgelahrt, die Befreiung ist, welche Feuerbach5 uns zu geben sich bemüht. Er sagt nämlich, wir hätten unser eigenes Wesen nur verkannt und darum es im Jenseits gesucht, jetzt aber, da wir einsähen, daß Gott nur unser menschliches Wesen sei, müßten wir es wieder als das unsere anerkennen und aus dem Jenseits in das Diesseits zurückversetzen. Den Gott, der Geist ist, nennt Feuerbach »unser Wesen« zu uns in einen Gegensatz gebracht, daß wir in ein wesentliches und ein unwesentliches Ich zerspalten werden. Rücken wir damit nicht wieder in das traurige Elend zurück, aus uns selbst uns verbannt zu sehen?
Was gewinnen wir denn, wenn wir das Göttliche außer uns zur Abwechslung einmal in uns verlegen? Sind wir das, was in uns ist? So wenig als wir das sind, was außer uns ist. Ich bin so wenig mein Herz, als ich meine Herzgeliebte, dieses mein »anderes Ich« bin. Gerade weil wir nicht der Geist sind, der in uns wohnt, gerade darum mußten wir ihn außer uns versetzen: er war nicht wir, fiel nicht mit uns in eins zusammen, und darum konnten wir ihn nicht anders existierend denken als außer uns, jenseits uns, im Jenseits.
Mit der Kraft der Verzweiflung greift Feuerbach nach dem gesamten Inhalt des Christentums, nicht, um ihn wegzuwerfen, nein, um ihn an sich zu reißen, um ihn, den langersehnten, immer ferngebliebenen, mit einer letzten Anstrengung aus seinem Himmel zu ziehen und auf ewig bei sich zu behalten. Ist das nicht ein Griff der letzten Verzweiflung, ein Griff auf Leben und Tod, und ist es nicht zugleich die christliche Sehnsucht und Begierde nach dem Jenseits? Der Heros will nicht in das Jenseits eingehen, sondern das Jenseits an sich heranziehen, und zwingen, daß es zum Diesseits werde! Und schreit seitdem nicht alle Welt, mit mehr oder weniger Bewußtsein, aufs »Diesseits« komme es an, und der Himmel müsse auf die Erde kommen und schon hier erlebt werden?
Stellen wir in Kürze die theologische Ansicht Feuerbachs und unsern Widerspruch einander gegenüber! »Das Wesen des Menschen ist des Menschen höchstes Wesen; das höchste Wesen wird nun zwar von der Religion Gott genannt und als ein gegenständliches Wesen betrachtet, in Wahrheit aber ist es nur des Menschen eigenes Wesen, und deshalb ist der Wendepunkt der Weltgeschichte der, daß fortan dem Menschen nicht mehr Gott als Gott, sondern der Mensch als Gott erscheinen soll«6.
Wir erwidern hierauf: »Das höchste Wesen ist allerdings das Wesen des Menschen, aber eben weil es sein Wesen und nicht er selbst ist, so bleibt es sich ganz gleich, ob wir es außer ihm sehen und als ›Gott‹ anschauen, oder in ihm finden und ›Wesen des Menschen‹ oder ›der Mensch‹ nennen. Ich bin weder Gott noch der Mensch, weder das höchste Wesen noch mein Wesen, und darum ist's in der Hauptsache einerlei, ob ich das Wesen in mir oder außer mir denke. Ja wir denken auch wirklich immer das höchste Wesen in beiderlei Jenseitigkeit, in der innerlichen und äußerlichen, zugleich: denn der ›Geist Gottes‹ ist nach christlicher Anschauung auch ›unser Geist‹ und ›wohnet in uns‹7. Er wohnt im Himmel und wohnt in uns; wir armen Dinger sind eben nur seine ›Wohnung‹, und wenn Feuerbach noch die himmlische Wohnung desselben zerstört, und ihn nötigt, mit Sack und Pack zu uns zu ziehen, so werden wir, sein irdisches Logis, sehr überfüllt werden.«
Doch nach dieser Ausschweifung, die wir uns, gedächten wir überhaupt nach dem Schnürchen zu gehen, auf spätere Blätter hätten versparen müssen, um eine Wiederholung zu vermeiden, kehren wir zur ersten Schöpfung des Geistes, dem Geiste selbst, zurück.
Der Geist ist etwas anderes als ich. Dieses andere aber, was ist's?