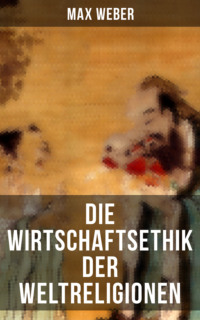Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 11
Was von solchen kastenartigen Erscheinungen bis in die Gegenwart geblieben war, bildete nur einen kümmerlichen Rest der einstigen ständischen Gliederung, deren praktische Konsequenz vor allem in der Befreiung der privilegierten Stände (»große Familien« – der Ausdruck: »die hundert Familien« für »das Reich« meinte diese Schicht – und Literaten) von der Fronpflicht und Prügelstrafe (die bei ihnen in Geld und Haft umgewandelt wurde) bestand. Degradation zum »Plebejer« war möglich. Die alte erbcharismatische ständische Gliederung wurde schon früh durch die für fiskalische Zwecke stets erneut vorgenommene Gliederung nach reinen Besitz klassen durchbrochen.
Neben den Sippen, den Gilden und Zünften blühte im neuzeitlichen China – für die Vergangenheit ist für den Außenstehenden228 Sicheres nicht zu ermitteln – die Assoziation in Form des Klubs, hwui, auf allen, auch ökonomischen, kreditgenossenschaftlichen, Gebieten229. Dies soll uns im einzelnen hier nicht interessieren. Ziel und Sporn des Ehrgeizes und soziale Legitimation für den, der sie erreichte, war jedenfalls in modernen Zeiten die Zugehörigkeit zu einem angesehenen Klub in der chinesischen Nivelliertheit wie in der amerikanischen Demokratie. Ganz ebenso wie das am Laden angeheftete Aufnahmediplom der chinesischen Zunft dem Käufer die Warenqualität garantierte230. Die Extensität der patrimonialbureaukratischen Verwaltung in Verbindung mit dem Fehlen einer rechtlich gesicherten ständischen Gliederung bedingte auch diese Erscheinungen.
Außer einem verliehenen Titularadel existierten in der Neuzeit – wenn die strenge Scheidung der im Mandschu-Heerbann registrierten Familien, der Ausdruck der seit dem 17. Jahrhundert bestehenden Fremdherrschaft, beiseite gelassen wird – geburtsständische Unterschiede unter Chinesen selbst, sahen wir, nicht mehr. Und nachdem zuerst im 8. Jahrh. die »bürgerlichen« Schichten eine starke Lockerung der polizeistaatlichen Fesselung erlangt hatten, bestand im 19. Jahrhundert, und zwar offenbar seit langer Zeit: Freizügigkeit, obwohl auch diese in offiziellen Edikten nicht anerkannt war. Die Zulassung zur Ansiedelung und zum Grundbesitz in einer andern als der Heimatgemeinde ist sicherlich, wie im Okzident, erst durch den Fiskalismus erzwungen worden. Seit 1794 erwarb man die Ortszugehörigkeit durch Erwerb von Grundbesitz und 20 jährige Steuerzahlung und verlor damit die Ortszugehörigkeit in der Heimatgemeinde231. Ebenso bestand seit langem – so sehr (1671) das »Heilige Edikt« noch das Bleiben im Beruf empfahl – freie Berufswahl. In der Neuzeit bestand weder Paßzwang noch Schul- oder Militärdienstzwang. Ebenso fehlten Wucher- und ähnliche den Güterverkehr beschränkende Gesetze. Immer wieder muß angesichts all dessen betont werden: Dieser, der freien Entfaltung des bürgerlichen Erwerbs scheinbar höchst förderliche Zustand hat dennoch keine Entwicklung eines Bürgertums okzidentalen Gepräges hervorgebracht. Wie wir sahen, sind nicht einmal diejenigen Formen kapitalistischen Erwerbes zur Vollreife gelangt, welche im Okzident schon das Mittelalter kannte. Es hätte sich, – wieder die alte Frage: aus den erwähnten kleinkapitalistischen Ansätzen, rein ökonomisch angesehen, recht gut ein rein bürgerlicher, gewerblicher Kapitalismus entwickeln können. Eine Reihe von Gründen lernten wir schon kennen. Sie führten fast alle auf die Staats struktur zurück.
Politisch stand die patrimoniale Staatsform, vor allem der patrimoniale Charakter der Verwaltung und Rechtsfindung mit ihren typischen Folgen: dem Nebeneinander eines Reiches der unerschütterlichen heiligen Tradition und eines Reiches der absolut freien Willkür und Gnade, hier wie überall der Entwicklung wenigstens des in dieser Hinsicht besonders empfindlichen gewerblichen Kapitalismus im Wege: das rational kalkulierbare Funktionieren der Verwaltung und Rechtspflege, welches ein zum rationalen Betrieb sich entwickelndes Gewerbe bedurfte, fehlte. In China, wie in Indien, wie im islamischen Rechtsgebiet und überhaupt überall, wo nicht rationale Rechtsschaffung und Rechtsfindung gesiegt hatte, galt der Satz: »Willkür bricht Landrecht«. Er konnte aber der Entwicklung kapitalistischer Rechtsinstitute nicht, wie er es im okzidentalen Mittelalter tat, zugute kommen, weil einerseits die korporative Autonomie der Städte als politischer Einheiten und andererseits die privilegienmäßig garantierte und fixierte Festlegung der entscheidenden Rechtsinstitutionen: – die, beide zusammen, im Mittelalter, gerade mit Hilfe dieser Grundsätze, alle dem Kapitalismus gemäßen Rechtsformen geschaffen haben, – fehlte. Das Recht war zwar in weitem Umfang nicht mehr eine von Ewigkeit her geltende und nur – durch magische Mittel – richtig zu »findende« Norm. Denn die kaiserliche Verwaltung war sehr fruchtbar gewesen in der Schaffung massenhaften Statutarrechtes. Und zwar zeichnen sich ihre Bestimmungen, im Gegensatz etwa zu den patriarchalen Belehrungen und Vermahnungen buddhistischer Monarchen Indiens, – mit denen die ethischen oder verwaltungsmäßigen Anordnungen manche Aehnlichkeit haben –, wenigstens auf dem eigentlichen Rechts gebiet durch relativ knappe geschäftliche Form, und z.B. auf dem Gebiet des Strafrechtes, wie besonders J. Kohler betont hat, durch ein ziemliches Maß von Sublimierung der Tatbestände (Berücksichtigung der »Gesinnung«) aus. Diese Statuten sind auch (im Ta Tsing Liu Li) systematisch gesammelt. Aber privatrechtliche Bestimmungen gerade über die für den Verkehr in unserem Sinn wichtigsten Gegenstände vermißt man fast völlig (sie erscheinen hie und da indirekt). Wirklich garantierte »Freiheitsrechte« des einzelnen fehlten im Grunde gänzlich. Der Rationalismus des Literatenbeamtentums in den miteinander konkurrierenden Teilstaaten hatte in einem Einzelfall (536 n. Chr. im Staate Tsheng) die Kodifikation des Rechts (auf Metalltafeln) in Angriff genommen. Aber bei der Diskussion dieser Frage innerhalb der Literatenschicht wurde nach der Annalistik232 mit Erfolg (durch einen Minister des Tsin-Staates) geltend gemacht: »Wenn das Volk lesen kann, wird es seine Oberen verachten.« Das Charisma der gebildeten Pa trimonialbureaukratie schien in Gefahr, an Prestige zu verlieren, und diese Machtinteressen ließen einen solchen Gedanken seitdem nie wieder aufkommen. Verwaltung und Rechtsfindung waren zwar formal durch den Dualismus der Fiskal- und Justizsekretäre, aber nicht wirklich in der Art ihrer Ausübung getrennt, wie auch – durchaus patrimonial – die Hausdiener des Beamten, die er auf seine Kosten engagierte, die Polizisten und Subalternbeamten für seine Verwaltung hergaben. Der antiformalistische patriarchale Grundzug verleugnete sich nirgends: anstößiger Lebenswandel wurde gestraft auch ohne Spezialbestimmung. Das Entscheidende war aber der innerliche Charakter der Rechtsfindung: Nicht formales Recht, sondern materiale Gerechtigkeit erstrebte der ethisch orientierte Patrimonialismus hier wie überall. Eine offizielle Präjudiziensammlung fehlte daher, trotz des Traditionalismus, weil der formalistische Charakter des Rechts abgelehnt wurde und, vor allem, kein Zentralgericht wie in England bestand. Die Präjudizien kannte der lokale »Hirte« des Beamten. Wenn dem Beamten empfohlen wurde: nach bewährten Mustern zu verfahren, so entsprach das äußerlich etwa der Gepflogenheit des Arbeitens nach »Similia« bei unseren Assessoren. Aber was hier Impotenz, war dort höchste Tugend. Die Edikte der Kaiser selbst über Verwaltungsmaßregeln hatten meist jene lehrhafte Form, welche päpstlichen Bullen des Mittelalters eignet, nur ohne deren dennoch meist vorhandenen präzisen rechtlichen Gehalt. Die bekanntesten von ihnen stellten Kodifikationen von ethischen, nicht von rechtlichen Normen dar und zeichneten sich durch literarische Gelehrsamkeit aus. Noch der vorletzte Kaiser gab z.B. die Wiederauffindung des Dekrets eines entfernten Vorfahren in der Peking Gazette kund, dessen Publikation als Lebensnorm er in Aussicht stellte. Die ganze kaiserliche Verwaltung stand – soweit sie orthodox orientiert war – unter dem Einfluß einer dem Wesen nach theokratischen, etwa einer Kongregation der päpstlichen Kurie entsprechenden Literatenbehörde: der sog. »Akademie« (Han-lin-yuan), der Hüterin der reinen (konfuzianischen) Orthodoxie, die uns mehrfach begegnet ist.
Die Justiz blieb demgemäß weitgehend »Kadi«-und eventuell »Kabinet«-Justiz233. Das war zwar, den unteren Klassen gegenüber, z.B. auch in der Friedensrichterjustiz Englands der Fall. Aber für die kapitalistisch wichtigen Vermögenstransaktionen bestand dort das unter dem stetigen, schon durch die Rekrutierung der Richter aus den Advokaten garantierten, Einfluß der Interessenten geschaffene, nicht rationale, aber berechenbare und der Vertragsautonomie weitgehenden Spielraum gebende Präjudizienrecht mit der ihm entsprechenden Kautelarjurisprudenz. In der patriarchalen chinesischen Justiz war dagegen für Advokaten im okzidentalen Sinn gar kein Platz. Als Anwälte fungierten für die Sippengenossen etwaige literarisch gebildete Mitglieder; sonst fertigte ein Winkelkonsulent die Schriftsätze. Es war eben die in allen spezifischen Patrimonialstaaten, am meisten in den theokratischen oder ethisch-ritualistischen Patrimonialstaaten orientalischen Gepräges, wiederkehrende Erscheinung: daß zwar neben der wichtigsten, aber nicht »kapitalistischen« Quelle der Vermögensakkumulation: der rein politischen Amts- und Steuerpfründe, auch »Kapitalismus«: der Kapitalismus der Staatslieferanten und Steuerpächter, also: politischer Kapitalismus, blühte und unter Umständen wahre Orgien feierte, daß ferner auch der rein ökonomische, d.h. vom »Markt« lebender Kapitalismus des Händlertums sich entwickeln konnte, – daß dagegen der rationale gewerbliche Kapitalismus, der das Spezifische der modernen Entwicklung ausmachte, unter diesem Regime nirgends entstanden ist. Denn die Anlage von Kapital in einem gewerblichen »Betrieb« ist viel zu empfindlich gegen die Irrationalitäten dieser Regierungsformen, und viel zu sehr auf die Möglichkeit angewiesen, das gleichmäßige rationale Funktionieren des staatlichen Apparats nach Art einer Maschine kalkulieren zu können, um unter einer Verwaltung chinesischer Art entstehen zu können. Aber warum blieb diese Verwaltung und Justiz so (kapitalistisch angesehen) irrational? – dies ist die entscheidende Frage. Einige im Spiel befindliche Interessen lernten wir kennen. Aber sie bedürfen der vertieften Erörterung.
Wie die von materialer Individualisierung und Willkür unabhängige Justiz, so fehlten für den Kapitalismus auch politische Vorbedingungen. Es fehlte zwar nicht die Fehde: – im Gegenteil ist die ganze Geschichte Chinas voll von großen oder kleinen Fehden bis zu den massenhaften Kämpfen der einzelnen Dorfverbände und Sippen. Aber es fehlte, seit der Befriedung im Weltreich, der rationale Krieg und, was noch wichtiger war, der diesen ständig vorbereitende bewaffnete Friede mehrerer miteinander konkurrierender selbständiger Staaten gegeneinander und die dadurch bedingten Arten von kapitalistischen Erscheinungen: Kriegsanleihen und Staatslieferungen für Kriegszwecke. Die partikulären Staatsgewalten des Okzidents mußten um das freizügige Kapital konkurrieren, in der Antike (vor dem Weltreich) sowohl wie im Mittelalter und der Neuzeit. Wie im römischen Weltreich, so fiel das auch im chinesischen Einheitsreich fort234. Ebenso fehlten diesem die Uebersee-und Kolonialbeziehungen. Das bedeutete ein Hemmnis für die Entfaltung auch aller derjenigen Arten von Kapitalismus, welcher im Okzident der Antike und dem Mittelalter mit der Neuzeit gemeinsam war: jener Abarten des Beutekapitalismus, wie sie der mittelländische, mit Seeraub verbundene Ueberseehandels-und der Kolonialkapitalismus darstellten. Dies beruhte zum Teil auf den geographischen Bedingungen eines großen Binnenreichs. Aber zum Teil waren, wie wir sahen, die Schranken der Ueberseeausdehnung auch umgekehrt Folge erscheinungen des allgemeinen politischen und ökonomischen Charakters der chinesischen Gesellschaft.
Der rationale Betriebskapitalismus, dessen spezifische Heimat im Okzident das Gewerbe wurde, war eben außer durch das Fehlen des formal garantierten Rechts und einer rationalen Verwaltung und Rechtspflege und durch die Folgen der Verpfründung auch durch das Fehlen gewisser gesinnungsmäßiger Grundlagen gehemmt worden. Vor allem durch diejenige Stellungnahme, welche im chinesischen »Ethos« ihre Stätte fand und von der Beamten- und Amtsanwärterschicht getragen wurde. Davon zu reden ist unser eigentliches Thema, zu dem wir nunmehr endlich gelangen.
V. Der Literatenstand.
In China bestimmte seit zwölf Jahrhunderten, weit mehr als der Besitz, die durch Bildung, insbesondere: durch Prüfung, festgestellte Amtsqualifikation den sozialen Rang. China war das Land, welches am exklusivsten, noch weit exklusiver als die Humanistenzeit Europas oder als zuletzt Deutschland, die literarische Bildung zum Maßstab sozialer Schätzung gemacht hatte. Schon im Zeitalter der Teilstaaten, reichte die literarisch – das hieß zunächst nur: durch Schrift kenntnis – vorgebildete Amtsanwärterschicht, als Träger der Fortschritte zur rationalen Verwaltung und aller »Intelligenz«, durch die sämtlichen Teilgebilde hindurch und bildete – wie das Brahmanentum in Indien – den entscheidenden Ausdruck der Einheitlichkeit der chinesischen Kultur. Solche Gebiete (auch: Enklaven) welche nicht nach dem Muster der orthodoxen Staatsidee von literarisch geschulten Beamten verwaltet wurden, galten der Staatstheorie als heterodox und barbarisch, ganz ebenso wie die nicht von Brahmanen reglementierten Stammesgebiete innerhalb des Gebietsbereichs des Hinduismus diesem, oder wie die nicht als Polis organisierten Landschaften dem Hellenen dafür galten. Diese zunehmende bureaukratische Struktur der politischen Gebilde und seiner Träger hat auch den Charakter der ganzen literarischen Ueberlieferung geprägt.
Die – mit Unterbrechungen und unter oft heftigen Kämpfen, aber doch stets erneut und stets zunehmend – herrschende Schicht in China sind und waren, endgültig seit reichlich zweitausend Jahren, die Literaten. Sie, und nur sie, redete, 1496 nach der Annalistik zum erstenmal, der Kaiser mit »meine Herren« an235. Es ist nun von unermeßlicher Wichtigkeit für die Art der Entwicklung der chinesischen Kultur gewesen, daß diese führende Intellektuellenschicht niemals den Charakter der Kleriker des Christentums oder Islam, auch nicht der jüdischen Rabbinen, auch nicht der indischen Brahmanen oder der altägyptischen Priester oder der ägyptischen oder indischen Schreiber gehabt hat. Sondern daß sie herausgewachsen ist zwar aus ritueller Schulung, doch aber aus einer vornehmen Laien bildung. Die »Literaten« des Feudalzeitalters, damals offiziell: puo tsche, »lebendige Bibliotheken«, genannt, waren zwar vor allem Kenner des Rituals. Aber im Gegensatz zu Indien waren sie weder aus Priesteradelsgeschlechtern (wie die Rischi-Sippen des Rigveda) noch aus einer Zauberergilde (wie, wahrscheinlich, die Brahmanen des Atharva-Veda) hervorgegangen, sondern, wenigstens dem Schwerpunkt nach, Abkömmlinge, meist wohl jüngere Söhne, feudaler Familien, welche sich literarische Bildung, vor allem: Schriftkunde, angeeignet hatten und deren soziale Stellung auf dieser Schrift-und Literaturkunde beruhte. Die Schriftkunde konnte sich – wenn auch bei dem chinesischen Schriftsystem nur schwer – auch ein Plebejer aneignen, und dann nahm er an dem Prestige des Schriftgelehrtentums teil: es ist schon in der Feudalzeit die Literatenschicht kein erblicher Stand und nicht exklusiv gewesen, im Gegensatz zu den Brahmanen. Im Gegensatz zur wedischen Bildung, welche bis tief in historische Zeiten auf der Ueberlieferung von Mund zu Mund beruhte und die schriftliche Fixierung der Tradition, wie alle zunftmäßige Kunst von Berufsmagiern dies zu tun pflegt, geradezu perhorreszierte, reicht die Schriftlichkeit der Ritualbücher, des Kalenders und der Annalistik in China in vorgeschichtliche Zeiten zurück236. Schon der ältesten Ueberlieferung galten die alten Schriften als magische Objekte237 und die Schriftkundigen als Träger magischen Charismas. Und, wie wir sehen werden, ist dies so geblieben. Aber nicht das Charisma magischer Zauberkraft, sondern die Schrift- und Literaturkenntnis als solche, daneben ursprünglich vielleicht astrologische Kenntnisse, machten ihr Prestige aus. Nicht ihnen oblag es, durch Zauber Privaten zu helfen, etwa: Kranke zu heilen, wie den Magiern. Sondern dafür gab es, wie später zu erwähnen, gesonderte Berufe. Die Bedeutung der Magie war zwar selbstverständliche Voraussetzung hier wie überall. Aber, soweit dabei Interessen der Gemeinschaft in Frage kamen, lag die Beeinflussung der Geister in den Händen der Vertreter der Gemeinschaft: für die politische Gemeinschaft des Kaisers als Oberpontifex und der Fürsten, für die Familie des Sippenhaupts und Hausvaters. Die Beeinflussung des Gemeinschaftsschicksals, vor allem: der Ernte, erfolgte eben seit sehr alter Zeit durch rationale Mittel: die Wasserregulierung, und daher war die richtige »Ordnung« der Verwaltung von jeher das grundlegende Mittel der Beeinflussung auch der Geisterwelt. Neben Schriftkunde als Mittel der Kenntnis der Tradition war Kalender- und Sternenkunde zur Ermittlung des himmlischen Willens, vor allem: der dies fasti und nefasti nötig, und es scheint, daß die Stellung der Literaten jedenfalls auch aus der Hofastrologenwürde heraus sich entwickelt hat238. Diese rituell (und ursprünglich wohl auch horoskopisch) wichtige Ordnung zu erkennen und darnach die berufenen politischen Gewalten zu beraten war das, was die Schriftkundigen und nur sie vermochten. Eine Anekdote der Annalen239 zeigt in plastischer Art die Konsequenzen. Im Feudalstaate der Wei konkurrieren ein bewährter General (U Ki, der angebliche Verfasser des bis heute maßgebenden Leitfadens der rituell richtigen Strategie) und ein Literat um die Stellung als erster Minister. Nachdem der letztere ernannt ist, entsteht zwischen beiden ein heftiger Disput. Der Literat gibt bereitwillig zu: daß er seinerseits weder Kriege zu führen noch ähnliche politische Aufgaben so wie der General zu bewältigen vermöge, bemerkt jedoch dem General, der daraufhin sich für den Qualifizierteren erklärt: es drohe der Dynastie eine Revolution, – worauf der General ohne weiteres zugibt, daß zu deren Verhütung nicht er, sondern der Literat der Geeignetere sei. Für die richtige innere Ordnung der Verwaltung und für die charismatisch richtige Lebensführung des Fürsten –, rituell und politisch, – war eben der schriftkundige Kenner der alten Tradition der allein Kompetente. Im schärfsten Gegensatz zu den wesentlich außenpolitisch interessierten jüdischen Propheten waren also die chinesischen rituell geschulten Literaten-Politiker primär an den Problemen der inneren Verwaltung orientiert, mochten diese auch – wie wir früher sahen – vom Standpunkt ihrer Fürsten aus durchaus im Dienst der Machtpolitik stehen und mochten sie selbst auch, als fürstliche Korrespondenzführer und Kanzler, tief in die Leitung der Diplomatie hineingezogen werden.
Diese stete Orientierung an den Problemen der »richtigen« Staatsverwaltung bedingte einen weitgehenden praktisch-politischen Rationalismus der Intellektuellenschicht des Feudalzeitalters. Im Gegensatz gegen den strengen Traditionalismus der späteren Zeit zeigen uns die Annalen die Literaten gelegentlich als kühne politische Neuerer240. Grenzenlos war ihr Bildungsstolz241 und weitgehend – wenigstens nach der Aufmachung der Annalistik – die Deferenz der Fürsten242. Entscheidend für die Eigenart der Literatenschicht war nun ihre intime Beziehung zum Dienst bei patrimonialen Fürsten. Von Anbeginn unserer Kunde an bestand diese. Der Ursprung des Literatentums ist für uns in Dunkel gehüllt. Anscheinend waren sie die chinesischen Auguren und es ist für ihre Stellung der pontifikale, cäsaropapistische Charakter der kaiserlichen Gewalt und der daraus folgende Charakter der Literatur: offizielle Annalen, magisch bewährte Kriegs- und Opfergesänge, Kalender, Ritual- und Zeremonialbücher, das entscheidende Moment gewesen. Sie stützten mit ihrer Wissenschaft jenen kirchlichen Anstaltscharakter des Staats und gingen von ihm als der gegebenen Voraussetzung aus. Sie schufen in ihrer Literatur den »Amts«-Begriff, vor allem das Ethos der »Amtspflicht« und des »öffentlichen Wohls«243. Sie sind, wenn der Annalistik einigermaßen getraut werden darf, von Anfang an Gegner des Feudalismus und Anhänger der amtsmäßigen Anstaltsorganisation des Staats gewesen. Ganz begreiflich: weil von ihrem Interessenstandpunkt aus nur der (durch literarische Bildung) persönlich Qualifizierte verwalten sollte244. Andererseits nahmen sie für sich in Anspruch, den Fürsten den Weg der militärischen Eigenregie: – eigene Waffenfabrikation und Festungsbau – gewiesen zu haben, als Mittel: »Herr ihrer Länder« zu werden245.
Diese im Kampf des Fürsten mit den feudalen Gewalten entstandene feste Beziehung zum Fürstendienst scheidet die chinesische Literatenschicht sowohl von der althellenischen wie von der altindischen (Kschatriya-)Laienbildung und nähert sie den Brahmanen an, von denen sie sich jedoch durch ihre rituelle Unterordnung unter den cäsaropapistischen Pontifex einerseits, durch das damit und mit der Schriftbildung eng zusammenhängende Fehlen der Kastengliederung andererseits stark unterscheiden. Die Art der Beziehung zum eigentlichen Amt freilich hat gewechselt. In der Zeit der Feudalstaaten konkurrierten die verschiedenen Höfe um die Dienste der Literaten und sie suchten die Gelegenheit, Macht und – nicht zu vergessen – Erwerb246 zu finden, da, wo sie am günstigsten war. Es bildete sich eine ganze Schicht vagierender »Sophisten« (tsche-sche), den fahrenden Rittern und Gelehrten des Mittelalters im Okzident vergleichbar. Und es fanden sich auch – wie wir sehen werden – prinzipiell amts frei bleibende Literaten. Dieser freibewegliche Literatenstand war damals der Träger philosophischer Schulbildungen und Gegensätze, wie in Indien, im hellenischen Altertum und bei den Mönchen und Gelehrten des Mittelalters. Dennoch fühlte sich der Literaten stand als solcher als Einheit, sowohl in seiner Standesehre247 wie als einziger Träger der einheitlichen chinesischen Kultur. Und für den Stand als Ganzes blieb eben die Beziehung zum Fürstendienst als der normalen oder mindestens normalerweise erstrebten Erwerbsquelle und Betätigungsgelegenheit das ihn von den Philosophen der Antike und wenigstens der Laienbildung Indiens (deren Schwerpunkte außerhalb des Amtes lagen) Unterscheidende. Konfuzius wie Laotse waren Beamte, ehe sie amtlos als Lehrer und Schriftsteller lebten, und wir werden sehen, daß diese Beziehung zum staatlichen (»kirchenstaatlichen«) Amt für die Art der Geistigkeit dieser Schicht grundlegend wichtig blieb. Vor allem: daß diese Orientierung immer wichtiger und ausschließlicher wurde. Im Einheitsstaat hörten die Chancen der Konkurrenz der Fürsten um die Literaten auf. Jetzt konkurrierten umgekehrt diese und ihre Schüler um die vorhandenen Aemter und es konnte nicht ausbleiben, daß dies die Entwicklung einer einheitlichen, dieser Situation angepaßten, orthodoxen Doktrin zur Folge hatte. Sie wurde: der Konfuzianismus. Und mit der wachsenden Verpfründung des chinesischen Staatswesens hörte daher die anfänglich so freie Bewegung des Geistes der Literatenschicht auf. Diese Entwicklung war in jener Zeit schon in vollem Gange, als die Annalistik und die meisten systematischen Schriften der Literaten entstanden und als die von Schi Hoang Ti ausgerotteten heiligen Bücher »wiedergefunden«248 wurden und nun, revidiert, retouchiert und kommentiert von den Literaten, kanonische Geltung erlangten.
Daß diese Gesamtentwicklung mit der Befriedung des Reichs eingetreten oder vielmehr: in ihre Konsequenzen getrieben ist, ergibt die Annalistik klar. Ueberall ist Krieg die Angelegenheit der Jugend gewesen und der Satz: »sexagenarios de ponte« war eine gegen den »Senat« gerichtete Krieger parole. Die Literaten aber waren die »Alten« oder: vertraten sie. Daß er gesündigt habe, indem er auf die »Jungen« (die Krieger) gehört habe, nicht auf die »Alten«, die zwar keine Kraft, aber Erfahrung haben, wird als paradigmatisches öffentliches Bekenntnis des Fürsten Mu Kong (von Tsin) in der Annalistik überliefert249. In der Tat: das war der entscheidende Punkt bei der Wendung zum Pazifismus und – dadurch – Traditionalismus: an die Stelle des Charisma trat: die Tradition.
Die klassischen, mit dem Namen des im Jahre 478 v. Chr. verstorbenen Kungtse: Konfuzius, als Redaktor verknüpften Schriften lassen in ihren ältesten Teilen noch die Zustände der charismatischen Kriegskönige erkennen. Die Heldenlieder des Hymnenbuches (Schi-king) singen wie die hellenischen und indischen Epen von wagenkämpfenden Königen. Aber in ihrem Gesamtcharakter sind sie schon nicht mehr, wie die homerischen und germanischen Epen, Verkünder individuellen oder überhaupt rein menschlichen Heldentums. Das Heer der Könige hatte schon zur Zeit der jetzigen Redaktion des Schi-king nichts mehr von Gefolgschafts- oder homerischer Aventiuren-Romantik, sondern besaß schon den Charakter einer bureaukratisierten Armee mit Disziplin und, vor allem, mit »Offizieren«. Und – was für den Geist entscheidend ist – die Könige siegen schon im Schi-king nicht, weil sie die größeren Helden sind, sondern weil sie vor dem Himmelsgeist sich moralisch im Recht befinden und ihre charismatischen Tugenden die überlegenen, die Feinde aber gottlose Verbrecher sind, welche sich am Wohle ihrer Untertanen durch Bedrückung und Verletzung der alten Sitten versündigt haben und so ihr Charisma verwirkten. Zu moralisierenden Betrachtungen hierüber weit mehr als zu heldenhafter Siegesfreude gibt der Sieg Veranlassung. Im Gegensatz zu den heiligen Schriften fast aller anderen Ethiken fällt ferner sofort das Fehlen jeder irgendwie »anstößigen« Aeußerung, jedes auch nur denkbarerweise »unschicklichen« Bildes auf. Hier hat offensichtlich eine ganz systematische Purifikation stattgefunden und diese dürfte wohl die spezifische Leistung des Konfuzius sein. Die pragmatische Umprägung der alten Ueberlieferung in der Annalistik, wie sie die amtliche Historiographie und die Literaten produzierten, ging über die im Alten Testament, etwa im »Buch der Richter«, vorgenommene priesterliche Paradigmatik offenbar hinaus. Die Chronik, deren Verfasserschaft besonders ausdrücklich dem Konfuzius selbst zugeschrieben wird, enthält die denkbar dürrste und sachlichste Aufzählung von Kriegszügen und Rebellenbestrafungen, in dieser Hinsicht vergleichbar etwa den assyrischen Keilschriftprotokollen. Wenn Konfuzius wirklich die Meinung ausgesprochen haben sollte: man werde sein Wesen aus diesem Werke besonders deutlich erkennen – wie die Ueberlieferung sagt –, dann müßte man wohl der Ansicht derjenigen (chinesischen und europäischen) Gelehrten zustimmen, wel che dies dahin verstehen: eben diese systematische pragmatische Korrektur der Tatsachen unter dem Gesichtspunkt der »Schicklichkeit«, welche sie dargestellt haben muß (für die Zeitgenossen – denn für uns ist der pragmatische Sinn meist undurchsichtig geworden250 –), sei das Charakteristische gewesen. Fürsten und Minister der Klassiker handeln und reden als Paradigmata von Regenten, deren ethisches Verhalten der Himmel belohnt. Das Beamtentum und sein Avancement nach Verdienst ist Gegenstand der Verklärung. Es herrscht zwar noch Erblichkeit der Fürstentümer und zum Teil auch der lokalen Aemter als Lehen, aber mindestens für die letzteren wurde dies System von den Klassikern skeptisch betrachtet und galt letztlich als nur provisorisch. Und zwar in der Theorie auch einschließlich der Erblichkeit der Kaiserwürde selbst. Die idealen legendären Kaiser (Yau und Schun) designieren ihre Nachfolger (Schun und Yü) ohne Rücksicht auf Abkunft aus dem Kreise ihrer Minister und über den Kopf ihrer eigenen Söhne lediglich nach ihrem, von den höchsten Hofbeamten bescheinigten, persönlichen Charisma, und ebenso alle ihre Minister, und erst der dritte von ihnen, Yü, designiert nicht seinen ersten Minister (Y), sondern seinen Sohn (Ki).
Eigentliche Heldengesinnung sucht man in den meisten klassischen Schriften (ganz im Gegensatz zu den alten echten Dokumenten und Monumenten) vergebens. Die überlieferte Ansicht des Konfuzius geht dahin: daß Vorsicht der bessere Teil der Tapferkeit sei und ein unangebrachtes Einsetzen seines eigenen Lebens dem Weisen nicht zieme. Die tiefe Befriedung des Landes zumal seit der Mongolenherrschaft hat diese Stimmung sehr gesteigert. Das Reich wurde nunmehr ein Reich des Friedens. »Gerechte« Kriege gab es in seinen Grenzen, da es ja als Einheit galt, nach Mencius überhaupt nicht. Die Armee war im Verhältnis zu seinem Umfang schließlich geradezu winzig geworden. Daß die Kaiser nach Loslösung der Literatenschulung vom Zusammenhang mit der ritterlichen Bildung neben den literarischen Staatsprüfungen auch sportliche und literarische Wettkämpfe um Militärdiplome251 beibehielten – deren Erlangung übrigens seit langem mit der wirklichen Militärkarriere in fast keinem Zusammenhang mehr stand252 –, hatte daran nichts geändert, daß der Militärstand ebenso verachtet blieb wie in England seit zwei Jahrhunderten, und daß ein literarisch Gebildeter mit Offizieren nicht auf gleichem Fuß verkehrte253.
Der Mandarinenstand, aus deren Mitte sich alle Klassen der chinesischen Zivilbeamten rekrutierten, war in der Zeit der Einheitsmonarchie eine Schicht diplomierter Pfründenanwärter geworden, deren Amtsqualifikation und Rang nach der Zahl der bestandenen Prüfungen sich richtete. Diese Prüfungen gliederten sich in drei Hauptstufen254, welche jedoch zufolge der Zwischen-, Wiederholungs- und Vorprüfungen, sowie der zahlreichen Sonderbedingungen um ein vielfaches vermehrt wurden: es gab allein zehn Arten von Prüflingen ersten Grades. »Wieviel Examina er bestanden habe?«, war die Frage, welche an einen Fremden, dessen Rang unbekannt war, gestellt zu werden pflegte. Nicht: wieviele Ahnen man hatte, bestimmte also – trotz des Ahnenkults – den sozialen Rang. Vielmehr genau umgekehrt: vom eigenen amtlichen Rang hing es ab, ob man einen Ahnentempel (oder, wie die Illiteraten, nur eine Ahnentafel) haben und wieviel Ahnen darin erwähnt werden durften255. Selbst der Rang eines Stadtgottes im Pantheon hing von dem Rang des Mandarinen der Stadt ab.