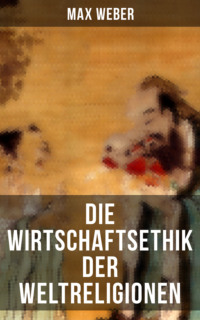Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 12
Der konfuzianischen Zeit (6./5. Jahrh. n. Chr.) war diese Möglichkeit des Aufstiegs zu Beamtenstellen und vollends das Prüfungswesen noch unbekannt. Die »großen Familien« waren, wie es scheint, in den Feudalstaaten zum mindesten in aller Regel im Besitz der Macht. Erst die Han-Dynastie, – selbst durch einen Parvenü begründet, – stellte den Grundsatz der Verleihung der Aemter nach der Tüchtigkeit auf. Und erst die Tang-Dynastie schuf (690 n. Chr.) das Reglement für die Prüfung höchsten Grades. Es darf – wie schon gesagt – als höchstwahrscheinlich gelten, daß die literarische Bildung, vielleicht von Einzelausnahmen abgesehen, zunächst faktisch und vielleicht auch rechtlich ebenso Monopol der »großen Familien« blieb, wie die vedische Bildung in Indien. Reste davon bestanden bis zuletzt. Die Kaisersippe war zwar nicht von allen Prüfungen, wohl aber von der Prüfung ersten Grades entbunden. Und die Bürgen, welche jeder Prüfungskandidat zu stellen hatte, mußten bis zuletzt auch seine Abstammung aus »guter Familie« bezeugen (was in der Neuzeit nur den Ausschluß der Abkömmlinge von Barbieren, Bütteln, Musikern, Hausdienern, Trägern usw. bedeutete). Aber daneben bestand das Institut der »Mandarinats-kandidaten«: Abkömmlinge von Mandarinen genossen bei der Kontingentierung der Maximalzahl der Prüflinge der Provinzen eine Sonder- und Vorzugsstellung. Die Promotionslisten brauchten die offizielle Formel »aus einer Mandarinenfamilie und aus dem Volk«. Die Söhne verdienter Beamter hatten den untersten Grad als Ehrentitel: alles Reste älterer Zustände.
Wirklich voll durchgeführt seit Ende des 7. Jahrhunderts, war das Prüfungswesen eines der Mittel, durch welche der Patrimonialherrscher die Bildung eines ihm gegenüber geschlossenen Standes, der das Recht auf die Amtspfründen nach Art der Lehensleute und Ministerialen monopolisiert hätte, zu hindern wußte. Seine ersten Spuren scheinen sich in dem später alleinherrschend gewordenen Teilstaat Tsin etwa in der Zeit des Konfuzius (und Huang Kong) zu finden: wesentlich nach militärischer Tüchtigkeit bestimmte sich die Auslese. Indessen schon das Li Ki und Tschou Li256 verlangen ganz rationalistisch: daß die Bezirkschefs ihre Unterbeamten periodisch auf ihre Moral hin prüfen, um sie danach dem Kaiser zum Avancement vorzuschlagen. Im Einheitsstaat der Han begann der Pazifismus die Richtung der Auslese zu bestimmen. Die Macht des Literatenstandes konsolidierte sich ganz gewaltig, seit es ihm (21 n. Chr.) gelungen war, gegen den populären »Usurpator« Wang mang den korrekten Kuang wu auf den Thron zu erheben und zu erhalten. In den später zu besprechenden wütenden Pfründenkämpfen der Folgezeit schloß er sich ständisch zusammen.
Nachdem die noch heut vom Glanz: der eigentliche Schöpfer von Chinas Größe und Kultur gewesen zu sein, umstrahlte Tang-Dynastie die Stellung der Literaten erstmalig reglementiert und Kollegien für die Ausbildung eingerichtet (7. Jahrhundert), auch das Han lin yüan, die sog. »Akademie«, zunächst zur Redaktion der Annalen für die Gewinnung von Präzedenzien, und an deren Hand: Kontrolle der Korrektheit des Kaisers, geschaffen hatte, wurden nach den Mongolenstürmen durch die nationale Ming-Dynastie im 14. Jahrhundert die, im wesentlichen, abschließenden Statuten erlassen257. In jedem Dorf sollte auf je 25 Familien eine Schule gegründet werden. Da sie nicht subventioniert wurde, blieb dies toter Buchstabe, – oder vielmehr: wir sahen früher, welche Gewalten sich der Schule bemächtigten. Beamte wählten die besten Schüler aus und nahmen sie in bestimmter Zahl in die – in der Hauptsache verfallenen, zum Teil neu entstandenen – Kollegien auf. 1382 wurden für diese »Studenten« Reisrente-Pfründen ausgeworfen, 1393 ihre Zahl bestimmt. Seit 1370 sollten nur Examinierte Amtsanwartschaft haben. Sofort setzte der Kampf der Regionen, besonders von Nord und Süd, ein. Der Süden lieferte schon damals gebildetere, weil aus der umfassenderen Umwelt stammende, Examensanwärter; aber der Norden war militärisch der Grundstein des Reichs. Der Kaiser griff also ein und bestrafte (!) Examinatoren, die einen Südländer als »Primus« placiert hatten. Es entstanden gesonderte Listen für Nord und Süd. Aber es entstand ferner auch sofort: der Kampf um die Amts patronage. Schon 1387 wurden besondere Examina für Offiziers-Söhne bewilligt. Die Offiziere und Beamten gingen aber weiter und verlangten die Befugnis der Nachfolgerdesignation (also: die Re-Feudalisierung). 1393 wurde dies konzediert, aber schließlich doch nur in der Form: daß die Präsentaten den Vorzug bei Aufnahme in die Kollegien haben und Pfründen für sie reserviert werden sollten: 1465 für drei Söhne, 1482 für einen Sohn. Einkauf in die Kollegien (1453) und Aemter (1454) trat im 15. Jahrhundert bei militärischem Geldbedarf, wie stets, auf, wurde 1492 abgeschafft, 1529 wieder eingeführt. Ebenso kämpften die Ressorts. Das Ressort der Riten examinierte (seit 736), das Ressort der Aemter aber stellte an. Boykott der Examinierten durch letzteres und Examensstreiks durch ersteres als Antwort waren nicht ganz selten. Formal war der Ritenminister, material der Aemterminister (Hausmeier) zuletzt der mächtigste Mann in China. Es kamen nun Kaufleute in die Aemter, von denen man sich – sehr zu Unrecht natürlich – erhoffte, daß sie minder »geizig« sein würden258. Die Mandschus begünstigten die alten Traditionen, damit die Literaten und – soweit möglich – die »Reinheit« der Aemterbesetzung. Aber nach wie vor bestanden nebeneinander die drei Wege: 1. kaiserliche Gnade für die Söhne der »Fürsten«-Familien (Examensprivilegien), – 2. leichte Prüfung (alle 3-6 Jahre offiziell) für die Unter beamten durch die höheren mit Patronage dieser, wobei dann das Aufrücken auch in die höheren Stellen unvermeidlich stets neu eintrat, – 3. effektive reine Examensqualifikation: der einzige legale Weg.
Seine vom Kaiser ihm zugedachten Funktionen hat das Prüfungswesen in der Hauptsache wirklich erfüllt. Die gelegentlich (1372) dem Kaiser – man kann denken: von woher – als Konsequenz des orthodoxen Tugendcharismas suggerierte Konsequenz: daß man das Examen abschaffen müsse, da nur die Tugend legitimiere und qualifiziere, wurde schnell wieder verlassen. Ganz begreiflich: beide Teile – Kaiser und Graduierte – fanden schließlich doch ihren Vorteil dabei oder glaubten dies doch. Vom Standpunkt des Kaisers aus entsprach das Examen durchaus der Rolle, welche das Mjestnitschestwo des russischen Despotismus – ein im übrigen technisch heterogenes Mittel – für Rußlands Adel gespielt hat. Es hat tatsächlich durch den Konkurrenzkampf der Pfründensuchenden um die Aemter, welcher jeden Zusammenschluß zu einem Amtsadel feudalen Charakters ausschloß, und durch die Offenhaltung des Zutritts zum Pfründenanwärterstand für jedermann, der die Bildungsqualifikation nachwies, seinen Zweck durchaus erfüllt.
Uns interessiert jetzt die Stellung dieses Bildungswesens innerhalb der großen Typen der Erziehung. Eine soziologische Typologie der pädagogischen Zwecke und Mittel kann freilich hier nicht im Vorbeigehen gegeben werden. Einige Bemerkungen darüber sind aber vielleicht am Platze.
Die beiden äußersten historischen Gegenpole auf dem Gebiete der Erziehungs zwecke sind: Erweckung von Charisma (Heldenqualitäten oder magischen Gaben) einerseits, – Vermittlung von spezialistischer Fachschulung andererseits. Der erste Typus entspricht der charismatischen, der letzte der rational bureaukratischen (modernen) Struktur der Herrschaft. Beide stehen nicht beziehungs- und übergangslos einander gegenüber. Auch der Kriegsheld oder Magier bedurfte der Fachschulung. Auch dem Fachbeamten pflegt nicht nur Wissen angeschult zu werden. Aber sie sind Gegenpole. Zwischen diesen radikalsten Gegensätzen stehen alle jene Erziehungstypen mitten inne, welche eine bestimmte Art einer, sei es weltlichen oder geistlichen, in jedem Falle aber: einer ständischen, Lebensführung dem Zögling ankultivieren wollen.
Die charismatische Zucht der alten magischen Askese und die Heldenproben, welche Zauberer und Kriegshelden mit dem Knaben vornahmen, wollten dem Novizen zu einer im animistischen Sinne »neuen Seele«: zu einer Wiedergeburt also, verhelfen; in unserer Sprache ausgedrückt: eine Fähigkeit, die als rein persönliche Gnadengabe galt, nur wecken und erproben. Denn ein Charisma kann man nicht lehren oder anerziehen. Es ist im Keim da oder wird durch ein magisches Wiedergeburtswunder eingeflößt, – sonst ist es unerreichbar. Die Facherziehung will die Zöglinge zu praktischer Brauchbarkeit für Verwaltungszwecke: – im Betrieb einer Behörde, eines Kontors, einer Werkstatt, eines wissenschaftlichen oder industriellen Laboratoriums, eines disziplinierten Heeres, – abrichten. Das kann man, sei es auch in verschiedenem Grade, prinzipiell mit einem jeden vornehmen. Die Kultivationspädagogik schließlich will einen, je nach dem Kulturideal der maßgebenden Schicht verschieden gearteten, »Kulturmenschen«, das heißt hier: einen Menschen von bestimmter innerer und äußerer Lebensführung, erziehen. Auch das kann, prinzipiell, mit jedem geschehen. Nur das Ziel ist verschieden. Ist eine ständisch abgesonderte Kriegerschicht der ausschlaggebende Stand, – wie in Japan –, so wird die Erziehung einen die Federfuchserei, wie der japanische Samurai es tat, verachtenden höfisch stilisierten Ritter, im Einzelfalle sehr verschiedenen Gepräges, – ist es eine Priesterschicht, so wird sie einen Schriftgelehrten oder doch einen Intellektuellen, ebenfalls sehr verschiedenen Gepräges, aus dem Zögling zu machen trachten. Die zahlreichen Kombinationen und Zwischenglieder – denn in Wahrheit kommt keiner dieser Typen jemals rein vor – können bei dieser Gelegenheit nicht erörtert werden. Hier kommt es auf die Stellung der chinesischen Erziehung innerhalb dieser Formen an. Die Reste der urwüchsig charismatischen Wiedergeburts-Erziehung; der Milchname, die (früher kurz erörterte) Jünglingsweihe, der Namenswechsel des Bräutigams usw. waren längst zur Formel (nach Art unserer Konfirmation) geworden neben der von der politischen Gewalt monopolisierten Prüfung der Bildungsqualifikation. Diese aber war, wenn man auf die Bildungsmittel sieht, eine »Kultur«-Qualifikation im Sinne einer allgemeinen Bildung, von einer ähnlichen, aber noch spezifischeren Art, als etwa die überkommene okzidentale humanistische Bildungsqualifikation, welche bei uns, bis vor kurzem fast ausschließlich, den Eintritt in die Laufbahn zu den mit Befehlsgewalt in der bürgerlichen und militärischen Verwaltung ausgerüsteten Aemtern vermittelte und die dazu heranzuschulenden Zöglinge zugleich auch als sozial zum Stande der »Gebildeten« gehörig abstempelte. Nur ist bei uns – darin liegt der sehr wichtige Unterschied des Okzidents gegen China – neben und zum Teil an Stelle dieser ständischen Bildungsqualifikation die rationale Fach abrichtung getreten.
Die chinesischen Prüfungen stellten nicht, wie die modernen, rational bureaukratischen Prüfungsordnungen unserer Juristen, Mediziner, Techniker usw., eine Fachqualifikation fest. Andererseits aber auch nicht den Besitz eines Charisma, wie die typischen Erprobungen der Magier und Männerbünde. Wir werden freilich bald sehen, welcher Einschränkungen dieser Satz bedarf. Immerhin galt er wenigstens für die Technik der Prüfungen. Diese ermittelten den Besitz literarischer Durchkultivierung und der daraus folgenden, dem vornehmen Manne angemessenen Denkweise. Dies war in weit spezifischerem Grade als bei unseren humanistischen Gymnasien der Fall, deren Zweck man heute meist praktisch: durch die formale Schulung an der Antike, rechtfertigt. Soweit die bei den Prüfungen den Schülern gestellten Aufgaben schließen lassen, hatten diese auf den Unterstufen259 etwa den Charakter von Aufsatzthemen in einer Prima eines deutschen Gymnasiums oder, vielleicht noch richtiger, der Selekta einer höheren deutschen Töchterschule. Alle Stufen sollten Proben der Schreibkunst, der Stilistik, der Beherrschung der klassischen Schriften260, endlich aber – ähnlich etwa wie bei uns im Religions-, Geschichts- und deutschen Unterricht – Proben einer einigermaßen vorschriftsmäßigen Gesinnung261 sein. Der einerseits rein weltliche, andererseits aber an die feste Norm der orthodox interpretierten Klassiker gebundene und höchst exklusiv literarische, buchmäßige, Charakter dieser Bildung war dabei das für unsere Zusammenhänge Entscheidende.
In Indien, im Judentum, Christentum und Islam war der literarische Charakter der Bildung Folge davon, daß sie ganz in die Hände der literarisch gebildeten Brahmanen und Rabbinen oder der berufsmäßig literarisch geschulten Geistlichen und Mönche von Buchreligionen geraten war. Der hellenische vornehme Gebildete dagegen war und blieb in erster Linie Ephebe und Hoplit, solange die Bildung hellenisch – und nicht »hellenistisch« – war. Mit jener Wirkung, die in nichts deutlicher als etwa in der Konversation des Symposion hervortritt: daß sein Sokrates im Felde nie, nach unserer studentischen Terminologie, »gekniffen« hat, ist Platon ersichtlich reichlich so wichtig wie alles andere, was er den Alkibiades sagen läßt. Im Mittelalter gab die ritterlich-militärische und dann die renaissancemäßig-vornehme Salonbildung ein ganz entsprechendes, nur sozial anders geartetes, Gegengewicht gegen die buchmäßige, priesterlich und mönchisch vermittelte Bildung, während im Judentum und in China ein solches Gegengewicht teils ganz, teils so gut wie ganz fehlte. Hymnen, epische Erzählungen, rituelle und Zeremonialkasuistik waren in Indien wie in China der sachliche Gehalt der literarischen Bildungsmittel. In Indien aber unterbaut durch die kosmogonischen und religionsphilosophischen Spekulationen, derengleichen bei den Klassikern und rezipierten Kommentaren in China zwar nicht gänzlich fehlte, letztlich aber doch offenbar seit jeher nur eine sehr nebensächliche Rolle spielte. Statt dessen hatten die chinesischen Autoren rationale sozialethische Systeme entwickelt. Die chinesische Bildungsschicht war eben nie ein autonomer Gelehrten stand, wie die Brahmanen, sondern eine Schicht von Beamten und Amtsanwärtern.
Die chinesische höhere Bildung hatte nicht immer ihren heutigen Charakter gehabt. Die öffentlichen Lehranstalten (Pan kung) der Feudalfürsten vermittelten, neben Kenntnis der Riten und der Literatur: Tanz- und Waffenkunst. Erst die Befriedung des Reichs im patrimonialen Einheitsstaat und endgültig das reine Amtsprüfungswesen wandelten jene der althellenischen wesentlich näher stehende Erziehung in die bis in dies Jahrhundert bestehende um.
Die mittelalterliche Erziehung, wie sie auch das maßgebliche orthodoxe Siao-Hio: »Jugendlehre«, wiedergibt, legte noch erhebliches Gewicht auf Tanz und Musik. Zwar der alte Kriegstanz scheint nur noch in Rudimenten vorhanden, aber im übrigen lernten die Kinder je nach der Altersstufe bestimmte Tänze. Als Zweck wird Bändigung der bösen Leidenschaften hingestellt: wenn ein Kind bei der Erziehung nicht gut tut, soll man es tanzen und singen lassen. Musik bessert den Menschen, Riten und Musik sind die Grundlage der Selbstbeherrschung262. Die magische Bedeutung der Musik war dabei das Primäre: »Richtige Musik – d.h. die nach den alten Regeln und streng im alten Maß verwendete Musik – hält die Geister im Zaum«263. – Bogenschießen und Wagenlenken galt noch im Mittelalter als allgemeiner Erziehungsgegen stand vornehmer Kinder264. Aber wesentlich war das nur noch Theorie. Die Durchmusterung der Jugendlehre zeigt, daß die häusliche Erziehung – seit dem 7. Lebensjahre streng nach Geschlechtern getrennt – im wesentlichen in der Einprägung eines über alle okzidentalen Begriffe gehenden Zeremoniells, speziell der Pietät und Ehrfurcht gegen die Eltern und alle Vorgesetzten und älteren Personen überhaupt bestand und im übrigen fast nur Regeln der Selbstbeherrschung darbot.
Neben diese häusliche trat nun die Schulerziehung, für welche in jedem Hsien eine Volksschule vorhanden sein sollte. Die höhere Bildung setzte das Bestehen der ersten Zulassungsprüfung voraus.
Vor allem blieb also dieser chinesischen (höheren) Bildung zweierlei eigentümlich. Zunächst: daß sie ebenso, wie anderwärts alle priesterlich geschaffene Bildung, ganz unmilitärisch und rein literarisch war. Dann aber, daß der in wörtlichem Sinne literarische: schrift mäßige Charakter hier ins Extrem gesteigert wurde. Dies scheint zum Teil eine Folge der Eigentümlichkeit der chinesischen Schrift und der aus ihr erwachsenen literarischen Kunst265. Da die Schrift in ihrem bildhaften Charakter verharrte und nicht zu einer Buchstabenschrift, wie sie die Handelsvölker des Mittelmeeres geschaffen haben, rationalisiert wurde, so wendete sich das literarische Produkt an Auge und Ohr zugleich und an das erstere wesentlich mehr als an das letztere. Jedes »Vorlesen« der klassischen Schriften war schon eine Uebersetzung aus dem Schriftbild in das (nicht geschriebene) Wort, denn der anschauliche Charakter zumal der alten Schrift stand dem Gesprochenen dem inneren Wesen nach fern. Die monosyllabische Sprache, welche nicht nur das Laut-, sondern auch das Tongehör in Anspruch nimmt, steht, in ihrer nüchternen Knappheit und ihrem Zwang syntaktischer Logik, im äußersten Gegensatz zu jenem rein anschaulichen Charakter der Schrift. Aber trotz oder vielmehr – wie Grube geistvoll darlegt – zum Teil wegen ihrer, der Struktur nach, stark rationalen Qualitäten hat sie weder der Dichtung noch dem systematischen Denken noch der Entfaltung der rednerischen Kunst die Dienste leisten können, welche der hellenische, lateinische, französische, deutsche und russische Sprachbau, jeder in anderer Art, dargeboten hat. Der Schriftzeichenschatz blieb weit reicher als der unvermeidlich festbegrenzte Wortsilbenschatz, und aus der dürftigen formelhaften Verstandesmäßigkeit dieses flüchteten sich daher alle Phantasie und aller Schwung in die stille Schönheit jenes zurück. Die übliche Dichtungs sprache galt der Schrift gegenüber als im Grunde subaltern, nicht das Sprechen, sondern das Schreiben und das die Kunstprodukte des Schreibens rezipierende Lesen als das eigentlich künstlerisch Gewertete und des Gentleman Würdige. Das Reden blieb eigentlich eine Sache des Pöbels. Im schärfsten Gegensatz gegen das Hellenentum, dem die Konversation alles, die Uebertragung in den Stil des Dialoges die adäquate Formung jedes Erlebten und Erschauten war, verharrten gerade die feinsten, weit über der charakteristischerweise gerade in der Mongolenzeit blühenden Dramatik gewerteten, Blüten der literarischen Kultur gewissermaßen taubstumm in ihrer seidenen Pracht. Von den namhaften Sozialphilosophen hat Meng Tse (Mencius) sich der Dialogform systematisch bedient. Eben deshalb erscheint er uns leicht als der einzige zu voller »Klarheit« gediehene Repräsentant des Konfuzianismus. Die sehr starke Wirkung der (von Legge) sog. »konfuzianischen Analekten« auf uns beruht ebenfalls darauf, daß die Lehre hier (wie übrigens gelegentlich auch sonst) in die Form von (teilweise wohl authentischen) sentenziösen Antworten des Meisters auf Fragen der Schüler gekleidet, also, für uns, in die Sprach form transponiert ist. Im übrigen enthält die epische Literatur die oft in ihrer lapidaren Wucht höchst eindrucksvollen Anreden der alten Kriegskönige an das Heer und besteht ein Teil der didaktischen Annalistik aus Reden, deren Charakter jedoch eher pontifikalen »Allokutionen« entspricht. Sonst spielt die Rede in der offiziellen Literatur keine Rolle. Ihre Unentwickeltheit wurde, wie wir gleich sehen werden, durch soziale und politische Gründe mitbedingt. Einerseits blieb so trotz der logischen Qualitäten der Sprache das Denken weit stärker im Anschaulichen stecken und erschloß sich die Gewalt des Logos, des Definierens und Räsonierens, dem Chinesen nicht. Andererseits löste diese reine Schriftbildung den Gedanken noch stärker von der Geste, der Ausdrucksbewegung, als dies der literarische Charakter einer Bildung ohnedies zu tun pflegt. Zwei Jahre lang lernte der Schüler etwa 2000 Schriftzeichen lediglich malen, ehe er in ihren Sinn eingeführt wurde. Weiterhin bildete der Stil, die Verskunst und die Bibelfestigkeit in den Klassikern, endlich die zum Ausdruck gebrachte Gesinnung des Prüflings, den Gegenstand der Aufmerksamkeit.
Sehr auffällig tritt in der chinesischen Bildung, selbst der Volksschulbildung, das Fehlen einer Schulung im Rechnen hervor. Und zwar obwohl im 6. Jahrhundert v. Chr., also in der Periode der Teilstaaten, der Positions gedanke entwickelt war266, die »Rechenhaftigkeit« im Verkehr alle Schichten der Bevölkerung durchdrungen hatte und die Abrechnungen der Verwaltungsstellen ebenso minutiös wie – aus den früher erwähnten Gründen – unübersichtlich waren. Die mittelalterliche Jugendlehre (Siao Hio I, 29) zählt zwar unter den sechs »Künsten« auch das Rechnen auf und zur Zeit der Teilstaaten gab es eine Mathematik, welche angeblich neben Regeldetri und kaufmännischem Rechnen auch Trigonometrie einschloß. Angeblich sei diese Literatur bei der Bücherverbrennung Schi Hoang Ti's bis auf Trümmer verloren gegangen267. Jedenfalls ist von der Rechenkunst weiterhin in der Erziehungslehre nirgends mehr auch nur die Rede268.
Innerhalb der Erziehung des vornehmen Mandarinentums trat die Schulung im Rechnen im Lauf der Geschichte immer mehr zurück und verschwand schließlich ganz: die gebildeten Kaufleute lernten es erst im Kontor. Der Mandarin war seit der Reichseinheit und der Erschlaffung der Rationalisierungstendenz in der Staatsverwaltung ein vornehmer Literat, nicht aber ein Mann, der sich mit der »σχολή« des Rechnens befaßte.
Der weltliche Charakter dieser Bildung stand im Gegensatz gegen andere, ihr sonst verwandte, Erziehungssysteme literarischen Gepräges. Die literarischen Prüfungen waren rein politische Angelegenheit. Der Unterricht erfolgte teils durch private Einzellehre, teils in gestifteten Kollegien mit Lehrkörpern. Doch kein Priester war an ihm beteiligt. Die christlichen Universitäten des Mittelalters entstanden, als eine rationale, weltliche und kirchliche, Rechtslehre und eine rationale (dialektische) Theologie für praktische und für ideelle Zwecke Bedürfnis wurden. Die Universitäten des Islam trieben nach dem Muster der spätrömischen Rechtsschulen und der christlichen Theologie Kasuistik des heiligen Rechts und der Glaubenslehre, die Rabbinen Gesetzesauslegung, die Philosophenschulen der Brahmanen spekulative Philosophie, Ritual und heiliges Recht. Stets bildeten geistliche Standespersonen oder Theologen entweder überhaupt allein den Lehrkörper oder doch dessen Grundstock, an den sich die in den Händen weltlicher Lehrer befindlichen anderen Fächer angliederten. Im Christentum, Islam, Hinduismus waren Pfründen die Ziele, um derenwillen das Bildungspatent erstrebt wurde. Außerdem natürlich die Qualifikationen zu ritueller oder seelsorgerischer Tätigkeit. Bei den »gratis«arbeitenden alten jüdischen Lehrern (Vorläufern der Rabbinen) nur die Qualifikation zum religiös unentbehrlichen Unterricht der Laien im Gesetz.
Stets aber war die Bildung dabei durch heilige oder kultische Schriften gebunden. Nur die hellenischen Philosophenschulen pflegten eine reine Laienbildung ohne alle Schriftgebundenheit, ohne alle direkten Pfründeninteressen und nur im Interesse der Erziehung hellenischer »Gentlemen« (Kaloikagathoi). Die chinesische Bildung diente Pfründeninteressen und war schriftgebunden, dabei aber reine Laienbildung teils rituellzeremonialen, teils traditionalistisch-ethischen Gepräges. Weder Mathematik noch Naturwissenschaft, noch Geographie, noch Sprachlehre trieb die Schule. Die Philosophie selbst hatte weder spekulativ-systematischen Charakter, wie die hellenische und, teilweise und in anderem Sinne, die indische und die okzidental-theologische Schulung, noch rational-formalistischen, wie die okzidental-juristische, noch empirisch-kasuistischen, wie die rabbinische, die islamische und, teilweise, die indische. Sie gebar keine Scholastik, da sie nicht, wie der Okzident und vorderasiatische Orient, beide auf hellenistischer Basis, eine fachmäßige Logik betrieb. Dieser Begriff sogar blieb der rein an den praktischen Problemen und Standesinteressen der Patrimonialbureaukratie orientierten, schriftgebundenen und undialektischen chinesischen Philosophie schlechterdings fremd. Was es bedeutete, daß dieser Kernproblemkreis aller abendländischen Philosophie ihr unbekannt blieb, tritt in der Art der Denkformen der chinesischen Philosophen, Konfuzius an der Spitze, ungemein deutlich zutage. Bei größter praktischer Nüchternheit verharrten die geistigen Werkzeuge in einer Gestalt, die – gerade bei manchen wirklich geistvollen, dem Konfuzius zugeschriebenen Aussprüchen – in ihrer Gleichnishaftigkeit eher an die Ausdrucksmittel indianischer Häuptlinge als an eine rationale Argumentation erinnert. Das Fehlen des Gebrauchs der Rede als eines rationalen Mittels zur Erzielung politischer und forensischer Wirkungen, wie es historisch zuerst in der hellenischen Polis gepflegt wurde, wie es aber in einem bureaukratischen Patrimonialstaat mit nicht formalisierter Justiz gar nicht entwickelt werden konnte, machte sich darin fühlbar. Die chinesische Justiz blieb teils summarische Kabinettsjustiz (der hohen Beamten), teils Aktenjustiz. Es gab kein Plädoyer, sondern nur schriftliche Eingaben und mündliche Einvernahme der Beteiligten. In gleichem Sinn aber wirkte die Uebermacht der Gebundenheit an die konventionellen Schicklichkeitsinteressen der Bureaukratie, welche die Erörterung »letzter« spekulativer Probleme als praktisch unfruchtbar, unziemlich und für die eigene Position, wegen der Gefahr von Neuerungen, bedenklich ablehnte.
Wenn so die Technik und der sachliche Gehalt der Prüfungen rein weltlichen Charakter hatten und eine Art von »Literatenkultur-Examen« darstellten, so verband doch die volkstümliche Anschauung mit ihnen einen ganz anderen, magischcharismatischen, Sinn. In den Augen der Massen war der chinesische, erfolgreich geprüfte Kandidat und Beamte keineswegs nur ein durch Kenntnisse qualifizierter Amtsanwärter, sondern ein erprobter Träger magischer Qualitäten, die – wie wir bald sehen werden – dem diplomierten Mandarin ebenso anhafteten wie dem geprüften und ordinierten Priester einer kirchlichen Gnadenanstalt oder dem zünftig erprobten Magier. Und auch die Stellung des mit Erfolg geprüften Kandidaten und Beamten entsprach in wichtigen Punkten derjenigen etwa eines katholischen Kaplans. Die Absolvierung des Unterrichts und der Prüfung bedeutete kein Ende der Unmündigkeit des Zöglings. Der zum »Baccalaureat« Geprüfte unterstand der Disziplin des Schuldirektors und der Examinatoren. Bei schlechter Führung wurde er aus den Listen gestrichen. Er erhielt unter Umständen Schläge in die Hand. Hatte dann der Amtsanwärter die Prüfungen der höheren Grade mit ihrer strengen Klausur glücklich passiert: – in den Klausurzellen der Prüfungslokalitäten waren schwere Erkrankungen, Todesfälle durch Selbstmorde nicht selten und galten, der charismatischen Auffassung der Prüfung als magischer »Erprobung« entsprechend, als Beweis sündhaften Lebenswandels des Betroffenen, – und rückte er dann, je nach der Rangnummer der bestandenen Prüfung und der Patronage, die er besaß, in ein Amt ein, so blieb er auch weiterhin sein Leben lang unter Schulkontrolle. Nicht nur unterstand er, außer der Gewalt seiner Vorgesetzten, der beständigen Aufsicht und Kritik der Zensoren: ihre Rüge erstreckt sich ja auch auf die rituelle Korrektheit des Himmelssohnes selbst. Und nicht nur war von jeher vorgeschrieben und nach Art der katholischen Sündenbeichte als Verdienst gewertet die Selbstanklage der Beamten269. Sondern periodisch, der Regel nach alle drei Jahre, sollte im Reichsanzeiger270 (wie wir sagen würden) seine durch die amtlichen Erhebungen der Zensoren und Vorgesetzten festgestellte Konduite veröffentlicht werden: das Verzeichnis seiner Verdienste und Fehler; und je nach dem Ausfall dieser öffentlichen Schulzensur wurde er in der Stelle belassen, hinauf oder auch hinab versetzt271. Daß für den Ausfall dieser Konduiten regelmäßig andere als nur sachliche Momente den Ausschlag gaben, ist eine Sache für sich. Hier kommt es auf den »Geist« an und dieser war der eines lebenslänglichen Pennalismus von Amts wegen.
Alle, auch die nur examinierten, nicht angestellten Literaten waren ständisch privilegiert. Die Literaten erfreuten sich nach Festigung ihrer Stellung bald spezifischer ständischer Privilegien. Die wichtigsten waren: 1. Freiheit von den »sordida munera«, den Fronden, – 2. Freiheit von der Prügelstrafe, – 3. Pfründen (Stipendien). Dies letztere Privileg ist durch die Finanzlage in seiner Tragweite längst ziemlich stark reduziert. Es bestanden zwar für Seng zum (»Baccalaureen«) noch Studienstipendien (10$ jährlich) unter der Bedingung, alle 3-6 Jahre der Kiu jie-(»Lizentiaten«-)Prüfung sich zu unterziehen. Aber das bedeutete natürlich nichts Entscheidendes. Die Lasten der Ausbildung und: der Karenzzeiten fielen faktisch der Sippe anheim, wie wir sahen, – sie hoffte durch das schließliche Einlaufen ihres Mitgliedes in den Hafen des Amts auf ihre Kosten zu kommen. Die beiden andern waren noch bis zuletzt von Bedeutung. Denn Fronden kamen, wenn auch in sinkendem Ausmaß, immer noch vor. Prügel aber blieben die nationale Strafform. Sie entstammten ihrerseits der fürchterlichen Prügelpädagogik der chinesischen Volksschule, deren Eigenart in folgenden an unser Mittelalter erinnernden, aber doch offenbar noch extremer entwickelten, Zügen bestehen soll272: Die Väter (der Sippen oder Dörfer) stellten die »rote Karte« (Schülerliste, Kuan tan) zusammen, engagierten aus den stets in Ueberangebot vorhanden amtslosen Literaten den Schulmeister auf Zeit, der Ahnentempel (oder andere ungenutzte Räume) war der bevorzugte Schulraum; von früh bis spät ertönte das Unisono-Brüllen der geschriebenen »Linien«; der Schüler war den ganzen Tag in einem Zustande der »Verbiesterung« (das Zeichen dafür – meng – ist: ein Schwein im Kraut). Der Student und Graduierte erhielt noch »Tatzen« (in die Hand, nicht mehr: auf das – nach der Terminologie deutscher Mütter alten Schlages: – »gottgewollte Plätzchen«), die hoch Promovierten waren, solange sie nicht degradiert wurden, ganz frei davon. Die Fronfreiheit findet sich im Mittelalter als ganz feststehend. Immerhin, trotz (und: wegen) dieser Privilegien – die wie gesagt, prekär waren, weil sie durch die nicht seltene Degradation sofort entfielen – war auf diesem Boden: der Prüfungsdiplomierung als Standesqualifikation, der möglichen Degradation, der jugendlichen und der bei Degradierten noch im Alter möglichen und nicht ganz seltenen Prügel die Entwicklung feudaler Ehrbegriffe ausgeschlossen. Solche hatten einst, in der Vergangenheit, mit gewaltiger Intensität das Leben beherrscht.