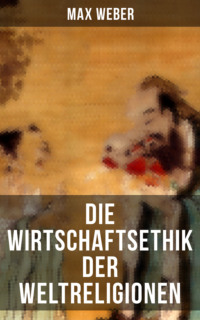Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 13
»Offenheit« und »Loyalität« rühmte die alte Annalistik als Kardinaltugenden273. »Mit Ehre zu sterben« war die alte Parole. »Unglücklichsein und nicht zu sterben wissen ist feig.« So insbesondere ein Offizier, der nicht »bis zum Tode« kämpfte274. Selbstmord eines Generals, der eine Schlacht verloren hatte, war eine Tat, die er sich als Privileg rechnete: ihn ihm zu gestatten hieß: auf das Recht der Strafe verzichten und galt daher als nicht unbedenklich275. Durch die patriarchale Hiao-Vorstellung waren diese feudalen Begriffe abgewandelt worden: man soll Verleumdungen leiden und unter ihren Folgen in den Tod gehen, wenn es der Ehre des Herrn nutzt; man kann (und soll) überhaupt durch treuen Dienst alle Fehler des Herrn ausgleichen, und das war hiao. Der Kotau vor dem Vater, älteren Bruder, Gläubiger, Beamten, Kaiser war gewiß kein Symptom feudaler Ehre: vor einer Geliebten zu knien wäre dagegen für den korrekten Chinesen ganz perhorresziert gewesen. Alles umgekehrt wie bei Rittern und cortegiani im Okzident.
Die Ehre des Beamten behielt in starkem Maße einen Einschlag von durch Prüfungsleistungen und öffentliche Zensuren der Vorgesetzten geregelter Scholarenehre, auch wenn er die höchsten Prüfungen absolviert hatte. Ganz anders noch als dies für jede Bureaukratie (wenigstens auf den unteren Staffeln, und in Württemberg mit seinem berühmten »Note- I-Fischer«, auch in den höchsten Amtsstellungen) ebenfalls in gewissem Sinn galt.
Der eigentümliche Scholarengeist, den das Prüfungswesen züchtete, hing eng mit den Grundvoraussetzungen zusammen, von welchen die orthodoxe (und übrigens auch fast jede heterodoxe) chinesische Lehre ausging. Der Dualismus der Schen und Kwei, der guten und bösen Geister, der himmlischen Yang gegenüber der irdischen Yin-Substanz auch innerhalb der Seele des einzelnen Menschen mußte es als einzige Aufgabe der Erziehung, auch der Selbsterziehung, erscheinen lassen: die Yang-Substanz in der Seele des Menschen zur Entfaltung zu bringen276. Denn der Mensch, in welchem sie gänzlich die Oberhand über die dämonischen (Kwei-) Mächte, die in ihm ruhen, gewonnen hat, besitzt Macht – nach der alten Vorstellung: magische Macht – über die Geister. Die guten Geister aber sind diejenigen, welche Ordnung und Schönheit, die Harmonie der Welt, schützen. Die Selbstvervollkommnung zu einem Abbild dieser Harmonie ist daher das höchste und einzige Mittel, jene Macht zu erlangen. Der »Kiün-tse«, der »fürstliche Mensch«, einst: der »Held«, war der Literatenzeit der zu allseitiger Selbstvervollkommnung gelangte Mensch: ein »Kunstwerk« im Sinne eines klassischen, ewig gültigen, seelischen Schönheitskanons, wie ihn die überlieferte Literatur in die Seelen ihrer Schüler pflanzte. Daß andererseits die Geister die »Güte« im Sinn der sozialethischen Tüchtigkeit belohnen, war seit der Han-Zeit spätestens277 feststehender Glaube der Literaten. Güte, temperiert durch klassische (= kanonische) Schönheit, war daher das Ziel der Selbstvervollkommnung. Kanonisch vollendete schöne Leistungen waren, wie der letzte Maßstab der höchsten Prüfungsqualifikation, so die Sehnsucht jedes Scholaren. Ein vollkommener Literat, das heißt, ein (durch Erringung der höchsten Grade) »gekrönter Dichter« zu werden, war der Jugendehrgeiz Li Hung Tschangs'278: daß er ein Kalligraph von großer Meisterschaft ist, daß er die Klassiker, vor allem des Konfuzius »Frühling und Herbst« (die früher erwähnten, für unsere Begriffe unendlich dürftigen »Annalen«) wörtlich hersagen kann, blieb sein Stolz und war für seinen Oheim, nachdem er dies erprobt, Anlaß, ihm seine Jugenduntugenden zu verzeihen und ein Amt zu verschaffen. Alle anderen Kenntnisse (Algebra, Astronomie) galten ihm nur als unumgängliche Mittel, »ein großer Poet zu werden«. Die klassische Vollendung des Gedichts, welches er als Gebet im Tempel der Seidenbau-Schutzgöttin im Namen der Kaiserin-Witwe verfaßt hatte, erwarb ihm die Gunst der Herrscherin. Wortspiele, Euphuismen, Anspielungen auf klassische Zitate und eine feine, rein literarische Geistigkeit galt als Ideal der Konversation vornehmer Männer, von der alle aktuelle Politik ausgeschlossen blieb279. Daß diese sublimierte, klassisch gebundene »Salon«-Bildung zur Verwaltung großer Gebiete befähigen sollte, mag uns befremdlich erscheinen. Und in der Tat: mit bloßer Poesie verwaltete man auch in China nicht. Aber der chinesische Amtspfründner bewährte seine Standesqualifikation, sein Charisma, durch die kanonische Richtigkeit seiner literaturgerechten Formen, auf welche deshalb auch im amtlichen Verkehr bedeutendes Gewicht gelegt wurde. Zahlreiche wichtige Kundgebungen der Kaiser, als der Hohenpriester der literarischen Kunst, hatten die Form von Lehrgedichten. Und andererseits hatte der Beamte sein Charisma darin zu bewähren, daß seine Verwaltung »harmonisch«, d.h. ohne Störungen durch unruhige Geister der Natur oder der Menschen, ablief, mochte die wirkliche »Arbeit« auch auf den Schultern von Subalternen ruhen. Belohnend, strafend, scheltend, ermahnend, aufmunternd, belobend stand, sahen wir, über ihm der kaiserliche Pontifex, seine Literatenakademie und sein Zensorenkollegium, dies alles: vor aller Oeffentlichkeit.
Die ganze Verwaltung und die Laufbahn-Schicksale der Beamten mit ihren (angeblichen) Gründen, spielte sich infolge jener Drucklegung der »Personalakten« und der Publikation aller Berichte, Anträge und Gutachten vor der breitesten Oeffentlichkeit ab, weit mehr als irgendeine parlamentarisch kontrollierte Verwaltung bei uns, welche auf Wahrung des »Dienstgeheimnisses« das entschiedenste Gewicht legt. Wenigstens der offiziellen Fiktion nach war die amtliche Zeitung eine Art fortlaufender Rechenschaftsbericht des Kaisers vor dem Himmel und den Untertanen: der klassische Ausdruck jener besonderen Art von Verantwortlichkeit, welche aus seiner charismatischen Qualifikation folgte. Wie fragwürdig immer die Realität der offiziellen Begründung und die Vollständigkeit der Wiedergabe sein mochte, – was für die Mitteilungen unserer Bureaukratie an unsere Parlamente schließlich doch wohl ganz ebenso gilt, – so war dies Verfahren doch immerhin geeignet, dem Druck der öffentlichen Meinung gegenüber der Amtsführung der Beamten ein ziemlich starkes und oft recht wirksames Ventil zu öffnen.
In China, wie überall, waren es vor allem die unteren, mit der Bevölkerung praktisch in die nächste Berührung gelangenden Stufen der Hierarchie, gegen die sich der allem Patrimonialismus gemeinsame Haß und das Mißtrauen der von ihnen Regierten und deren ebenfalls überall typische, apolitische Vermeidung jeder nicht unbedingt nötigen Berührung mit dem »Staat« wendete. Aber dieser Apolitismus tat der Bedeutung der offiziellen Bildung für die Prägung des Volkscharakters keinen Eintrag.
Die starken Ansprüche an die Ausbildungszeit, – zum Teil durch die Eigenart der chinesischen Schrift, zum Teil durch die des Lernstoffes bedingt, – und die oft sehr lange Wartezeit nötigten diejenigen, welche nicht aus eigenem oder geliehenem oder in der früher erwähnten Art von der Familie erspartem Vermögen leben konnten, vor Abschluß des Bildungsganges in praktische Berufe aller Art, vom Kaufmann bis zum Wunderdoktor, abzuspringen. Sie gelangten dann nicht bis zu den Klassikern selbst, sondern nur bis zum Studium des letzten (sechsten) Lehrbuchs, der durch Alter ehrwürdigen »Jugendlehre« (Siao Hioh)280, welche wesentlich Extrakte aus Klassikern enthielt. Nur dieser Unterschied des Bildungs niveaus, nicht aber der Bildungs art schied diese Kreise von der Bureaukratie. Denn eine andere Bildungsart als die klassische gab es nicht. Der Prozentsatz der durch das Examen fallenden Kandidaten war ganz außerordentlich groß. Der infolge der festen Kontingentierung281 prozentual geringe Bruchteil der in den höheren Graden Diplomierten übertraf dennoch an Zahl die verfügbaren Amtspfründen stets um ein Vielfaches. Um diese konkurrierten sie durch persönliche Patronage282 oder durch eigenes oder entliehenes Kaufgeld: Pfründenverkauf fungierte hier wie in Europa als ein Mittel der Aufbringung von Kapital für Staatszwecke und ersetzte283 sehr oft die Prüfungsqualifikation. Die Proteste der Reformer gegen den Aemterverkauf haben, wie die zahlreichen Eingaben dieser Art in der Peking Gazette zeigen, bis in die letzten Tage des alten Systems gedauert.
Die kurze offizielle Amtsfrist der Beamten (drei Jahre) – ganz entsprechend ähnlichen islamischen Einrichtungen – ließ irgendeine intensive rationale Beeinflussung der Wirtschaft durch die staatliche Verwaltung als solche trotz deren theoretischer Allgewalt nur unstet und stoßweise aufkommen. Es ist erstaunlich, mit wie wenig fest angestellten Beamten die Verwaltung auskommen zu können glaubte. Die Ziffern allein schon ergeben zur Evidenz: daß in aller Regel der Gang der Dinge, soweit er nicht staatliche Macht- und Fiskalinteressen berührte, sich selbst überlassen gewesen sein muß und die Mächte der Tradition: Sippen, Dörfer, Gilden und andere Berufsverbände, die normalen Träger der Ordnung blieben. Dennoch und trotz des eben erwähnten starken Apoli tismus der Massen war der Einfluß der Anschauungen der Amtsanwärterschicht auch auf die Art der Lebensführung der Mittelstandsschichten sehr bedeutend. Zunächst und vor allem infolge der volkstümlichen magisch-charismatischen Auffassung der durch die Prüfung erprobten Amtsqualifikation. Der Geprüfte hatte durch Leistung der Prüfung erwiesen, daß er in eminentem Maße Träger des »schen« sei. Hohe Mandarinen galten als magisch qualifiziert. Sie selbst konnten immer, – die »Bewährung« des Charisma vorbehalten, – nach dem Tode und schon bei Lebzeiten Gegenstand eines Kults werden. Die überall urwüchsige magische Bedeutung des Schreibwesens und der Urkunde gab ihren Siegeln und ihrer Handschrift apotropäische und therapeutische Bedeutung und dies konnte sich bis auf das Prüfungsgerät der Kandidaten erstrecken. Ein vom Kaiser als Erster placierter Prüfling des höchsten Grades galt als Ehre und Vorteil der Provinz284, aus der er stammte, und jeder, dessen Name nach bestandener Prüfung öffentlich angeschlagen wurde, der hatte »einen Namen im Dorf«. Alle Gilden und anderen Klubs von irgendwelcher Bedeutung bedurften eines Literaten als Sekretärs, und diese und ähnliche Stellen standen denjenigen Promovierten offen, für welche eine Amtspfründe nicht zur Verfügung stand. Die Amtsinhaber und geprüften Amtsanwärter waren kraft ihres magischen Charisma und ihrer Patronagebeziehungen, gerade soweit sie aus Kleinbürgerkreisen stammten, statt der in Indien die gleiche Rolle versehenden Brahmanen (»Gurus«), die naturgemäßen »Beichtväter« und Berater in allen wichtigen Angelegenheiten für ihre Sippen. Der Amtsinhaber war, wie wir ebenfalls schon sahen, neben dem Staatslieferanten und großen Händler, diejenige Persönlichkeit, welche am meisten Chancen hatte, Besitz zu akkumulieren. Oekonomisch wie persönlich war daher der Einfluß dieser Schicht auch außerhalb der eigenen Sippe, – innerhalb deren ja, wie früher betont, die Autorität des Alters ein starkes Gegengewicht bildete, – für die Bevölkerung annähernd so groß, wie im antiken Aegypten diejenige der Schreiber und Priester zusammengenommen. Ganz unabhängig von der »Würdigkeit« der im Volksdrama oft verspotteten einzelnen Beamten stand dies Prestige der literarischen Bildung als solcher doch bei der Bevölkerung felsenfest, so lange, bis es durch moderne, okzidental geschulte Mitglieder der eigenen Schicht untergraben wurde.
Der soziale Charakter der Bildungsschicht bestimmte nun auch ihre Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik. Wie so viele andere typischen Züge patrimonial-bureaukratischer Gebilde theokratischer Prägung trug das Staatswesen seiner eigenen Legende nach schon seit Jahrtausenden den Charakter eines re ligiösutilitarischen Wohlfahrtsstaates. Allerdings hatte die reale Staatspolitik die Wirtschaftsgebarung, wenigstens soweit Produktion und Erwerb in Betracht kam, in China ebenso wie im alten Orient, seit schon sehr langen Zeiten im wesentlichen – soweit nicht Neusiedelungen, Meliorationen (durch Bewässerung) und fiskalische oder militärische Interessen im Spiel waren – immer wieder sich selbst überlassen, aus den schon erörterten Gründen. Nur die militärischen und militärfiskalischen Interessen hatten immer aufs neue – wie wir sahen – leiturgische, monopolistische oder steuerlich bedingte, oft recht tiefe, Eingriffe in das Wirtschaftsleben: teils merkantilistische, teils ständische Reglementierung, hervorgerufen. Mit dem Ende des nationalen Militarismus fiel alle derartige planmäßige »Wirtschaftspolitik« dahin. Die Regierung, im Bewußtsein der Schwäche ihres Verwaltungsapparates, begnügte sich nun mit der Sorge für Vorflut und Unterhaltung der Wasserstraßen, welche für die Reisversorgung der führenden Provinzen unentbehrlich waren, im übrigen mit der typischen patrimonialen Teuerungs- und Konsumpolitik. Sie besaß keine Handelspolitik285 im modernen Sinne: die Zölle, welche die Mandarinen an den Wasserstraßen errichteten, hatten, soviel bekannt, nur fiskalischen, niemals wirtschaftspolitischen Charakter. Sie verfolgte auch sonst, im ganzen genommen, kaum andere als fiskalische und polizeiliche wirtschaftspolitische Interessen, wenn man von den – bei dem charismatischen Charakter der Herrschaft – stets politisch gefährlichen Notstandszeiten absieht. Der, soviel bekannt, großzügigste Versuch einer einheitlichen Wirtschaftsorganisation: das Staatshandelsmonopol für den ganzen Ernteertrag, wie es im 11. Jahrhundert durch Wang An Schi geplant wurde, sollte neben fiskalischen Gewinnen in erster Linie dem Preisausgleich dienen und war mit einer Bodensteuerreform verknüpft. Der Versuch mißlang. Wie die Wirtschaft daher in weitem Maße sich selbst überlassen blieb, so setzte sich auch die Abneigung gegen »Staatsintervention« in ökonomischen Dingen, vor allem gegen die dem Patrimonialismus überall als Fiskalmaßregel geläufigen Monopolprivilegien286 als eine dauernde Grundstimmung fest. Allerdings nur als eine neben ganz andern, aus der Ueberzeugung von der Abhängigkeit alles Wohlergehens der Untertanen von dem Charisma des Herrschers hervorgehenden Vorstellungen, die oft ziemlich unvermittelt daneben standen und die typische Vielregiererei des Patrimonialismus wenigstens als Gelegenheitserscheinung immer erneut erstehen ließen. Und ferner stets mit dem selbstverständlichen Vorbehalt der teuerungs- und nahrungspolitischen Reglementierung des Konsums, wie sie auch die Theorie des Konfuzianismus in zahlreichen Spezialnormen über Ausgaben aller Art kennt. Vor allem aber mit der jeder Bureaukratie selbstverständlichen Abneigung gegen zu schroffe, rein ökonomisch durch freien Tausch bedingte Differenzierung. Die zunehmende Stabilität der ökonomischen Zustände unter den Bedingungen des ökonomisch im wesentlichen autark gewordenen und sozial gleichartig gegliederten Weltreichs ließ ökonomische Probleme, wie sie die englische Literatur des 17. Jahrhunderts erörterte, gar nicht entstehen. Es fehlte durchaus jene selbstbewußte und politisch von der Regierung nicht zu ignorierende bürgerliche Schicht, an deren Interessen sich die »pamphlets« jener Zeit in England in erster Linie wendeten. Nur »statisch« wo es der Erhaltung der Tradition und ihrer speziellen Privilegien galt, war die Haltung der Kaufmannsgilden für die Verwaltung eine ernsthaft in Rechnung zu stellende Größe, wie überall unter patrimonial-bureaukratischen Verhältnissen. Dynamisch dagegen fiel sie nicht ins Gewicht, weil expansive kapitalistische Interessen von hinlänglicher Stärke nicht (nicht mehr!) existierten, um, wie in England, die Staatsverwaltung in ihren Dienst zwingen zu können. –
Die politische Gesamtstellung der Literaten wird nur verständlich, wenn man sich gegenwärtig hält, gegen welche Mächte sie zu kämpfen hatten. Vorerst sehen wir von den Heterodoxien ab, von denen später (Nr. IV) die Rede sein wird. In der Frühzeit waren ihre Hauptgegner die »großen Familien« der Feudalzeit gewesen, die sich nicht aus ihrer Amtsmonopolstellung hatten drängen lassen wollen. Sie haben sich mit den Bedürfnissen des Patrimonialismus und der Ueberlegenheit der Schriftkunde abfinden müssen und haben Mittel und Wege gefunden, durch kaiserliche Gnade ihren Söhnen den Weg zu ebnen. Sodann: die kapitalistischen Amtskäufer: die natürliche Folge der ständischen Nivellierung und Geldwirtschaft in den Finanzen. Hier konnte der Kampf nicht dauernd und absolut, sondern nur relativ erfolgreich sein, weil jeder Kriegsbedarf als einziges Finanzierungsmittel der finanzlosen Zentralverwaltung Pfründen verschacherung darbot, auch bis in die jüngste Gegenwart. Sodann: die rationalistischen Interessen der Verwaltung am Fach beamtentum. Schon 601 unter Wen ti hervorgetreten, feierten sie 1068 unter Wang An Schiin der Not der Verteidigungskriege einen kurzlebigen vollen Triumph. Aber die Tradition siegte abermals und nun endgültig. – Es blieb nur ein dauernder Hauptfeind: der Sultanismus und die ihn stützende Eunuchen wirtschaft287: der Einfluß des eben deshalb von den Konfuzianern mit tiefstem Mißtrauen angesehenen Harems. Ohne die Einsicht in diesen Kampf ist die chinesische Geschichte vielfach fast unverständlich.
Schon unter Schi Hoang Ti begann dieses zwei Jahrtausende dauernde Ringen und setzte sich dann unter allen Dynastien fort. Denn energische Herrscher versuchten natürlich stets erneut, mit Hilfe der Eunuchen und plebejischer Parvenus die Bindung an die ständisch vornehme Bildungsschicht der Literaten abzuschütteln. Zahlreiche Literaten, die gegen diese Form des Absolutismus auftraten, haben ihr Leben für die Macht ihres Standes lassen müssen. Aber auf die Dauer blieben die Literaten immer wieder siegreich288. Jede Dürre, Ueberschwemmung, Sonnenfinsternis, Niederlage und jedes auftretende und bedrohliche Ereignis überhaupt spielte ihnen sofort wieder die Macht in die Hände, da es als Folge des Bruches der Tradition und des Verlassens der klassischen Lebensführung angesehen wurde, deren Hüter die Literaten, vertreten durch Censoren und »Hanlin-Akademie«, waren. »Freie Aussprache« wurde in allen solchen Fällen gewährt, die Beratung des Thrones erbeten und der Erfolg war dann stets: Abstellung der unklassischen Regierungsform, Tötung oder Verbannung der Eunuchen, Zurückführung der Lebensform in die klassischen Schemata, kurz: Anpassung an die Literaten-Anforderungen. Die Gefahr der Haremswirtschaft war, infolge der Art der Thronfolge, recht groß: unmündiger Kaiser unter Weibervormundschaft waren zeitweise geradezu Regel geworden. Noch die letzte Kaiserin-Regentin: Tsu hsi, hat mit Eunuchen zu regieren gesucht289. Welche Rolle bei diesen durch die ganze chinesische Geschichte sich ziehenden Kämpfen die Taoisten und Buddhisten gespielt haben: – warum und inwieweit sie natürliche, inwieweit Konstellations-Koalierte der Eunuchen waren, – ist hier noch nicht zu erörtern. Mehr beiläufig sei bemerkt, daß auch die Astrologie wenigstens dem modernen Konfuzianismus als unklassische Superstition290 und Konkurrenz gegen die alleinige Bedeutung des Tao-Charisma des Kaisers für den Gang der Regierung galt, was ursprünglich nicht der Fall war. Hier dürfte die Ressort-Konkurrenz der Hanlin-Akademie gegen das Astrologenkollegium entscheidend mitgespielt haben291, vielleicht auch die jesuitische Provenienz der astronomischen Meßinstrumente.
Nach der Ueberzeugung der Konfuzianer brachte das Zutrauen zur Magie, welches die Eunuchen pflegten, alles Unheil. In seiner Denkschrift vom Jahre 1901 wirft Tao Mo der Kaiserin vor, daß im Jahre 1875 durch ihre Schuld der wahre Thronerbe beseitigt sei, trotz Protestes der Zensoren, was der Zensor Wu Ko Tu ihr mit Selbstmord quittiert habe. Männliche Schönheit zeichnet diese hinterlassene Denkschrift an die Regentin und den Brief an seinen Sohn aus292. An der reinen und tiefen Ueberzeugung bleibt nicht der mindeste Zweifel. Auch der Glaube der Kaiserin und zahlreicher Prinzen an die magische Begnadung der Boxer, der ihre ganze Politik allein erklärt, war sicher Eunuchen-Einflüssen zuzuschreiben293. Auf dem Totenbett hat die immerhin imposante Frau als ihren Rat hinterlassen: 1. nie wieder ein Weib in China herrschen zu lassen, – 2. die Eunuchen-Wirtschaft für immer abzutun294. – Anders als sie – wenn der Bericht zutrifft – zweifellos gedacht, ging dies in Erfüllung. Aber man darf nicht im Zweifel sein: daß für den echten Konfuzianer alles seither Geschehene, vor allem: die »Revolution« und der Sturz der Dynastie, nur eine Bestätigung der Richtigkeit der Glaubens an die Bedeutung des Charisma klassischer Tugend der Dynastie bedeuten kann und im (unwahrscheinlichen aber möglichen) Fall einer konfuzianischen Restauration so verwertet werden würde.
Das konfuzianische, letztlich pazifistische, an innenpolitischer Wohlfahrt orientierte, Literatentum stand natürlich den militärischen Mächten ablehnend oder verständnislos gegenüber. Von der Beziehung zu den Offizieren wurde schon geredet. Die ganze Annalistik ist davon paradigmatisch erfüllt, sahen wir. Proteste dagegen, daß man »Prätorianer« zu Zensoren (und Beamten) mache, finden sich in der Annalistik295. Besonders da die Eunuchen als Favorit-Generäle nach Art des Narses beliebt waren, lag diese Gegnerschaft gegen das rein sultanistisch-patrimoniale Heer nahe. Den populären militärischen Usurpator Wang Mang rühmen sich die Literaten gestürzt zu haben: die Gefahr des Regierens mit Plebjern lag eben bei Diktatoren stets sehr nahe. Nur dieser eine Versuch aber ist bekannt. Dagegen der faktischen, auch rein durch Usurpation (wie die Han) oder Eroberung (Mongolen, Mandschu) geschaffenen Gewalt haben sie sich, auch unter Opfern – die Mandschus nahmen 50% der Aemter, ohne Bildungsqualifikation – gefügt, wenn der Herrscher sich seinerseits ihren rituellen und zeremoniellen Anforderungen fügte: dann stellten sie sich, modern ausgedrückt, »auf den Boden der Tatsachen«.
»Konstitutionell« konnte – das war die Theorie der Konfuzianer – der Kaiser nur durch diplomierte Literaten als Beamte regieren, »klassisch« nur durch orthodox konfuzianische Beamte. Jede Abweichung davon konnte Unheil und, bei Hartnäckigkeit, Sturz des Kaisers und Untergang der Dynastie bringen. – Welches war nun der materiale Gehalt der orthodoxen Ethik dieses für den Geist der Staatsverwaltung und der herrschenden Schichten maßgebenden Standes?