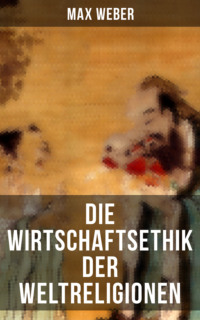Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 9
Die Entwaffnung des Landes unter Schi Hoang Ti (die Tradition behauptet: die von den Beamten in 36 dazu gebildeten Bezirken gesammelten Waffen seien in Glocken umgeschmolzen worden) sollte dauernde Befriedung des Landes bedeuten (wie der Kaiser in seinen Edikten immer wieder verkündete). Aber die Festungen an der Grenze mußten besetzt werden und daher wurde die Bevölkerung zum Dienst abwechselnd in den Grenzsiedelungen und in der Robott für die kaiserlichen Bauten (je 1 Jahr) gepreßt. Zwar dies Ausmaß blieb rein theoretisch. Die Schaffung des Einheitsreichs ging aber, wie schon erwähnt, mit einer riesigen Anspannung der Fronlasten der Zivilbevölkerung für Bauzwecke Hand in Hand. Dabei war das Heer dennoch wesentlich ein Berufsheer geblieben. Dies Prätorianerheer brachte chronisch en Bürgerkrieg. Unter den Han wurde daher der Versuch gemacht, das stehende Berufsheer durch eine gepreßte Armee zu ersetz en (oder doch: zu ergänzen). Jeder 23 jährige sollte 1 Jahr im stehenden Heer (Wei Schi, »Herde«) dienen, dann 2 Jahre in der Miliz (zai huang schi); Uebungen im Bogenschießen, Reiten, Wagenlenken waren vorgesehen, die mit dem 55. Jahr aufhörten. Die Fronpflicht sollte 1 Monat im Jahr betragen. Stellvertreter zu mieten war gestattet. In welchem Maße aus diesen Plänen, eine riesige Militärmacht zu schaffen, je Wirklichkeit wurde, steht wohl dahin. Jedenfalls war im 6. Jahrhundert n. Chr. die Fronpflicht stark angespannt: offiziell je nach der Ernte theoretisch 1-3 Dekaden im Jahr für je einen Arbeiter auf die Familie. Dazu traten die militärischen Uebungen und die auch in der chinesischen Poesie besonders schwer beklagten Grenzerdienste im fernen Westen, welche die Familien für Jahre auseinanderrissen. Die Fronden steigerten sich: bei der oben erwähnten Bodenbesitz-»Reform« der Tang für Nichtsteuerzahler bis zu 5 Dekaden. Für die großen Flußbauten sollen zuweilen über 1 Million Seelen gleichzeitig aufgeboten worden sein. Die formelle allgemeine Wehrpflicht (Milizpflicht) aber blieb offensichtlich toter Buchstabe und hinderte nur die Entstehung eines technisch brauchbaren Heeres. Unter der San-Dynastie bestand die »Garde« als stehende Truppe, neben zwei Formationen örtlicher Truppen und Milizen, die miteinander verschmolzen und verfielen. Die Rekruten für die »Garde« wurden damals gepreßt und (wenigstens in einigen Provinzen) nach vorderasiatischer Art gebrandmarkt (1042). Den Kern des Heeres bildeten aber, wie aus allen zugänglichen Nachrichten hervorgeht, immer wieder nur die Söldner, deren Verläßlichkeit stets fraglich und insbesondere an regelmäßige Soldzahlung gebunden war. Die chronischen Finanznöte zwangen 1049 zu einer Einschränkung des Heeres in einer Zeit beständig drohender Ueberfälle der nordwestlichen Barbaren. In dieser Lage versuchte Wang-An-Schi durch eine rationale Reform die Mittel für die Aufstellung einer zureichenden und brauchbaren nationalen Armee zu schaffen. Wenn man diesen Reformversuch »staatssozialistisch« genannt hat, so trifft dieser Ausdruck nur etwa im gleichen sehr engen Sinne (wenn auch nicht ganz in gleicher Art) zu, wie für die monopolistische Bank- und Getreidespeicherpolitik der Ptolemäer, die auf einem sehr entwickelten geldwirtschaftlichen Fundament ruhte.
In Wahrheit180 handelte es sich um den Versuch, durch planmäßige Unterstützung und Regulierung des Anbaus und Monopolisierung und planmäßige Ordnung des Absatzes von Getreide in den Händen der Zentralgewalt, unter gleichzeitigem Ersatz der Fronden und Naturalabgaben durch Geldsteuern (tsian-schu-fa-System) Geld einnahmen zu schaffen und so die Mittel zu gewinnen, ein diszipliniertes und geschultes, unbedingt zur Verfügung des Kaisers stehendes großes nationales Heer zu schaffen. Der Theorie nach sollte von je 2 Erwachsenen einer zum Heer eingezogen werden können und wurden zu diesem Behufe Volkslisten vorgeschrieben und in Verbindung damit das System der Zehntschaften (bao tsja fa) unter gewählten Aeltesten, mit Rügepflicht und schichtweisem Nachtwachtdienst erneuert. Es sollten ferner Waffen (Bogen) von Staats wegen an die zur örtlichen Miliz reihum Eingezogenen verteilt, Pferde vom Staat gekauft, in Nutzung und Pflege der zum Reiterdienst Gemusterten gegeben und jährlich – unter Haftbarkeit des Uebernehmers und, eventuell, Zahlung von Prämien – gemustert werden. Die staatliche Magazinverwaltung, bisher durch die Naturalabgaben gespeist und leiturgisch von den Besitzenden versehen: – eine für diese ruinöse Last, die zugleich zu allen denkbaren Erpressungen führte, – sollte fortan in die Hände bezahlter Beamter gelegt, auf geldwirtschaftliche Grundlage gestellt und in den Dienst systematischer Wirtschaftspflege gestellt werden. Die Verwaltung gab Saatgutvorschüsse (Kin Miau: »Grüne Saat«), und Darlehen in natura oder in Geld: gegen 20 % Zinsen. Der Landbesitz sollte neu bonitiert und darnach, je nach der Klasse, Steuer, Fron (Mo zi) und Seelenanteil bestimmt werden. Statt der in Geld ablösbaren Fronden wollte man aus den Geldsteuererträgen Arbeiter dingen. Neben der Geldsteuerdurchführung war die Monopolisierung des Getreidehandels der seitdem in verschiedenen Formen immer wieder auftauchende Kernpunkt der Reformvorschläge. Die Regierung sollte in der billigen Zeit (Ernte) kaufen, magazinieren und aus diesen Vorräten die erwähnten Darlehen geben, außerdem aber Spekulationsgewinnste machen. Die Schaffung eines Fach beamtentums, insbesondere: geschulter Juristen, sollte die Reform technisch, die jährliche Aufstellung und Vorlage von Budgets durch sämtliche lokale Behörden die Einheit der Finanzverwaltung ökonomisch ermöglichen.
Die (konfuzianischen) Gegner Wang-An-Shi's beanstandeten, neben 1) dem militaristischen Charakter des Systems als solchem, besonders: 2) die für die Autorität der Beamten gefährliche, weil zu Aufständen reizende Volksbewaffnung und 3) die für die Steuerkraft bedenkliche Ausschaltung des Handels, vor allem: 4) den »Kornwucher« des Kaisers: die verzinslichen Saatdarlehen und die Experimente mit der Geldsteuer181. – Wang-An-Schi's Reform scheiterte in dem entscheidenden Punkt: der Militärverfassung, völlig, – nach allen Analogien zweifellos: weil der dafür unentbehrliche Verwaltungsstab fehlte und die Geldsteuern bei der ökonomischen Verfassung des Landes nicht prompt einzubringen waren. Die nach seinem Tode (1086) ausgesprochene Kanonisation und Einrichtung von Opfern wurde im 12. Jahrhundert wieder sistiert. Der Kern des Heeres bestand schon Ende des 11. Jahrhunderts wieder aus Soldtruppen. Die Schaffung des Fachbeamtentums wußten die dadurch in ihren Pfründeninteressen bedrohten Literaten: – deren Interessen waren die entscheidende Kraft in dem ganzen Kampf um die Reform! – zu hintertreiben, und auch die Kaiserinnen, deren Eunuchen durch eine solche Neuordnung in ihrem Machtinteresse sich gefährdet sahen, hatten von Anfang an gegen sie Stellung genommen182.
Wenn so die Reform Wang An Schi's im entscheidenden Punkt scheiterte, so scheint sie doch insofern tiefe Spuren zurückgelassen zu haben, als das chinesische »Selbstverwaltungssystem«, wie später zu erörtern sein wird, durch diese Rationalisierung der schon mehrfach erörterten Zehner- und Hunderterverbände seine noch heute nachwirkende Form behielt.
Tiefe Eingriffe der Regierung in die Grundbesitzverteilung hat es auch später noch mehrfach gegeben. 1263, im Kampf gegen die Mongolen, enteignete sie allen über eine bestimmte Besitzgrenze (»100 Mou«) hinausgehenden Bodenbesitz gegen Staatsschuldscheine, um Mittel zu beschaffen, und auch die folgenden Zeiten brachten gelegentlich starke Vermehrungen des unmittelbaren Staatsbesitzes durch Konfiskationen (in Tsche-kiang soll bei Antritt der Ming-Dynastie nur 1/15 des Bodens voller Privatbesitz gewesen sein). Das staatliche Magazinsystem (tsiun-schu) war an sich alt183 und spielte schon vor Wang-An-Schi's Plänen eine bedeutende Rolle. Seit dem 15. Jahrhundert etwa nahm es die Form an, die ihm dann blieb: der Ankauf im Herbst und Winter, Verkauf im Frühling und Sommer wurde zunehmend eine im Interesse der Erhaltung der inneren Ruhe vorgenommene preisregulierende Maßregel. Ursprünglich war der Ankauf kein freiwilliger, sondern wurde oktroyiert: der abzuliefernde Quotient der Ernte schwankte normalerweise um etwa 1/2 und wurde dann auf die Steuern verrechnet. Deren Höhe hat stark geschwankt: 1/15-1/10 des Ertrags, also eine sehr niedrige Quote, waren, sahen wir, unter den Han die Normalsätze, wobei immer zu bedenken ist, daß Fronden dazutraten. Die Entwicklung der Sätze im einzelnen interessiert hier schon deshalb nicht, weil sie aus eben diesem Grunde gar kein Bild der realen Belastung geben.
Als Resultat der wechselnden Bodenreformbestrebungen fiskalischen Charakters ist jedenfalls zweierlei anzusehen: die Nicht entstehung rationaler landwirtschaftlicher Großbetriebe und die tiefgehende mißtrauische Abneigung der gesamten Landbevölkerung gegen jede Art wie immer gearteten Eingriffs der Regierung in den Bodenbesitz und die Art der Bewirtschaftung: die laissez-faire Theorien zahlreicher chinesischer Kameralisten erfreuten sich bei der Landbevölkerung zunehmender Popularität. Konsum- und teuerungspolitische Maßregeln blieben selbstverständlich, als unvermeidlich, erhalten. Aber im übrigen fand nur die Bauern schutz politik der Regierung, weil gegen kapitalistische Akkumulation: Verwandlung von im Amt, im Handel, in der Steuerpacht akkumuliertem Besitz in Landvermögen gerichtet, Rückhalt an der Bevölkerung. Diese zum Teil schon vorstehend mitbesprochene Gesetzgebung ist durch diese Stimmung überhaupt erst ermöglicht worden und hat sich, aus eben diesem Grunde, sehr tiefe Eingriffe in den Besitzstand der Vermögenden gestatten dürfen. Hervorgegangen aus dem Kampf der autokratischen Regierung mit den Vasallen und den ursprünglich allein voll wehrfähigen vornehmen Sippen, hatte sie sich später stets erneut gegen die kapitalistisch bedingte Neubildung von Grundherrschaften zu wenden.
Die Art der Eingriffe hat dabei stark gewechselt, wie die bisherige Darstellung schon zeigte. In den Annalen wird für den Staat Tsin184, aus dem der »erste Kaiser« Schi Hoang Ti hervorging, für die Regierung Hiao Kongs (361-338) berichtet, daß der Literat Wei Yang, sein Minister, ihn als die »höchste Weisheit« gelehrt habe die Kunst: »wie man Herr seiner Vasallen wird«. Neben einer Reform der Steuerverfassung, vor allem: Ersatz der Landbestellungsfronden durch die allgemeine Grundsteuer, steht dabei die Zerteilung des Grundbesitzes im Vordergrund: Zwangsteilung der Familienkommunionen, Steuerprämien auf Familiengründung, Fronfreiheit bei intensiver Produktion, Familienregister und Beseitigung der Privatrache: alles typische Mittel des Kampfes gegen die Entstehung und Erhaltung von Grundherrschaften und zugleich Ausdruck des typischen populationistischen Fiskalismus. Die Gesetzgebung hat, sahen wir, geschwankt: abwechselnd lieferte die Regierung die landlosen Bauern durch Beschränkung der Freizügigkeit den Großgrundbesitzern aus oder ließ doch ihre Kommendierung in Hörigkeit geschehen, und befreite sie wieder. Aber im ganzen überwog die Tendenz zum Bauernschutz entschieden. 485 n. Chr. (unter der Wei-Dynastie) erlaubte sie offenbar aus populationistischen Gründen den Verkauf von überflüssigem Land. Bauernschutz bezweckte 653 n. Chr. das Verbot des Handels in Land und namentlich des Aufkaufs durch Wohlhabende, und 1205 n. Chr. das Verbot, Land zu verkaufen und als Höriger des Käufers auf dem Grundstück sitzen zu bleiben185. Die beiden letzten Bestimmungen lassen mit vollster Sicherheit erkennen, daß zur Zeit ihres Erlasses und – wie andere Nachrichten zeigen – sehr lange vorher ein faktisch veräußerliches Privateigentum an Boden bestand. Denn was hier verhindert werden sollte, war jene Entwicklung, welche an zahlreichen Stellen der ganzen Erde, vor allem in der althellenischen Polis, z.B. in Athen, eingetreten ist: daß im Handel oder aus politischen Quellen akkumulierte Geldvermögen Anlage im Grundbesitz suchten, die verschuldeten Bauern auskauften und als Schuldknechte oder hörige Pächter auf den zusammengekauften Parzellen verwendeten. – Doch genug dieser monotonen Wiederholungen, welche ja eine wirkliche »Wirtschaftsgeschichte« doch nicht bieten können. Die entscheidenden Daten (Preise, Löhne usw.) dafür fehlen bisher. Was aus allem hervorgeht, ist der lange Jahrhunderte, man darf sagen: 11/2 Jahrtausende lang, höchst prekäre Charakter der Bodenappropriation und die weitgehende, politisch-fiskalisch bedingte, zwischen willkürlichem Eingriff und völligem Gehenlassen schwankende Irrationalität des Bodenbesitzrechts. Eine Rechts kodifikation wurde von den Literaten mit der charakteristischen Begründung abgelehnt: daß das Volk die leitenden Klassen verachten werde, wenn es sein Recht kenne. Unter solchen Umständen war die Erhaltung der Sippe als Selbsthilfeverband der einzige Ausweg.
Das heutige Immobiliarrecht in China trägt daher neben scheinbar modernen Zügen die Spuren ältester Struktur an sich186. Die Katastrierung alles Landes und die – freilich stets wieder an der Obstruktion der Bevölkerung scheiternde – fiskalische Vorschrift, daß jede Verkaufsurkunde der (gebührenpflichtigen) Siegelung (schoei ki) durch die zuständige Staatsbehörde bedürfe und daß der Besitz dieser Erwerbstitel, Katasterauszüge und Quittungen über die Zahlung der Steuern als Eigentumsbeweis gelte, hat die Uebertragung des Bodens (durch bloße Urkundenbegebung) überaus erleichtert. Die in jeder Verkaufsurkunde (Mai Ki) enthaltene Klausel: daß der Besitz »infolge eines wirklichen Geldbedarfs für einen legalen Zweck« veräußert werde, ist heute eine leere Formel. Aber sie läßt – im Zusammenhang mit der erwähnten ausdrücklichen Bestimmung von 485 n. Chr. – mit Sicherheit darauf schließen, daß ursprünglich der Verkauf nur bei »echter Not« zulässig war, zumal ein heute ebenfalls rein formelhaftes, früher aber zweifellos obligatorisches Vorangebot an die Verwandten danebensteht, und vollends angesichts der noch heute als »Unsitte« bestehenden Gepflogenheit des Verkäufers und unter Umständen sogar seiner Nachfahren, bei eintretender Not durch tan ki (»billet de géminance«)187 vom Käufer eine oder mehrere Nachzahlungen als »Almosen« zu verlangen188. Der typische Landkäufer war eben hier wie in der alten Polis des Okzidents der reiche Geldbesitzer und Schuldherr, der Bodenbesitz aber war ursprünglich durch Retraktrechte sippengebunden. Die eigentlich nationale Form der Veräußerung war daher auch nicht der unbedingte Verkauf auf ewig, sondern teils der überall als Notgeschäft sich findende Verkauf unter Vorbehalt des Rückkaufs (hsiao mai), die Vererbpachtung (denn die Stellung eines Erbpächters nahm offenbar der tien-mien, der Eigentümer der Oberfläche, im Gegensatz zum tien ti, Eigentümer des Bodens, ein) und die Antichrese (tien-tang) bei ländlichen Grundstücken (die Hypothek, ti-ya, war nur bei städtischem Boden üblich).
Alle anderen Erscheinungen der Agrarverfassung weisen in die gleiche Richtung: den Kampf der alten Sippengebundenheit des Bodens mit der Geldmacht der Bodenaufkäufer und das temperierende, aber doch wesentlich fiskalisch interessierte Eingreifen der patrimonialpolitischen Gewalt. Die offizielle Terminologie schon des Schi-king und der Annalen der Han-Dynastie unterscheidet, ebenso wie das römische Recht, nur Privatbesitz und öffentlichen Besitz: Staatspächter auf dem Königsland, Steuerzahler auf dem Privatland (»Volksland«, mien ti). Von diesem blieb das unteilbare und unveräußerliche Ahnenland (die Grabstätten und das Land für die Unterhaltung der Ahnenopfer) Familieneigentum189; in den Rang des Erblassers sukzedierte der älteste Sohn der Hauptfrau und dessen Nachfahren; dagegen das Vermögen einschließlich des Bodens unterlag seit dem Siege des Patrimonialismus rechtlich der Naturalteilung unter alle Kinder, wobei Verfügungen des Erblassers nur als ethisch verpflichtend (als »Fideikommisse« in diesem eigentlichen Sinne des Begriffs) galten. Als Pachtformen fanden sich zuletzt Teilpacht, Natural-und Geldpacht nebeneinander, wobei der Pächter durch Leistung einer »Kaution« Unkündbarkeit erlangen konnte. Die üblichen Schemata von Pachtkontrakten über ländlichen Boden aber190 zeigen auf das deutlichste, daß der Pächter als ein »Colon« im Sinn des antiken und südeuropäischen Parzellenpachtverhältnisses zu denken war, welcher neben dem Recht auch die Verpflichtung zur Bebauung des Bodens übernahm und in aller Regel dem Verpächter verschuldet blieb. Als typischer Verpächter aber war – ganz entsprechend dem früher Gesagten – ein Bodenmagnat gedacht, der Streubesitz durch Verpachtung verwertete. Und zwar offenbar besonders oft die Familienkommunion einer Sippe, welche zahlreiche Landparzellen ererbt und erkauft hatte, die Erwerbsurkunden dieser Streugrundherrschaft in besonderen Akten und Inventarienbüchern verwahrte und registrierte191, im Kataster mit einem besonderen Kommunionsnamen192 wie unter einer Firma für alle Parzellen verzeichnet war193: dem gleichen Namen, der in der Familienhalle auf einer Tafel angeschlagen war. Durch ihren Aeltesten regierte sie die Kolonen ähnlich, auch dem Ton nach, patriarchalisch, wie ein antiker oder südeuropäischer Grundherr oder ein englischer Squire. Die großen alten Familien sowohl wie die durch Handel und politischen Erwerb reich gewordenen Parvenus hielten, wie überall, so auch hier ihr Vermögen fest in Kommunionen zusammen, um ihre Machtstellung erblich zu sichern. Es ist klar, daß dies die ökonomische Surrogatform für die vom Patrimonialismus gebrochene ständische Vorzugsstellung des alten Adels war.
Das bis in die Gegenwart in teilweise beachtenswertem (z.Z. leider nicht statistisch feststellbaren) Umfang194 bestehende Bodenmagnatentum war also nur zum Teil alten Datums, und es war ferner offenbar in starkem Umfang Streubesitz. Immerhin bestand es doch noch bis jetzt und vermutlich früher in noch höherem Grade, und mit ihm der in Patrimonialstaaten typische Kolonat. Aber auf die Macht der Grundherren sehr stark temperierend wirkten nun jene beiden China eigentümlichen Umstände ein: die bald näher zu besprechende Macht der Sippen auf der einen Seite, die Extensität und Ohnmacht der staatlichen Verwaltung und Justiz auf der anderen Seite. Der Grundherr, der seine Macht rücksichtslos gebrauchen wollte, hätte wenig Chance gehabt, durch eine prompte Justiz sein formales Recht durchgesetzt zu finden, außer wenn er über persönliche Verbindungen verfügte oder durch den immerhin kostspieligen Weg der Bestechung die Machtmittel der Verwaltung für sich in Bewegung setzte. Und auch dann mußte der staatliche Beamte ebensolche Rücksichten bei dem Versuch der Erpressung von Grundrenten für den Grundherren wie bei der Erpressung von Steuern für sich selbst nehmen. Alle Unruhen erregten, als Symptome drohender magischer Uebel, die Sorge der Zentralregierung und konnten ihm das Amt kosten. Höchst bezeichnende Gepflogenheiten der Verpächter und Vermieter zeigen, daß diese Lage für sie den Uebergang zu intensiver Ausnutzung ihrer Kolonen ausschloß. Die ungeheure Arbeitsintensität195 der Kleinbetriebe und deren ökonomische Ueberlegenheit trat in den gewaltigen Bodenpreisen196 und dem relativ niedrigen Zinssatz des landwirtschaftlichen Kredits197 greifbar zutage. Irgendwelche anderen technischen Verbesserungen waren bei der weitgehenden Parzellierung fast ausgeschlossen: die Tradition herrschte, trotz der weitgehenden Geldwirtschaft.
Der patrimonialistischen Bureaukratisierung entsprach also auch hier die Tendenz zur sozialen Nivellierung. Die Produktion blieb in der Landwirtschaft, der arbeitsintensiven Technik des Reisbaues entsprechend, fast ausschließlich kleinbäuerlich, im Gewerbe handwerksmäßig. Die Naturalteilung im Erbgang hatte den Grundbesitz auf die Dauer doch ziemlich stark demokratisiert, so sehr auch die Erbengemeinschaft im Einzelfall den Prozeß verlangsamte. Wenige Hektar Land galten als ein erheblicher Besitz, weniger als ein Hektar (15 Mou = 85 Ar) als auskömmlich bei nicht gartenmäßiger Bestellung für 5 Köpfe. Die feudalen Bestandteile der Sozialverfassung waren, wenigstens dem Recht nach, ihres ständischen Charakters entkleidet. Noch in den letzten Jahrzehnten sprachen amtliche Berichte zwar stets von »Notabeln« des Landes als der sozial ausschlaggebenden Schicht. Eine staatlich garantierte Stellung gegenüber den Unterschichten hatte aber diese ländliche »Gentry« der Dorfhonoratioren (s.u.) nicht. Sondern dem Recht nach stand über dem Kleinbürger und Kleinbauern unmittelbar der patrimonialbureaukratische Mechanismus. Es fehlte dem Recht und im wesentlichen auch der Sache nach die feudale Zwischenschicht des mittelalterlichen Okzidents.
Kapitalistische Abhängigkeitsverhältnisse okzidentalen Charakters andererseits brachte in typischen Formen erst die neueste Zeit unter europäischem Einfluß. Warum?