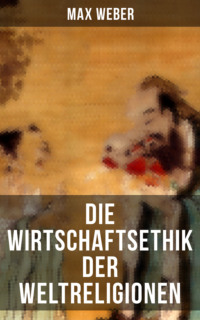Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 8
Jeglicher Eingriff irgendwelcher Art in die überkommene Wirtschafts- und Verwaltungsform griff in unabsehbar viele Sportelund Pfründeninteressen der ausschlaggebenden Schicht ein. Und da jeder Beamte einmal in die mit Verkürzung der Einnahmechancen bedrohte Stellung versetzt werden konnte, so stand die Beamtenschaft in solchen Fällen wie ein Mann zusammen und obstruierte mindestens ebenso stark wie die Steuerträger gegen den Versuch, Aenderungen des Sportel- oder Zoll- oder Steuersystems durchzuführen. Die okzidentale Art der dauernden Appropriation von Zoll-, Geleit-, Brücken- und Wegegeld-, Stapel- und Straßenzwang-, Sportel- und anderen Einnahmechancen machte dagegen die im Spiel befindlichen Interessen übersehbar und ermöglichte es in aller Regel, bestimmte Interessentengruppen zusammenzuschließen und mit Gewalt oder durch Kompromiß oder Privileg die einzelnen Verkehrsobstruktionen abzulösen. Aber davon war in China keine Rede. Diese Einnahmechancen waren ja dort, soweit die Interessen der obersten, ausschlaggebenden, Beamtenschicht in Betracht kamen, nicht individuell appropriiert, sondern: dem Stande dieser versetzbaren Beamten als Ganzem. Geschlossen stand er daher jedem Eingriff entgegen und verfolgte die einzelnen rationalistischen Ideologen, welche nach »Reform« riefen, solidarisch mit tödlichem Haß. Nur eine gewaltsame Revolution, sei es von unten, sei es von oben, hätte hier Wandel schaffen können. Die Beseitigung des Tributtransports auf dem Kaiserkanal mit Kähnen zugunsten des um ein Vielfaches billigeren Dampfertransports zur See, die Aenderung der überkommenen Arten der Zollerhebung, Personenbeförderung, Erledigung von Petitionen und Prozessen, alle und jede Neuerungen überhaupt konnten die Sportel??interessen jedes einzelnen, gegenwärtige oder künftig mögliche, gefährden. Wenn man etwa die Reihe der Reformprojekte des Kaisers aus dem Jahre 1898 überblickt und sich klar macht, welche ungeheuren Umwälzungen der Einkommensverhältnisse der Beamten sie bei auch nur teilweiser Durchführung herbeigeführt hätten, so kann man ermessen, welche ungeheuren materiellen Interessen gegen sie engagiert waren und wie völlig aussichtslos sie, in Ermangelung irgendwelcher außerhalb der Interessenten selbst stehenden Organe der Durchführung, sein mußten. In diesem Traditionalismus lag auch die Quelle des »Partikularismus« der Provinzen. Er war in erster Linie Finanzpartikularismus und dadurch bedingt, daß die Pfründen der Provinzialbeamten und ihres unoffiziellen Anhangs durch jede Zentralisierung der Verwaltung auf das schwerste gefährdet werden mußten. Hier lag das absolute Hemmnis einer Rationalisierung der Verwaltung des Reichs vom Zentrum aus ebenso wie einer einheitlichen Wirtschaftspolitik.
Es war aber ferner – und dies zu erkennen ist prinzipiell wichtig – das allgemeine Schicksal rein patrimonialer Staatsgebilde, wie die Mehrzahl der orientalischen es waren: daß gerade die Durchführung der Geld wirtschaft den Traditionalismus stärkte, statt ihn zu schwächen, wie wir erwarten würden. Deshalb, weil gerade erst sie durch ihre Pfründen jene Erwerbs chancen der ausschlaggebenden Schicht schuf, welche nicht nur den »Rentnergeist« im allgemeinen159 stärkten, sondern die Erhaltung der bestehenden, für den Gewinnertrag der Pfründen ausschlaggebenden wirtschaftlichen Bedingungen zu einem alles beherrschenden Interesse der daran partizipierenden Schicht machte. Gerade mit Fortschreiten der Geldwirtschaft und gleichmäßig damit zunehmender Verpfründung der Staatseinnahmen sehen wir deshalb in Aegypten, in den Islamstaaten und in China, nach kurzen Zwischenperioden, die nur dauerten, solange die Pfründenappropriation noch nicht vollzogen war, jene Erscheinung eintreten, welche man als »Erstarrung« zu werten pflegt. Es war daher eine allgemeine Folge des orientalischen Patrimonialismus und seiner Geldpfründen: daß regelmäßig nur militärische Eroberungen des Landes oder erfolgreiche Militär- oder religiöse Revolutionen das feste Gehäuse der Pfründnerinteressen sprengten, ganz neue Machtverteilungen und damit neue ökonomische Bedingungen schaffen konnten, jeder Versuch einer Neugestaltung von innen aber an jenen Widerständen scheiterte. Die große historische Ausnahme bildet, wie gesagt, der moderne europäische Okzident. Zunächst deshalb, weil er der Befriedung in einem einheitlichen Reich entbehrte. Wir erinnern uns, daß die gleiche Staatspfründnerschicht, welche im Weltreich die Rationalisierung der Verwaltung hemmte, dereinst in den Teilstaaten ihr mächtigster Förderer gewesen war. Aber der Anreiz war nun fortgefallen. Wie die Konkurrenz um den Markt die Rationalisierung der privatwirtschaftlichen Betriebe erzwang, so erzwang bei uns und in dem China der Teilstaatenzeit die Konkurrenz um die politische Macht die Rationalisierung der staatlichen Wirtschaft und Wirtschaftspolitik. Und wie andererseits in der Privatwirtschaft jede Kartellierung die rationale Kalkulation, die Seele der kapitalistischen Wirtschaft, abschwächt, so ließ das Aufhören der machtpolitischen Konkurrenz der Staaten miteinander die Rationalisierung des Verwaltungsbetriebs, der Finanzwirtschaft und der Wirtschaftspolitik kollabieren. Das Weltreich enthielt dazu keinen Antrieb mehr, wie er einst bei der Konkurrenz der Teilstaaten bestanden hatte. Aber dies war nicht der einzige Grund. Auch in der Epoche der Staatenkonkurrenz war in China die Rationalisierung der Verwaltung und Wirtschaft in engere Schranken gebannt als im Okzident. Deshalb, weil im Okzident – abgesehen von den schon erwähnten Unterschieden der Appropriation – starke, auf eigenen Füßen stehende Mächte vorhanden waren, mit welchen entweder die Fürstenmacht sich verbinden und die traditionellen Schranken zerbrechen konnte, oder welche, unter sehr besonderen Bedingungen, ihrerseits aus eigener militärischer Macht heraus die Bindungen durch die Patrimonialmacht abwerfen konnten, wie die fünf großen, für das Schicksal des Okzidents entscheidenden Revolutionen, die italienische des 12. und 13., die niederländische des 16., die englische des 17., die amerikanische und französische des 18. Jahrhunderts es getan haben. Gab es diese Mächte in China nicht? –
III. Soziologische Grundlagen. C. Verwaltung und Agrarverfassung.
Die ganz außerordentliche Entwicklung und Intensität des chinesischen Erwerbstriebs schon seit langer Zeit unterliegt nicht dem allergeringsten Zweifel. Seine Vehemenz und – soweit Nicht-Sippengenossen in Betracht kamen – Skrupellosigkeitwar, von den Ausnahmen der durch die Monopolgilden im Geschäftsinteresse ethisch stark temperierten Groß- und (besonders) Außenhändler abgesehen, jeder Konkurrenz anderer Völker gewachsen. Der Fleiß und die Arbeitsfähigkeit der Chinesen galt immer als unerreicht. Die Organisationen der Handelsinteressenten in ihren Gilden waren, sahen wir, so machtvoll wie in keinem Lande der Erde, ihre Autonomie faktisch fast unbeschränkt. Bei einer so riesigen Bevölkerungszunahme, wie sie China seit Anfang des 18. Jahrhunderts erlebte, in Verbindung mit stetiger Vermehrung der Edelmetallvorräte, müßte man nach europäischen Begriffen eine sehr günstige Chance für die Entwicklung von Kapitalismus annehmen. Immer wieder gelangen wir zu dem Problem zurück, welches an die Spitze dieser Erörterungen gestellt wurde. Einige Erklärungsgründe für die Tatsache, daß trotzdem die kapitalistische Entwicklung ausblieb, sind vorstehend schon beigebracht. Aber damit können wir uns noch nicht begnügen. – Die auffallendste und im schroffsten Gegensatz gegen den Okzident stehende Erscheinung in der Entwicklung Chinas ist: daß nicht, wie in England, eine (relative) Abnahme, sondern eine ungeheure Zunahme der ländlichen, bäuerlichen Bevölkerung die Epoche seit Beginn des 18. Jahrhunderts kennzeichnet, daß auch nicht, wie im deutschen Osten, landwirtschaftliche Großbetriebe, sondern bäuerliche Parzellenbetriebe zunehmend das Gesicht des Landes bestimmten, daß schließlich, damit zusammenhängend, der Rindviehstand ganz gering, das Schlachten von Rindern selten (eigentlich nur zu Opferzwecken) war, Milchgenuß fehlte und »Fleisch essen« soviel hieß wie »vornehm sein« (weil es Teilnahme am Opferfleischgenuß, der den Beamten zukam, bedeutete). Woher das Alles?
Die Entwicklung der chinesischen Agrarverfassung160 zu schildern wäre für den Nicht-Sinologen nach dem Stand der ihm zugänglichen Quellen durchaus unmöglich. Sie ist für unseren Zusammenhang auch nur soweit zu berücksichtigen, als sich in der Problematik der chinesischen Agrarpolitik die Eigenart des Staatswesens aussprach. Denn jedenfalls dies ist auf den ersten Blick unverkennbar: daß die tiefgehendsten Wandlungen der Agrarverfassung durch die Umgestaltung der Militär- und Fiskalpolitik der Regierung bedingt wurden. Die chinesische Agrargeschichte zeigt aus eben diesem Grunde ein monotones Hin und Her zwischen verschiedenen gleich möglichen Prinzipien der Besteuerung und der aus ihr folgenden Behandlung des Bodenbesitzes, die mit innerer »Entwicklung« keinerlei Verwandtschaft hat, seitdem der Feudalismus zerschlagen war.
Im Feudalzeitalter waren die Bauern zweifellos, mindestens zum Teil – wennschon keineswegs notwendiger- oder nur wahrscheinlicherweise alle161 –, Hintersassen der Feudalherren, denen sie Abgaben und zweifellos auch Dienste leisteten. Der von der Annalistik mit kien ping bezeichnete Zustand, daß sich die Bauern infolge kriegerischer Bedrohung und Unsicherheit oder infolge von Steuer- oder Darlehensüberschuldung um die Höfe der besitzenden Schichten »zusammengedrängt«, d.h. sich ihnen als Klienten (tien ke) kommendiert hatten, wurde von der Regierung in aller Regel scharf bekämpft. Man suchte die Immediatsteuerpflicht der Bauern aufrecht zu erhalten, vor allem aber das Aufkommen einer politisch gefährlichen Grundherrenkaste zu hindern. Immerhin bestand unter den Han nach ausdrücklichen Berichten162 mindestens zeitweise der Zustand: daß die Grundherren die Steuer für ihre Kolonen zahlten. Ebenso wie der Militärmonarch Schi Hoang Ti, suchte auch der Militär-»Usurpator« Wang Mang diese Stellung der Grundherren durch Einführung des kaiserlichen Bodenregals zu vernichten, – aber anscheinend vergeblich. Inwieweit es Anfänge einer Fronhofswirtschaft okzidentaler Art gegeben hat, wissen wir nicht. Doch ist es jedenfalls unwahrscheinlich, daß sie – soweit sie nachweisbar sein sollte – als typische Erscheinung anzusehen wäre, und erst recht: daß sie als Folge des Feudalismus zu gelten hätte. Denn die Art der rechtlichen Behandlung der Lehen macht es unsicher, ob sie die Grundlage für eigentliche Grundherrschaften okzidentalen Gepräges darstellen konnten. Die einem Nichtfachmann zugänglichen Quellen lassen auch nichts. Sicheres über die Art der Feldgemeinschaft erkennen und es muß zweifelhaft bleiben, ob und eventuell wie sie mit dem Feudalsystem – wie es in typischer Art der Fall zu sein pflegt163– im Zusammenhang stand oder vielmehr – wie so oft – fiskalischen Ursprungs war. Dies wäre an sich wohl möglich. Unter der Tang-Dynastie z.B. wurden 624 zu Steuerzwecken die Bauern nach kleinen Verwaltungsbezirken (hiang) gegliedert und innerhalb dieser ihnen bestimmte Besitzeinheiten garantiert und eventuell aus Staatsland zugewiesen164. Der Austritt und – in diesem Fall – der Verkauf des Landes war zwar gestattet, setzte aber den Einkauf in eine andere Steuergemeinschaft voraus. Bei dieser nur relativen Geschlossenheit der Grundbesitzerverbände ist es aber ganz unzweifelhaft oft nicht geblieben. Die höchst radikalen Umgruppierungen der Bevölkerung in solidarisch haftende Steuer-, Fron- und Aushebungs-Verbände läßt es als ganz sicher erscheinen, daß die, von der Annalistik auch ausdrücklich erwähnte, Pflicht zur Bodenbestellung (im fiskalischen Interesse) stets erneut als das Primäre, das entsprechende »Recht« auf Land als das daraus Abgeleitete galt. Es scheint nun aber nicht, daß daraus eine, sei es den germanischen, sei es den russischen, sei es den indischen Verhältnissen entsprechende Kommunionwirtschaft der Dörfer entstanden ist. Die Existenz von Dorfallmenden im Sinn der okzidentalen Verhältnisse kann nur als eine Erscheinung der fernen Vergangenheit aus gelegentlichen Andeutungen erschlossen werden. Die kaiserlichen Steuerordnungen machen nämlich nicht das Dorf, sondern die Familie und deren arbeitsfähige (ting) Mitglieder (gerechnet meist vom 15.-56. Jahre) zur Steuereinheit und schlossen, spätestens seit dem 11. Jahrhundert unsrer Zeitrechnung – wahrscheinlich aber schon lange vorher – diese zu jenen künstlichen Haftungsverbänden zusammen. Daß das Dorf gleichwohl einen Verband mit weitestgehender Selbstverwaltung darstellte, wird noch zu besprechen sein. Hier interessiert zunächst die angesichts jener scharfen fiskalischen Eingriffe keineswegs selbstverständliche Tatsache, daß ein anderer, ursprünglich vielleicht auf die Vornehmen beschränkter165, Verband seit einer für uns nicht greifbaren Vorzeit die Gesamtheit der (als vollwertig angesehenen) Landbevölkerung in sich umschloß und durch diese Fiskalmaßregeln nicht zerstört worden ist.
Denn was sich mit Sicherheit erkennen läßt, ist der durch alle Jahrtausende ungebrochen fortbestehende Zusammenhalt der Sippe und die überragende Stellung des Sippenhaupts. Die ältere Grundherrschaft dürfte in China von da aus entstanden sein. Auf die Sippen waren – wie bemerkt – ursprünglich die Militärleistungen und, vermutlich, alle öffentlichen Lasten überhaupt repartiert und das Sippenhaupt haftete folglich – nach allen Analogien und auch nach Rückschlüssen aus den späteren Veränderungen – für die Repartierung und Ableistung. Nach Durchführung der Privateigentumsordnung, d.h. der formellen Appropriation des Bodens (oder: seiner Nutzung) an die Einzelfamilien hören wir gelegentlich, daß das Sippenhaupt in dieser Funktion durch die vermögendsten Grundbesitzer ersetzt wurde (nach der Tradition 1055), daß also der mit der Repartierung der auf dem Boden ruhenden Lasten betraute, deshalb mit Autorität bekleidete und in den Chancen, Besitz zu akkumulieren, bevorzugte »Senior« sich in einen Grundherren und die verarmten Sippengenossen in seine Hintersassen verwandelt haben, – eine Erscheinung, die bekanntlich zahlreiche Parallelen hat166. Inwieweit es neben den Sippengenossen – wie überall einer Oberschicht, die ihrerseits das Monopol des Boden- und Sklavenbesitzes zu beanspruchen pflegt167 – von jeher eine Schicht sippe nloser Höriger gegeben hat, ist für den Nichtfachmann nicht entscheidbar. Daß es Hörige gab und daß ihnen ursprünglich ein sehr großer Teil, wohl der weitaus größte, der Bauernschaft angehörte, steht fest. Der Besitz von Hörigen war im 4. Jahrhundert vor Chr. nur den (damals amtsfähigen) Kuan-Familien gestattet; die Hörigen zahlten weder ko (Grundsteuer) noch leisteten sie ju (Fronden), sondern wurden, offenbar, durch ihre Herren versteuert, so weit diese nicht Immunität erworben hatten. Einzelne Familien besaßen nach der Annalistik »bis zu 40« davon, was immerhin auf einen nur bescheidenen Umfang der damaligen Grund- und Leibherrschaften schließen läßt. Sklaverei hat es in China zu allen Zeiten gegeben. Ihre ökonomische Bedeutung aber scheint nur in den Zeiten der Akkumulation großer Geldvermögen durch Handel und Staatslieferungen: als Schuldsklaverei oder Schuldhörigkeit, wirklich erheblich gewesen zu sein, – wovon bald zu reden sein wird.
Die entscheidenden Wandlungen der Agrarverfassung gingen anscheinend stets von der Regierung aus und hingen mit der Regelung der Militär- und Abgabenpflicht zusammen. Von dem »ersten Kaiser« (Schi Hoang Ti) wird berichtet, daß er eine allgemeine Entwaffnung des Landes durchgeführt habe. Zweifellos richtete sich diese in erster Linie gegen die Streitkräfte der von ihm radikal unterdrückten Feudalherren168. Gleichzeitig wurde – was in China seitdem sich noch öfter wiederholt hat – das »Privateigentum« durchgeführt. Das heißt: es wurde der Boden den Bauernfamilien (welchen? ist wohl kaum feststellbar) unter Befreiung von den (welchen?) bisherigen Lasten appropriiert und die neuen Staatslasten ihnen unmittelbar auferlegt. Diese Staatslasten waren teils Abgaben, teils Fronden, teils Rekrutengestellungen für das patrimonialfürstliche Heer des Kaisers. Und für die folgende Entwicklung war offensichtlich entscheidend: in welchem relativen Umfang auf die Wehrkraft, in welchem auf die Fronleistungspflicht und in welchem auf die Steuerfähigkeit der Bauern reflektiert war, ob mehr Natural- oder mehr Geldsteuern bestanden, ob – im Zusammenhang damit – das Heer aus zum Dienst gepreßten Untertanen oder aus Söldnern zusammengesetzt war, und schließlich: welche technischen Mittel die Verwaltung schuf, um die Ableistung der – je nachdem verschieden gearteten – Lasten zu sichern169. Alle diese Komponenten nun haben gewechselt und die durch die ganze chinesische Literatur sich hinziehenden Gegensätze der Literatenschulen sind zum nicht unerheblichen Teil mit an diesen verwaltungstechnischen Problemen verankert gewesen. Sie haben sich daher namentlich in der Zeit des drohenden Mongolensturms, seit dem Anfang des 11. Jahrhunderts unserer Aera, besonders stark zugespitzt. Ein zentrales Problem aller damaligen Sozialreformer war immer (ganz ebenso wie bei den Gracchen) die Erhaltung oder Neuschaffung eines gegen die Nordwest-Barbaren hinlänglich schlagkräftigen Heeres und der dafür erforderlichen Finanzmittel, in Geld oder: Naturalleistungen. Das typische, wiederum keineswegs China allein eigentümliche, Mittel zur Sicherung der – in ihrer Art wechselnden – Leistungen der Bauern war die Bildung von solidarisch haftenden Zwangsverbänden (von je 5 oder 10 Familien, die ihrerseits wieder zu Verbänden zusammengeschlossen wurden) und von Leistungsklassen der Bodenbesitzer, je nach dem Besitz verschieden (z.B. in 5 Klassen) abgestuft. Ferner aber immer wieder der Versuch, um die Zahl der prästationsfähigen Bauern zu erhalten und zu vermehren, also: die Besitzakkumulation und die Entstehung von unbebauten oder extensiv bebauten Ländern zu verhindern: Besitzmaxima zu schaffen, das Bodenbesitzrecht an die effektive Bebauung zu knüpfen, Siedelungsland zu erschließen und eventuell Landumteilungen herbeizuführen auf der Basis eines auf die einzelne bäuerliche Arbeitskraft entfallenden durchschnittlichen Bodenbesitzanteils, der also etwa dem russischen »Nadjel« entsprochen hätte.
Die chinesische Steuerverwaltung stand schon durch ihre überaus ungenügend entwickelte Maßtechnik vor erheblichen Schwierigkeiten sowohl bei diesen wie bei allen Kataster-Problemen. Das einzige eigentlich wissenschaftlich »geometrische« Werk170, im wesentlichen den Hindus entlehnt, scheint erkennen zu lassen, daß nicht nur trigonometrische Vermessungen nach dem Stande der Kenntnisse ausgeschlossen waren, sondern daß auch die Vermessung der einzelnen Ackerstücke kaum die altgermanische, gar nicht aber die wahrlich primitive Technik der römischen Agrimensoren erreichte. Erstaunliche Vermessungsirrtümer – ebenso erstaunlich wie die Rechenfehler der mittelalterlichen Bankiers – scheinen alltäglich gewesen zu sein. Die Maßeinheit: der chinesische »Fuß« blieb trotz Schi Hoang Ti's Reform offenbar provinziell verschieden, der kaiserliche Fuß (= 320 mm) meist der größte; Schwankungen zwischen 255, 306, 315, 318, 328 mm finden sich. Das grundlegende Landmaß war das mou, in der Theorie ein langer Landstreifen von ursprünglich 100, später 240 x 1 pu = bald 5 bald 6 Fuß, im letzteren Fall also bei Zugrundelegung des Fußes von 306 mm = 5,62 Ar, wovon 100 auf ein king (= 5 Hektar 62 Ar) gingen. Unter den Han galten 12 mou, von denen jedes 11/2 schi Reis produzierte, als – russisch ausgedrückt – nötiger »Seelen-Nadjel« für jedes Individuum. Die ältesten Notizen scheinen zu behaupten, daß in der Zeit vor Wen Wang (12. Jahrhundert vor Chr.) 50 mou (zu, damals, 3,24 Ar) auf ein Individuum gerechnet worden seien, wovon damals ein Zehntel, also 5, als Kong tien (Königsland) für den Fiskus bestellt wurden, so daß also für jedes Individuum ein Besitz von 2,916 Hektar als normal gegolten hätte. Auf diese Notiz ist indessen gar kein Verlaß171. Man rechnete noch ein Jahrtausend und mehr später normalerweise immer wieder nicht nach Bodeneinheiten, sondern nach Familien, und klassifizierte eventuell diese – wie schon gesagt – nach der Zahl der zu ihnen gehörigen »ting«, der arbeits fähigen Individuen172. Den Boden aber klassifizierte man in höchst roher Form entweder einfach in »schwarzen« und »roten« Boden, also (dürfen wir wohl als sicher annehmen:) in bewässertes und unbewässertes Land. Das ergab zwei Steuerklassen. Oder nach dem Maße der Brache in 1. bracheloses (also: bewässertes), 2. Dreifelder- und 3. Feldgraswirtschaftsland. Vom ersteren rechnete man – in den ältesten zugänglichen Notizen – 100 Mou (5,62 Hektar), vom zweiten 200 (11,24 Hektar), vom dritten 300 (16,86 Hektar) als Normallandanteil einer Familie. Auch das entspräche einer Einheitssteuer auf die Familie, nicht auf die Bodeneinheit. Die Verschiedenheit der Größe und der Altersgliederung der Familie führte dabei gelegentlich zu dem Gedanken, große Einheiten auf guten, kleinere auf schlechten Boden zu setzen. Inwieweit dies praktisch wurde, ist natürlich sehr fraglich. Umsiedelungen der Bevölkerung hatten zwar immer als leicht anwendbares Mittel der Ausgleichung des Ernährungsstandes und der Steuer- und Fronfähigkeit gegolten. Aber diese Möglichkeit hätte doch schwerlich der ganzen regulären Steuerveranlagung zugrunde gelegt werden können. Oder man schied die Familien nach dem Inventar: spannfähige und nicht spannfähige (5. Jahrhundert nach Chr.). Dieses Personalsteuer-(tsu-)System wechselte aber immer wieder mit reinen Grundsteuer-(tu-)Systemen verschiedener Art ab. Entweder Naturalquotensteuern. So schon nach dem Vorschlag des Ministers Tschang yang (360 vor Chr.), im Staat Tsin in sehr bedeutender Höhe (1/3 – 1/2des Rohproduktes angeblich), – was für die Stärke der Herrschergewalt und für die Ohnmacht der Bauern dort spricht. Trotz dieser Höhe aber, nach der Annalistik, mit der Folge, daß die Bebauung des Bodens sich, infolge des Eigeninteresses am Anbau, hob. Später regelmäßig mit weit geringeren Quoten (ein Zehntel bis ein Fünfzehntel) Oder: feste Naturalabgaben je nach Bodengüte. So anscheinend unter Tschang ti (78 vor Chr.) und (anscheinend) wieder im 4. Jahrhundert nach Chr., jedesmal unter einer ziemlich rohen Klassifikation des Bodens. Oder endlich: Geldsteuern. So 766 nach Chr. (15 tsien vom mou). Der unbefriedigende Ertrag nötigte dabei dazu, 780 die Leistung in Naturalien unter Abschätzung des Geldwertes durch die Steuerbehörden zu gestatten, – eine Quelle endloser Mißbräuche. Immer wieder wurde, nachdem die Versuche der staatlichen Geldfinanzwirtschaft immer erneut zusammengebrochen waren, auf diese Experimente zurückgekommen und zwar ganz offenbar um militärisch wirklich brauchbare, und das hieß: Sold heere halten zu können. Die Form wechselte. So 930 unter dem Usurpator Heu tung: die als Steuer erhobenen Naturalien wurden den Steuerpflichtigen »zurückverkauft«, man kann sich denken: mit welchem Ergebnis. Entscheidend war das Fehlen einer verläßlichen Steuerbureaukratie, die zuerst 960 von der Sung-Dynastie zu schaffen versucht wurde. Aber die Denkschrift Pao tschi's von 987 schilderte die Massenflucht der Steuerpflichtigen in düsteren Farben und der Versuch Wang An Schi's (1072) unter dem Kaiser Schin Tsong, eine universelle Katastrierung durchzuführen, kam nicht zu Ende: etwa 70 % des Landes war bei Ende seines Regiments untarifiert und das Budget von 1077173 zeigt zwar eine Zunahme der Geldeinnahmen auf Kosten der Naturaleinnahmen, ist aber sehr weit von einem auch nur überwiegenden Geldbudget entfernt. Die Papiergeldwirtschaft hat im 13. Jahrhundert ebenso wie schon die Münzentwertung unter Tschang ti (1. Jahrhundert vor Chr.) immer wieder den Kollaps in die Naturalsteuerwirtschaft zur Folge gehabt, und erst unter den Ming steht neben einer sehr bedeutenden Getreideeinnahme und einer (relativ) mäßigen Seidenmenge ein bedeutender Betrag von Silber. Die Befriedung des Reichs unter den Mandschus – zum Teil eine Folge der Domestikation der Mongolen durch den Buddhismus – hat im Verein mit der Steuerkontingentierung von 1712/13 die Steuer auf einen mäßigen und festen Betrag sinken lassen (etwa 1/10 des Produkts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) und die letzten Reste der »Pflicht zum Lande« und der Beaufsichtigung der Bodenbestellung beseitigt. Kaiserliche Edikte der letzten Jahrzehnte verboten die Haftbarmachung der Zehntschaftsobmänner für die Lasten174.
Aber in den beiden Jahrtausenden seit Schi Hoangti waren die Bodenbestellungspflicht aller »ting«, d.h. aller Arbeitsfähigen, und daher auch Fronpflichtigen, und die Fron- und Steuerhaftungsgemeinschaften der Sippen und der aus ihnen gebildeten Zehnschaften, das Bodenbesitzmaximum und das Recht der Umsiedelung immerhin nicht bloße Theorie, sondern gelegentlich recht fühlbare Realitäten gewesen. Soweit die Steuer und die Fronlasten auf die Familien umgelegt wurden175 – und dies war, sahen wir, tatsächlich immer wieder der Fall, weil die Schaffung eines Bodenkatasters überaus schwierig schien – begünstigte, ja erzwang der Fiskus mit aller Macht Familien teilungen, um die Zahl der Pflichtigen nach Möglichkeit zu erhöhen. Auf die Entstehung der für China typischen Zwerg betriebe dürfte das von erheblichem Einfluß gewesen sein. Aber sozial angesehen, hatte die Wirkung ihre feste Grenze.
Alle diese Maßregeln hemmten zwar die Entstehung von größeren Betriebs einheiten. Aber sie förderten – dem tatsächlichen Ergebnis nach – das Zusammenhalten der altbäuerlichen Sippen als Träger des Bodeneigentums (oder, soweit ein Bodenregal in Anspruch genommen wurde, des Bodennutzungsrechts): die Sippen176 waren die tatsächlichen Kaders für die Haftungsverbände177. Alle Versuche, wirkliche Besitzgleichheit im Sinne des Nadjel-Prinzips zu schaffen, scheiterten immer aufs neue an den völlig unzulänglichen Verwaltungsmitteln. Und die letztlich rein fiskalisch motivierten »staatssozialistischen« Experimente des 11. Jahrhunderts und einzelner späterer Herrscher hinterließen offensichtlich nur eine intensive Abneigung gegen alle und jede Intervention der zentralistischen politischen Gewalten, in der sich die lokalen Amtspfründner mit allen Bevölkerungsschichten zusammenfanden. Das entscheidende Verlangen der Zentralregierung (z.B. im 10. Jahrhundert): daß nicht feste Pauschalien, sondern alle Ueberschüsse der Auflagen (Fronden und Steuern) über den Lokalbedarf zu ihrer Verfügung zu stehen hätten, ist nur durch ungewöhnlich energische Kaiser zeitweise effektiv durchgeführt worden, kollabierte immer wieder und wurde – wie erwähnt – unter den Mandschus schließlich aufgegeben. – Wenigstens einige Seiten dieser fiskalischen Agrarpolitik mögen im Anschluß an das Gesagte noch herausgehoben werden, um das Bild zu vervollständigen.
Eine Sonderstellung innerhalb der Agrarverfassung nahm zunächst die für den Eigenbedarf des Hofs, aber auch für den Außenhandel wichtige Seiden zucht, dann die »nasse« (bewässerte) Reis kultur ein. Die erstere – ein sehr alter Zweig der Gartenkultur und hausgewerblichen Arbeit – wurde in Verbindung mit Obstpflanzungen nach der Annalistik im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung den bäuerlichen Haushaltungen in bestimmtem Verhältnis zum Landanteil oktroyiert. Die letztere aber dürfte die reale oder doch die ursprüngliche Grundlage des sog. »Brunnen«-Systems sein, welches bei chinesischen Autoren eine Art von Klassizität als eigentlich nationales Landteilungssystem genoß178: ein durch Drittelung der Seiten eines Quadrats in 9 Teile zerlegtes Feld, dessen mittelster Teil von den 8 Umliegern für den Fiskus (eventuell: den Grundherren) zu bestellen war. An eine irgendwie universelle Verbreitung ist gar nicht zu denken, – sie stände, abgesehen von der inneren Unwahrscheinlichkeit, mit den annalistisch feststellbaren Daten über die Schicksale des Bodenrechts im Widerspruch. »Abschaffung« des Brunnensystems (so z.B. unter den Tsin im 4. Jahrhundert n. Chr.) – diese wohl identisch mit Ersatz des Systems des »Königsfeldes« überhaupt durch Abgaben – und (zugestandenermaßen erfolglose) »Wiedereinführung« desselben wechselten ab. Fest steht wohl, daß es nur lokal: zweifellos wesentlich bei Bewässerung von Reisfeldern, bestand, allenfalls von da gelegentlich auf Ackerland übertragen worden ist. Jedenfalls war es historisch nicht die agrarische Grundinstitution Chinas, wie zuweilen früher angenommen wurde, sondern eben nur eine auf die nasse Reiskultur gelegentlich angewendete Form des alten Kong-tien-(Königsland-)Prinzips.
Rechtlich nahmen in allem Wechsel der Agrarverfassung die immer wieder geschaffenen lebenslänglichen, aber den Nachkommen im Fall der Eignung und Uebernahme der Pflichten regelmäßig wiederverliehe nen Apanagen- und Lehengüter eine Sonderstellung ein. Teils waren sie offensichtlich Pfründen, welche den Unterhalt der Bewidmeten als Krieger decken sollten: daher die Bestimmung, daß der Betreffende mit 60 Jahren ins Altenteil zu gehen habe (wie beim japanischen inkyo). Diese Militärlehen treten – nach Klassen der Krieger abgestuft – besonders seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. und in der Zeit vom 7.-9. Jahrhundert auf und haben bis in die Ming-Dynastie ihre Rolle gespielt. Erst die Mandschus haben sie verfallen lassen oder vielmehr durch ihre eigenen »Bannerlehen« ersetzt. Ebenso hat es in den verschiedensten Epochen Dienstland für Beamte (statt der Deputate, besonders bei Verfall des Magazinsystems, der Grundlage der Naturaldeputate) gegeben. Teils waren sie plebejische Kleinlehen, belastet mit Leiturgien aller Art (Wasser-, Wege-, Brückenfronden, ganz wie in der Antike: lex agraria von 111, und mehrfach im Mittelalter). Solche Besitzstände sind noch im 18. Jahrhundert neu begründet worden179.
Im übrigen lassen sich, nach der sog. Schaffung des »Privateigentums« (Schi Hoang Ti), die verschiedensten Wandlungen der Bodenverteilung feststellen. Zeiten starker innerer Unruhen sahen, wie erwähnt, stets das Entstehen großer Grundherrschaften, als Folge von freiwilligen Kommendierungen, Vergewaltigungen und Auskauf verarmter und wehrloser Bauern. Der Gedanke einer Maximalgrenze des Besitzes führte natürlich immer wieder zur Fesselung der Bauern an ihre Scholle oder vielmehr: an die Haftungsverbände. Formell führten diese wesentlich nur fronfiskalisch bedingten Eingriffe unter der östlichen Tsin-Dynastie (nach einigen älteren Anfängen) im 4. Jahrhundert zuerst zur Erklärung des staatlichen Bodenregals. Es ist aus den Nachrichten offensichtlich, daß eine entscheidende Absicht auch dabei die Ermöglichung universeller Fronregulierung war. Der erwähnte Gedanke des gleichen »Seelen«-Anteils (für jeden im Alter von 15-60 Jahren Stehenden) mit – in der Theorie! – jährlicher Neuumteilung trat in den Teilreichen des 3. Jahrhunderts, – nachdem das ziemlich rohe System der Kombination von Kopfsteuer (von jeder ting-Seele) und Bodenbesitzsteuer (zunächst einfach: von jedem Hof) zu ganz unbefriedigenden Ergebnissen geführt hatte –, 485 n. Chr. und erneut unter den Tang (7. Jahrh.) auf und wurde (in der Theorie) mehrfach »sozialpolitisch« abgewandelt (Fürsorge für gesondert wohnende Alte, Kriegsverletzte und ähnliche Personenkategorien). Erblicher und nach Art etwa von badischen Allmendäckern wechselnder oder durch Rang bedingter Besitz konnten dabei in verschiedener Weise miteinander verbunden werden. 624 z.B. wurde im Tang-Staat ein bestimmtes Grundmaß als erblicher Besitz für jeden Hof zugelassen und je nach der Seelenzahl ein Landzuschlag gestattet. Von der so geschaffenen Steuereinheit wurden Kornabgaben und Fronden teils kumulativ, teils alternativ erhoben. Anfang des 11. Jahrhunderts wurde der zulässige Bodenbesitz nach dem Rang abgestuft. Bei Landmangel war Uebersiedelung gestattet: es war damals viel Siedelungsland im Norden vorhanden und dies erklärt wohl die wenigstens zeitweise Möglichkeit einer Durchführung. Im Fall der Uebersiedelung oder des Landüberschusses über die Norm sollte freihändiger Verkauf, sonst nur im Fall »echter Not« (Fehlen der Mittel zur Beerdigung) nach Vorangebot an die Sippe gestattet sein. Tatsächlich aber herrschte alsbald wieder ein sehr freier Bodenverkehr und mißlang der Versuch, Besitzgleichheit herzustellen, besonders nachdem das neue Steuersystem von 780 das Interesse der Verwaltung an der Militär- und Fronprästationsfähigkeit wieder abgeschwächt hatte. Mit den fiskalischen und militärischen Bedürfnissen hingen eben, wie wir sahen, all diese Maßregeln zusammen. Nach dem Scheitern des Bodenbesitzausgleichs begnügte sich die Verwaltung mit Eingriffen in die Pachtrentenbildung im Interesse des Bauernschutzes. Auch mußte das Verbot, Fronden, besonders Kurier- und Vorspanndienste, für privaten Nutzen zu beanspruchen, mehrfach eingeschärft werden (10. Jahrh.). Die Beamten, welche vom Frondienst befreit waren, nutzten diese Möglichkeit zur Bereicherung und Akkumulation von Boden, weshalb 1022 für sie speziell ein Bodenbesitzmaximum festgesetzt wurde. Der außerordentlich prekäre Charakter des Bodenbesitzes gegenüber allen diesen Eingriffen und die leiturgischen Vorbelastungen des Besitzes hinderten – nach der Annalistik – in hohem Maße jede Bodenmelioration. Der Leiturgiestaat drohte immer wieder finanziell und militärisch zu versagen, und diese Schwierigkeiten waren es, welche für die zahlreichen Bodenreformversuche den Anlaß und die richtunggebenden Interessen schufen. Dafür war der berühmte Reformversuch Wang-An-Shi's im 11. Jahrhundert ein Beispiel, der primär durchaus militärfiskalisch orientiert war. Sehen wir uns seine Bedingtheit etwas an.
Zur Geschichte der Agrarverfassung im Zusammenhang mit dem Fiskalsystem: N. J. Kochanowskij, Semljewladjenie i semljedjelje w Kitaje (Wladiwostok 1909, in den Iswjestija Wostotschnawo Instituta d. g. isd. 1907/8 tom. XXIII w. 2) und A. J. Iwanoff, Wang-An-Schi i jewo reformy (S. Petersburg 1906). Leider war mir die sonstige russische Literatur nicht zugänglich. (Auch A. M. Fielde, Land Tenure in China, Journal of the China Branch of the R. Asiat. Soc. 1888 vol. 23 p. 110 konnte ich mir – ebenso wie fast alle Publikationen dieser Zeitschrift – zurzeit nicht zugänglich machen.) – Einige andere Literatur weiterhin.