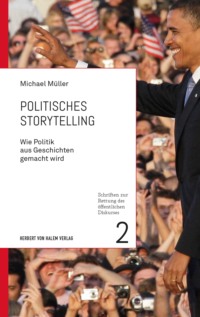Kitabı oku: «Politisches Storytelling», sayfa 3
Erzählt wird, was Sinn macht
Grundsätzlich kann man sagen, dass die narrative Struktur die Form ist, wie wir Menschen Veränderungen und Entwicklungen denken, und wie wir damit Sinn in unserem Leben schöpfen, indem wir uns selbst (und anderen) erzählen, ›wie wir geworden sind, was wir heute sind‹. Mit solchen autobiografischen Erzählungen erklären wir, welchen Sinn unsere derzeitige Situation macht – oder inwiefern dieser Sinn fehlt, wenn wir zum Beispiel keine kausale Kohärenz der einzelnen ›Snapshots‹ unserer Erlebnisse und Erfahrungen herstellen können. Diese Bedeutung narrativer Strukturen für das Erleben von Sinn, Kohärenz und Identität hat die Psychologie in der Folge eines »narrative turn« seit den 1980er-Jahren begonnen, zu erforschen. »In Geschichten geht es nämlich immer darum, wie Protagonisten die Dinge interpretieren, was die Dinge für sie bedeuten.« (BRUNER 1997: 68; vgl. auch SARBIN 1986; LÁSZLÓ 2008).
Wir alle machen unseren Sinn meist selbst, im Kleinen wie im Großen. Und die Form, in der wir das tun, ist narrativ. Wenn wir irgendetwas Ungewöhnliches wahrnehmen, beginnen wir in der Regel unwillkürlich, zu rätseln, was wohl dahinterstecken mag. Ein Mann, der mir an einer Kreuzung entgegenkommt, hat Blutergüsse und Wunden im Gesicht. Was ist geschehen? Hatte er einen Autounfall? Oder war er in eine Schlägerei verwickelt? Ist er ein Mitglied der Unterwelt und in einen Machtkampf verschiedener Gangs geraten? Ja nachdem, wie stark unsere Fantasie ausgeprägt ist, und wie viel Muße wir haben, dieses Garn weiterzuspinnen: Wir versuchen, einer ungewöhnlichen, nicht alltäglichen Beobachtung Sinn zu geben, indem wir uns eine Geschichte zusammenreimen, wie das Phänomen entstanden sein könnte. In der Ferne hören und sehen wir zehn, zwölf Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn vorbeifahren. Ist da ein großer Unfall passiert? Oder gar ein Terroranschlag? Ein Amoklauf? Und je stärker wir uns in diese Geschichten hineinfantasieren – und dabei auch Blaupausen aus Medien und früheren Erlebnissen nutzen –, desto mehr reagieren wir auch emotional, bekommen Angst, ja vielleicht sogar Panik. Sie bemerken, dass Ihre Nachbarin seit einiger Zeit schlecht aussieht. Ist sie krank? Oder führt sie ein ausschweifendes Leben? Oder hat sie nur Stress im Beruf? Ja, Sie erinnern sich: Sie hat vor ein paar Monaten einmal erwähnt, dass sie einen sehr unangenehmen neuen Chef hat. Und so weiter. Den ganzen Tag ›machen wir Sinn‹ (ein produktiver Anglizismus) aus unseren Beobachtungen und Sinneswahrnehmungen – und zwar, indem wir die dahintersteckenden Geschichten zu entschlüsseln versuchen. Auch aus unserem eigenen Leben machen wir Sinn, indem wir unsere Erlebnisse, die Ereignisse, an denen wir beteiligt waren, in eine narrative Struktur bringen. In der Psychologie weiß man, dass Identität und die dazugehörige Autobiografie narrativ strukturiert sind (vgl. BRUNER 1997; KRAUS 2000; ABELS 2010; KEUPP et al. 2008). Einen Sinn im eigenen Leben zu erfahren oder nicht, hängt letztlich davon ab, wie gut es uns gelingt, eine befriedigende narrative Struktur über die Ereignisse unseres Lebens zu legen. Dieses autobiografische Narrativ ist nicht ein für alle Male festgelegt, sondern kann auch verändert werden; die sogenannte narrative Therapie nutzt dies, um andere Erlebnisse, andere Erfahrungen in unser autobiografisches Identitäts-Narrativ einzubinden (vgl. WHITE 2010).
Dies ist die positive Seite der Veränderbarkeit unserer Sinn- und Identitäts-Narrative. Die negative Seite ist, dass wir es uns gerne leicht machen, wenn es darum geht, Ursachen vor allem für Umstände zu suchen, die verhindern, dass wir so leben können, wie wir leben wollen. Dann nehmen wir billige Erklärungen an, die uns angeboten werden, finden Sündenböcke, damit wir nicht an uns selbst etwas ändern müssen. Dann sind die vielen Ausländer Schuld daran, dass ich arbeitslos bin, oder die ›Kapitalisten‹, dass ich meinen Lebenstraum nicht verwirklichen konnte.
Narrative Gebiete von Gesellschaften
Bisher habe ich hauptsächlich von Sinn und Identität gesprochen; das sind jedoch nur zwei der Aspekte von Gesellschaften oder anderen Gemeinschaften, die durch Geschichten und Narrative bestimmt werden. Weitere drei wichtige – ohne hier einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben – sind Werte, Wissen und Kommunikation (vgl. dazu auch ERLACH/MÜLLER 2020). Bevor wir uns näher mit dem ›Wie‹ des politischen Storytelling befassen, hier noch ein Überblick über die Gebiete und Regionen des politischen Storytelling:
Sinn: Zu der Funktion von Geschichten und Narrativen bei der Konstruktion von gemeinsamem Sinn habe ich ja schon einiges gesagt. Nur noch so viel: Eine lebendige und demokratische Gesellschaft ist eine, in der es mehrere, sogar viele teils konkurrierende, teils kompatible Sinn-Narrative gibt, für die sich Menschen entscheiden können, ohne Verfolgungen befürchten zu müssen. Das nennt man allgemein ›Pluralismus‹. Autoritäre und starre Gesellschaften bieten nur sehr wenige oder sogar nur ein Sinn-Narrativ an, das man nur mit Gefahr nicht akzeptieren kann – zumindest in der Öffentlichkeit. Wie einengend eine Gesellschaft sein kann, in der es nur eine »single story« gibt, hat die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Adichie in ihrem berühmten TED-Talk beschrieben.4
Identität: Die psychologische Forschung ist sich zunehmend einig, dass Identität, oder besser: Ich-Identität, narrativ konstruiert ist (vgl. Z.B. ABELS 2010; KRAUS 2000; KEUPP et al. 2008). Sie entsteht aus den Geschichten, die wir uns selbst und anderen über uns erzählen, aber auch aus den Geschichten, die andere über uns erzählen, und schließlich aus den Geschichten, in die wir gleichsam hineingeboren sind (z.B. Familien- oder Gruppengeschichten). Identität ist damit nichts Festes, das ein für alle Male festgelegt wäre, sondern sie ist ständig im Fluss und entwickelt sich weiter. In ähnlicher Weise ist auch die Identität von Gruppen, Schichten, Gesellschaften, Nationen etc. eine ständig im Fluss befindliche narrative Konstruktion von Selbsterzählungen, Fremderzählungen und kontextuellen Narrationen, also diejenigen, die eine Gesellschaft gewissermaßen ›geerbt‹ hat. Deren Bedeutung wird vor allem deutlich, wenn man die nationale Identität der Deutschen betrachtet: Das, was unter der Herrschaft des Nationalsozialismus geschehen ist, wird jede narrative Identitätskonstruktion noch für lange Zeit grundieren – ob man das möchte oder nicht, auch wenn man sich wie Alexander Gauland und andere noch so bemüht, diese Zeit als ›Fliegenschiss‹ zu marginalisieren.
Abb. 3: Die narrative Konstruktion der Identität

In der Regel entstehen die Geschichtenwelten der Identität gewissermaßen von selbst, oft werden sie aber auch bewusst aufgebaut. Das ist in der Regel der Fall, wenn eine Nation oder ein Volk sich selbst einen Gründungsmythos geben möchte (wie etwa im Fall der Römer der Aeneas-Mythos und die Geschichte von Romulus und Remus, den mythischen Gründern Roms, die von einer Wölfin gesäugt wurden) oder bewusst Geschichten erzählt, die die eigene Vortrefflichkeit herausstellt (›Land der Dichter und Denker‹). Ein Beispiel für einen aktiv gestalteten Gründungsmythos beschreiben die Politikwissenschaftler Ivan Krastev und Stephen Holmes in ihrem Buch Das Licht, das erlosch (KRASTEV/HOLMES 2019). Offenbar hat der ungarische Präsident Viktor Orban ein mythisches Datum der ›magyarischen Landnahme‹ als Nukleus der ungarischen Identität definiert: »Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Populisten eine der vielen Vergangenheiten ihrer Länder auswählen und sie als die authentische Vergangenheit der Nation darstellen« (KRASTEV/HOLMES 2019: 112). Diese Strategie der (nationalen oder ethnischen) Identitätsbildung ist jedoch nicht auf Populisten beschränkt. Jede Tourismuswerbung, die Merkmale der Geschichte oder Bevölkerung eines Landes herausstellt, priorisiert bestimmte Geschichten vor anderen, indem etwa Geschichten zu attraktiven nationalen Klischees – der extrovertierte Italiener, der stolze Spanier, der knorrige, aber dennoch liebenswerte Bayer – absolut gesetzt werden.
Politisches Storytelling bzw. die Arbeit mit Geschichten in der Politik ist damit auch immer Arbeit bzw. Umgang mit Identitäts-Narrativen unterschiedlicher Gruppen, Regionen, Nationalitäten, Lebensstilen, Orientierungen etc.
Werte: Im politischen Alltag werden täglich Werte beschworen, in ganz unterschiedlichen Kontexten – ob es nun um Wertsetzungen im eigentlichen Sinn oder um Identitäten geht, wenn etwa wieder einmal die ›christlich-abendländischen Werte‹ bemüht werden. Wenn wir im Alltag über Werte nachdenken, fallen uns meist Begriffe ein: ›Menschenwürde‹ wäre so ein Begriff, ›Wertschätzung‹, ›Tradition‹ und so weiter. Aber im Grunde sind auch Werte narrativ konstruiert, sobald sie konkret werden und nicht nur Worthülsen bleiben. Um sich das klar zu machen, können Sie folgendes Experiment durchführen: Wenn Sie mit einer Gruppe von Freunden oder Freundinnen zusammensitzen, einigen Sie sich auf einen Wert, der allen wichtig ist, sagen wir einmal: Toleranz. Dann sollte jeder oder jede versuchen, sich an ein Erlebnis zu erinnern, in dem Toleranz eine Rolle gespielt hat. Dann erzählen alle ihr Erlebnis der Reihe nach, ohne dass darüber diskutiert wird. Sie werden sehen: In nahezu jeder dieser Geschichten wird der Wert ›Toleranz‹ eine etwas andere Bedeutung, eine andere Färbung einnehmen. Und erst auf der Basis dieser Geschichten können Sie darüber diskutieren, was denn Toleranz ganz konkret sein soll, welche Art von Handlungen dieser Wert hervorbringt. Ein anderes Beispiel: Der Wert ›Kindesliebe‹ hätte in den 1950er-Jahren auch die Prügelstrafe inkludieren können (»Ich schlage dich, weil ich dich liebe.«), während wir eine solche Interpretation dieses Werts heute zu Recht von uns weisen würden. Man sieht an diesen Beispielen: Werte, die wir nur als Begriffe behandeln, bleiben inhaltsleer, auch wenn man sie noch so oft in Reden und Gesprächen beschwört. Erst wenn man die Geschichten dazu hört und erzählt, wird klar, was für ein Verhalten sie nahelegen und damit was für eine Haltung sich hinter ihnen verbirgt.
Wissen: Auch eine Art von Wissen, die besonders für das politische Handeln relevant ist, ist narrativ: das Erfahrungswissen. Damit ist nicht ein wissenschaftliches oder kognitives Wissen gemeint, wie es in Lehrbüchern steht, sondern eines, das aus dem Handeln und den Erfahrungen generiert wird und dem Menschen oft gar nicht bewusst ist. Verfügbar wird dieses Wissen erst durch das Erzählen. Das bedeutet: Wenn man im gesellschaftlichen Leben Erfahrungen lebendig halten und nutzbar machen will, muss man Räume schaffen, in denen Menschen ihre Erfahrungen erzählen und andere zuhören können.
Kommunikation: Zum Thema Kommunikation muss man nicht viel sagen: Dass ein großer Teil der Alltagskommunikation über Geschichten läuft, versteht sich von selbst. Und an Kommunikation haben die Leserinnen und Leser beim Titel dieses Buchs vermutlich zuerst gedacht. Über die Kommunikation werden natürlich auch die anderen Felder des Narrativen vermittelt.
Geschichten und Zeit: Geschichten machen Geschichte
Geschichten oder narrative Strukturen haben immer etwas mit Zeit zu tun. Geschichten erzählen von Begebenheiten, die irgendwann angefangen haben, und zu einem anderen Zeitpunkt an ein – zumindest vorläufiges – Ende kommen: Wie sich Hans und Marie kennengelernt, verliebt und geheiratet haben. Was ich gestern erlebt habe. Wie es dazu kam, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Der Normalfall einer Geschichte ist, dass im Nachhinein erzählt wird, was geschehen ist. Im Nachhinein wird ausgewählt, welche der vielen Begebenheiten, die Hans und Marie von dem Zeitpunkt, als sie sich zum ersten Mal gesehen haben, bis zu dem, als sie ›beschlossen‹ haben, ein Paar zu sein, für ihre Geschichte relevant sind. Denn wenn wir einmal annehmen, dieser Prozess habe mehrere Wochen gedauert, so werden beide Hauptfiguren unserer Geschichte eine ganze Menge erlebt haben: Vielleicht ist Marie in ihrer Arbeit befördert worden, Hans hat einen niederschmetternden Steuerbescheid bekommen, Maries Katze war kurz krank und Hans hat einen alten Schulfreund getroffen, von dem er lange nichts mehr gehört hatte. Und so weiter. Die Liebesgeschichte von Hans und Marie zu erzählen, bedeutet, aus diesen Begebenheiten, die den ›Strom des Lebens‹ ausmachen, diejenigen auszuwählen, die relevant für die Geschichte waren. Die Krankheit der Katze wird wohl nicht so wichtig gewesen sein. Oder doch? Vielleicht ist es Marie im Wartezimmer des Tierarztes beim Lesen ihres Liebeshoroskop in einer Illustrierten zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass sie in Hans verliebt ist? Und der alte Schulfreund? Vielleicht ist er ja die Ursache, dass die Beziehung der beiden nach einigen Jahren – nehmen wir einmal an – wieder auseinander geht, weil Marie eine Affäre mit diesem Schulfreund beginnt. Ob die Begegnung mit dem Schulfreund für die Liebesgeschichte wichtig ist, wird sehr stark davon abhängen, wann sie erzählt wird. Wenn Hans und Marie bei ihrer Hochzeit erzählen, wann und wie sie sich kennen und lieben gelernt haben, wird der Schulfreund wohl keine Rolle spielen. Wenn Hans ein paar Jahre später, nach der Trennung des Paars, die Geschichte des Verliebens erzählt, sehr wohl: Der Schulfreund ist eine Figur, die in der Geschichte wirkmächtig wird. Vielleicht kommt in Hans’ Erzählung ein Satz vor wie: ›Wenn ich da schon geahnt hätte, was später geschieht, hätte ich Marie niemals dem Schulfreund vorgestellt‹.
Eine Geschichte zu bauen und sie zu erzählen, vor allem wenn es sich um sogenannte »Wirklichkeitserzählungen« (KLEIN/MARTINEZ 2009) handelt, ist also immer ein Prozess der Selektion. Ebenso wie ein Fotograf sich entscheiden muss, welchen Ausschnitt der Wirklichkeit er für sein Bild wählt, muss der Erzähler aus dem Strom des Lebens auswählen und Entscheidungen treffen, welche der Begebenheiten für seine Geschichte relevant sind und welche nicht. Im Alltag treffen wir diese Entscheidungen meist nicht bewusst: Wir erzählen einfach mit einem mehr oder weniger stark ausgeprägten Gefühl der Relevanz.
Die Entscheidung für das, was relevant ist – und das ist ein zweiter wichtiger Faktor für das erzählende Rekapitulieren der Vergangenheit – hängt entscheidend von dem Zeitpunkt ab, an dem eine Geschichte erzählt wird: Für die Liebesgeschichte, die bei der Hochzeit erzählt wird, sind andere Begebenheiten relevant, als in der Geschichte, die erzählt wird, wenn alles schon vorbei ist. Eine Geschichte über die Vergangenheit ist also immer eine Funktion der Gegenwart: Sie ist der Versuch, die Begebenheiten so zu ordnen, dass die Geschichte eine Erklärung dafür liefern kann, wie alles so geworden ist, wie es ist.
Ein schönes Beispiel für diesen Effekt liefern die beiden autobiografischen Bücher Wir sind Gefangene (GRAF 1982) und Gelächter von außen (GRAF 1983) des Schriftstellers Oskar Maria Graf. Im ersten der beiden Bücher, 1927 zuerst erschienen, erzählt Graf die Geschehnisse seiner Jugend bis zu den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Im zweiten Werk, 1966 erschienen, setzt er nochmals im Jahr 1918 an und erklärt im Vorwort, er müsse – obwohl er diese Zeit schon in Wir sind Gefangene beschrieben habe – sie noch einmal erzählen, aber nicht als »[…] breit ausgewalzte Verwichtigung von bereits Bekanntem […]. Im Gegensatz dazu handelt es sich aber um ein Nachholen von unbekannten Erlebnissen und Geschehnissen, die für mich erst in der nachdenklichen Rückerinnerung insofern Bedeutung gewonnen haben, weil sie – wie mir scheint – auch aufschlußreich für die Atmosphäre der damaligen Zeit sind.« (GRAF 1983: 7). Unter anderem erzählt er von mehreren Begegnungen mit Adolf Hitler in der Nachkriegszeit. 1927 war dieser für Graf nur ein politisierender Sektierer und ›Pflastertreter‹ in München-Schwabing gewesen, ein Spinner unter vielen anderen – und die Begegnungen mit ihm erschienen dem Autor wohl zu der Zeit der Abfassung des ersten Buches nicht interessant genug. Leider hat er später eine andere historische Bedeutung bekommen und gehörte damit zur autobiografischen Geschichte Oscar Maria Grafs. Da er auch Bauerngeschichten schrieb, wollte Hitler ihn als Blut-und Boden-Schriftsteller gewinnen (ein Ansinnen, dem Graf sich als Kommunist natürlich verweigerte).
Auch jede politische Geschichte, jede politisch instrumentalisierte Erzählung der Vergangenheit ist also eine Konstruktion, die abhängig ist von dem Zeitpunkt des Erzählens. Insofern sagt eine Vergangenheitserzählung mehr über die Gegenwart (des Erzählens bzw. der Erzählenden) aus als über die Vergangenheit selbst: Sie ist immer der Versuch einer Erklärung, wie wir so geworden sind, wie wir heute sind. Eine Erzählung über die Vergangenheit kann also nie ein ›objektives‹ oder ›wahres‹ Bild der Vergangenheit oder der Historie liefern, sondern allenfalls eine Annäherung daran. Auch die Geschichtsschreibung muss immer eine Wahl treffen, nie kann sie den ganzen Strom der Geschehnisse gleichwertig abbilden – was zudem ja, wenn es dann ginge, sinnlos wäre, weil dann die Geschichtsschreibung nicht mehr erklären, sondern nur noch abbilden könnte.
Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Parameter, die das Erzählen vergangener Geschehnisse beeinflussen (können). Da wäre einmal die Perspektive, aus der erzählt wird (am Beispiel unserer Liebesgeschichte die Frage, ob sie von Hans oder von Marie erzählt wird), die Bewertung (soll über eine glückliche oder unglückliche Beziehung berichtet werden), die Absicht (hat der Erzähler z.B. eine didaktische Intention, indem er etwa durch die Geschichte von Hans und Marie erläutern will, welche Fehler man in einer Beziehung niemals machen darf), die Wirkung (ein Redner erzählt die Geschichte so, wie sie bei seinem Publikum am besten ankommt), und so weiter. Einige dieser Mechanismen sind dem Erzählen inhärent, andere können aus strategischen oder manipulativen Absichten gewählt oder weggelassen werden. Wir werden auf diesen Aspekt im nächsten Kapitel zurückkommen.
Die Gegenwart und ihre Vergangenheit
Geschichten, die im Alltag, aber auch in den Medien oder in der Kunst erzählt werden, sind meistens Geschichten über eine tatsächliche oder erfundene Vergangenheit. Das kann man schon daran erkennen, dass das normale Tempus für Erzählungen die Vergangenheit ist: Nach Abschluss einer bestimmten Ereignisfolge wird erzählt, wie es sich zugetragen hat, dass diese oder jene Endsituation eingetreten ist. Wie es gekommen ist, dass sich das Liebespaar gefunden hat, der Mörder gefasst oder ein Kampf gewonnen wurde. Die Zeit, in der die meisten Erzählungen spielen, gleichgültig ob es sich um fiktionale (in Romanen, Filmen und Kurzgeschichten) oder um faktuale Geschichten (in Nachrichten und Reportagen) handelt, ist die Vergangenheit, und ebenfalls in aller Regel berichtet der Erzähler oder die Erzählerin auf der Basis eines Wissens, wie die Geschichte ausgegangen ist – ob die Liebesgeschichte glücklich oder unglücklich geendet hat, ob der Schatz gefunden wurde oder nicht. Im filmischen Erzählen ist dies ein wenig komplizierter, weil hier die implizite Erzählerinstanz nicht so deutlich zutage tritt wie in sprachlichen Erzählungen. Aber wir können davon ausgehen, dass auch hier zumindest die gewohnheitsmäßige Erwartung der Rezipienten ist, dass den Film jemand ›gemacht‹ hat, der weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist.
Von jeher erfüllten diese Vergangenheitserzählungen mehrere Funktionen. Neben der Unterhaltungsfunktion, wenn etwa am Abend die Mitglieder der legendären Seinzeithorde von ihren spannendsten Jäger- und Sammlererlebnissen des Tages berichteten, war die wichtigste wohl die der Wissensvermittlung. Und zwar einerseits eines für das tägliche Überleben notwendigen Wissens (Wo wurde ein Säbelzahntiger gesichtet, wo jagbares Wild, wer ist gestorben und wie?), andererseits aber vor allem auch ›Weltwissen‹, wie es von Anfang an Mythen und Sagen bereitgestellt haben: Wie ist die Welt entstanden, wer sind diese Götter, die sie geschaffen haben, woher kommen wir und was haben wir von unseren Vorfahren kulturell geerbt? Kurz, es sind Erzählungen darüber, wie wir und unsere Welt geworden sind, was und wie wir heute sind. Der Bogen spannt sich dabei von der Kosmogonie (Wie wurde die Welt erschaffen?) über die Anthropogonie (Und wie die Menschen?) bis zur Entstehung der eigenen Kultur (Wie sind unsere Sitten und Gebräuche entstanden, und warum unterscheiden sich diese eventuell von denen anderen Gruppen?). Da es Mythen und Sagen, soweit wir wissen, in allen Kulturen gibt und gab, kann man wohl schließen, dass es ein Grundbedürfnis des Homo sapiens ist, die Gegenwart und ihre Bedingungen nicht einfach hinzunehmen, sondern erzählend zu erklären, warum und wie es geworden ist, was wir heute erleben und sehen. Voraussetzung dafür ist natürlich ein Sinn für Zeit und ihr Vergehen – den wir vermutlich den meisten Tieren absprechen würden – sowie ein Sinn für Veränderungen, Transformationen, die im Laufe der Zeit geschehen: Am Anfang war die Welt wüst und leer, dann wurde Land und Wasser und alles andere geschaffen. Früher gab es unser Volk noch nicht, aber dann kamen die Urväter als Flüchtlinge hierher (so der bereits erwähnte Gründungsmythos der Römer, die sich als Nachkommen des trojanischen Helden Aeneas mythisch aufgewertet haben). Dieser Sinn für das Vergehen von Zeit und die damit einhergehenden Veränderungen ist offenbar tief in unserem Gehirn verankert.
Und das bedeutet letztlich, dass wir (unter anderem) sehr stark in narrativen Strukturen denken und mit Geschichten unsere Welt konstruieren, und damit ist für jemanden, der narrativ denkt (und das sind wir als Angehörige der Gattung Homo sapiens alle), die Welt nicht einfach etwas ›Seiendes‹, sondern etwas ›Gewordenes‹.
Die Frage, wie dieses ›Gewordene‹ erklärt wird, welche Geschichten also als zutreffend angesehen werden, um zu erklären, ›wie wir geworden sind, was wir heute sind‹, ist natürlich eminent politisch. Kommen in unseren historischen Geschichten auch Frauen vor oder nur Männer, ist zum Beispiel immer noch eine Frage, die zu Recht heftig diskutiert wird. Beginnt die Geschichte Afrikas im Wesentlichen mit der Kolonialzeit oder liegt ein Schwerpunkt auf vorkolonialen Kulturen? Ist Teil dieser Geschichten die angebliche Überlegenheit einer Gruppe oder einer Ethnie? Der Kampf um die zutreffenden Geschichten über die Vergangenheit ist damit ein Kampf um die Deutungshoheit und damit um die zutreffende Beschreibung unserer Gegenwart. Ein Slogan wie Trumps ›Make Amerika great again‹ interpretiert die jüngste Vergangenheit bis zur Gegenwart als die Geschichte eines Niedergangs: Wenn Amerika ›wieder groß‹ werden soll, steckt dahinter das Narrativ ›Amerika war mal groß. Dann passierte etwas, das diese Größe zerstörte. Heute ist Amerika nicht mehr großartig.‹ Natürlich sind auch andere Narrative denkbar und sie werden auch von anderen Gruppen erzählt, die evtl. die jüngste Vergangenheit eher als eine Aufbruchsgeschichte (unter Obama) erzählen.
Auf welche Weise die Gegenwart über den Rückgriff auf die Vergangenheit konzipiert wird, hängt natürlich einerseits davon ab, ob sie als ein positiver oder ein negativer Zustand verstanden wird. Und diese Bewertung entscheidet dann, welche Vergangenheitserzählung gewählt wird. Nehmen wir an, die Gegenwart würde als negativer Zustand bewertet, und zwar von zwei Gruppen in unterschiedlicher Weise. Eine linke Gruppe beurteilt ihn negativ, weil die soziale Schere immer weiter aufgehe, Wohnungen teurer, die Lebensbedingungen für Geringverdiener immer schwieriger werden etc. Eine rechte Gruppe dagegen bewertet unseren gegenwärtigen Zustand als negativ, weil Deutschland im Begriff sei, ›umgevolkt‹ zu werden, immer mehr Menschen islamischen Glaubens ins Land kämen und dadurch die traditionelle deutsche Kultur zerstören. Man kann sich leicht vorstellen, dass beide Bewertungen unterschiedliche Vergangenheitserzählungen voraussetzen – die erste die aus dieser Sicht zweifelhafte Erfolgsgeschichte der neoliberalen Ökonomie seit den 1980er-Jahren, die andere die angebliche ›Grenzöffnung‹ durch Angela Merkel und die dadurch ebenso angeblich ausgelösten Flüchtlingsströme. Meist sind diese erklärenden Vergangenheitsgeschichten eher einfach gestrickt und kaum auf dem Stand historischer Forschung. Unterschiede können natürlich auch in den zugrunde liegenden Fakten der jeweiligen Bewertungen bestehen: Während sich die zunehmende Öffnung der sozialen Schere durch Zahlen belegen lässt (wie es der französische Ökonom Thomas Piketty (2014) in seiner Studie Das Kapital im 21. Jahrhundert getan hat, gibt es für eine tatsächliche ›Umvolkung‹ keinerlei Faktenbasis.
Politische Vergangenheitserzählungen beruhen also auf einem Narrativ, dessen Endzustand die Gegenwart ist und je nach Interesse bezüglich Bewertung und Grundlage dieser Bewertung werden bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit ausgewählt. Politische Strategie auf dieser Ebene bedeutet, zu denen des politischen Gegners alternative Vergangenheits-Narrative zu entwickeln – und damit Narrative, die alternative Interpretationsrahmen für die Gegenwart anbieten.
Ein wichtiger Aspekt politischer Vergangenheits-Narrative ist die Relation von Ausgangs- und Endzustand (also die Gegenwart): Wird der Ausgangszustand als positiv wahrgenommen und der Endzustand als negativ, oder umgekehrt, oder werden beide identisch bewertet. Dabei wären folgende Fälle denkbar:
| V1: | Früher war alles besser: Vergangenheit positiv, Gegenwart negativ |
Die gesellschaftliche Gegenwart wird als das Endprodukt einer Abstiegsgeschichte betrachtet: Es war einmal gut, dann ist irgendetwas geschehen, das die Dinge verschlechtert hat, und heute leben wir in einem negativen Zustand. Derartige Glorifizierungen der Vergangenheit findet man naturgemäß eher auf der konservativen bis rechten Seite; Slogans wie Trumps ›Make America great again‹ zeugen von einer solchen Rückwärtsgewandtheit ebenso wie die Träume von einer ehemals ethnisch ›reinen‹ oder homogenen Bevölkerung, die durch Zuwanderung zerstört wurden. Meist ist in diesen Fällen die Bewertung der Vergangenheit auch das implizite oder explizite Programm, das in einer angestrebten Rückkehr in diesen Zustand besteht. Doch auch wenn vor allem konservativ-rechte Gruppen solche rückwärtsgewandten Narrative aufrufen, stecken sie – vielleicht verborgener – auch in denen anderer Gruppen. Auch in manchen ökologischen Narrativen klingt es an, wenn etwa eine Zeit gepriesen wird, in der es kaum Umweltverschmutzung gab, und wo der Fokus hauptsächlich auf einen Verzicht auf die Produkte oder Technologien gelegt wird, die als (mit)schuldig an der Umweltverschmutzung identifiziert werden. Schon Rousseaus ›Zurück zur Natur‹ aktivierte ein rückwärtsgewandtes Narrativ mit der anthropologischen Unterstellung, es habe einen solchen Naturzustand irgendwann tatsächlich gegeben, bzw. man könne einen Unterschied machen zwischen der ›Natur des Menschen‹ und seinen Hervorbringungen. Denn, so könnte man einwenden, gehört es nicht vielmehr auch zur ›Natur des Menschen‹, Technik hervorzubringen?
| V2: | So gut ging es uns noch nie / Seht, was wir erreicht haben: Vergangenheit negativ, Gegenwart positiv |
Dass Geschichten von diesem Typus gerne von den Gruppen erzählt werden, die seit längerem an der Macht sind bzw. die sich als die gesellschaftliche Elite fühlen, liegt auf der Hand. Vor allem autokratische Regimes pflegen dieses Narrativ, nicht selten in völliger Unabhängigkeit von jeglichen Fakten – man schaue nur nach Nordkorea. Diese Form der Vergangenheitserzählung kann aber auch im berechtigten Stolz auf das Geschaffte erzählt werden – in Deutschland etwa die Geschichte des Wirtschaftswunders der 1950er-Jahre oder – wenn man es so sehen möchte – die der Bewältigung der Finanzkrise von 2008.
| V3: | Es ist nochmal gut gegangen: Vergangenheit positiv, Gegenwart positiv, dazwischen Probleme |
Dieses Narrativ wird ebenfalls gerne von Gruppen, die an der Macht sind bzw. sich als Elite fühlen, erzählt, wenn sie sich die Überwindung einer Krise zuschreiben. Geschichten von diesem Typus erzählten etwa deutsche Regierungsmitglieder nach der Bankenkrise 2008 und den auf sie folgenden Krisen, die als Euro- und Griechenlandkrise bekannt geworden sind. Für viele Griechen erfüllte die damit zusammenhängende Ereignisfolge allerdings eher das Vergangenheits-Narrativ V1. Während des Schreibens an diesem Buch hoffe ich sehr, dass wir bald auch über die Corona-Krise in dieser Form erzählen können.
| V4: | Kurzzeitig sah es so aus, als ob alles gut würde: Vergangenheit negativ, Gegenwart negativ, dazwischen einmal ein positiver Zustand |
Dieses Narrativ wird von Gruppen erzählt, die einmal einen Aufbruch gewagt haben, aber jetzt von dessen mangelnden Effekten enttäuscht sind. Dies könnten manche Angehörige der ›Alt-68er‹ sein, die nach dem Aufbruch Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre ein Wiedererstarken des Kapitalismus beklagen. Man kann sich auch vorstellen, dass manche Angehörige eines ›ostalgischen‹ Milieus, also Menschen, die sich nach den Zuständen in der DDR zurücksehnen und ihre Hoffnungen bei der Wende enttäuscht sahen, Narrative dieses Typus erzählen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.