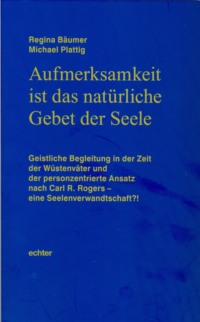Kitabı oku: «Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele», sayfa 3
I.1.C. Die Entwicklung von der Anachorese zum Koinobitentum
„Das Mönchtum der Sketis, das uns die sog. Apophthegmata Patrum in vollendeter Form und Klarheit abspiegeln, ist seinem Grundcharakter nach anachoretisch.“63 Mit dieser Feststellung beginnt W. Bousset seinen grundlegenden Artikel zum Mönchtum der sketischen Wüste.
In den Apophthegmata fehlt Pachomius, der Vertreter des koinobitischen Ideals völlig, und auch das koinobitische Milieu spielt nur eine geringfügige Rolle. Es gibt einige Erzählungen, die die Anachoreten in freundlichem Umgang mit Klöstern zeigen, jedoch herrscht eine eindeutige Polemik gegen die Klöster zugunsten der Anachorese vor. Die Grenzlinie zwischen Anachoretentum und Koinobitentum zu ziehen ist nicht so einfach, denn es gab in dieser Zeit viele Übergangsformen. Bousset nennt als wesentliches Kriterium die Frage nach der Autorität: „Man wird aber doch wohl sagen dürfen, daß das Kennzeichen eines Koinobions der Koinobiarches ... ist. Wo sich ein solcher Klostervorsteher findet, der von Amts wegen, nicht auf Grund nur vorübergehender freiwilliger Unterordnung der Brüder, und gewöhnlich lebenslänglich führt, wird man von einem Kloster reden können.“64 Dem gegenüber bleibt festzuhalten: „Der ganz einsam lebende Anachoret ist immer nur eine schnell schwindende Erscheinung des ersten Anachoretenwesens. Um den einzelnen Anachoreten sammeln sich Schüler, siedeln sich mit ihren Zellen in seiner Nähe an65, beginnen für seine äußeren Bedürfnisse zu sorgen, in unbedingter Ehrfurcht zu ihm aufzuschauen, sich ihm in fast sklavischem Gehorsam zu unterwerfen.“66 Das Verhältnis allerdings zwischen dem Anachoretenvater (ebenfalls Abbas) genannt und seinem Schüler bleibt ein freieres und loseres. Oft wird berichtet, daß Schüler ihren Meister wechseln, was durchaus erlaubt ist, wenngleich davor gewarnt wird, dies zu oft zu tun.67 „Für den Anachoreten ist die Bindung an Wille und Weisung des Abba zeitlich begrenzt. Das Ziel der Bindung an den geistlichen Vater ist, daß der Jünger eines Tages selbst ‘Abba’ wird, der nun seinerseits Jünger leitet. Für den Cönobiten dagegen ist der Gehorsam Lebensgesetz, das ihn nicht mehr freigibt, da er Wesenselement des kommunitären Lebens ist.“68
Amma Synkletika sprach:
„Wenn wir in einem Koinobion sind, dann mußt du den Gehorsam der Askese vorziehen, denn die letztere lehrt Hochmut, der erstere Demut.“ (Amma Synkletika 16)(Apo 907)
Der Gehorsam wird zur charakteristischen Tugend des koinobitischen Lebens und nimmt jene zentrale Stellung ein, die bei den Anachoreten die Demut einnimmt. Weitere, für das Klosterleben charakteristische Bestimmungen sind die täglichen gemeinsamen Mahlzeiten und die täglichen geregelten Gottesdienste. Nach der Regel des Pachomius war eine tägliche zweimalige Gebetszusammenkunft (collecta) und eine zweimalige Mahlzeit vorgesehen.69 Die gesamte Klosteranlage, die in der frühen Zeit aus mehreren Gebäuden bestand, wurde von einer großen Mauer umfaßt und nach außen abgeschlossen. Damit wurde der „koinos bios“, der gemeinsame Lebensraum, definiert. Wer diesen ohne Erlaubnis verließ, machte sich strafbar, ging man erlaubterweise hinaus, dann immer zu zweit.70
Vor allem gegen diese Regelungen polemisieren die Anachoreten der Apophthegmata:
„Einem Bruder, der in der Wüste der Thebais wohnte, kam der Gedanke: ‘Was sitzt du hier so unfruchtbar da? Auf, geh ins Koinobion, und dort wirst du Frucht bringen.’ Er stand also auf, kam zum Altvater Paphnutios und teilte ihm seinen Gedanken mit. Der Greis sagte zu ihm: ‘Geh fort und setz dich in dein Kellion. Verrichte ein Gebet am Morgen, eines am Abend und eines in der Nacht. Wenn du Hunger hast, dann iß, wenn du Durst hast, dann trinke, und wenn du Schlaf hast, dann schlafe. Bleibe in der Wüste und laß dich nicht auf den Gedanken ein.’ Er kam auch zum Abbas Johannes und teilte ihm die Weisungen des Abbas Paphnutios mit. Und Abbas Johannes sagte ihm: ‘Bete überhaupt nicht, nur bleibe in dem Kellion.’ Und er stand auf, kam zum Abbas Arsenios und teilte ihm alles mit. Der Greis sprach zu ihm: ‘Halte fest, was die Väter dir gesagt haben, ich habe dir nicht mehr zu sagen.’ Völlig zufriedengestellt ging er von dannen.“ (Paphnutios 5)(Apo 790)71
Verschiedene Autoritäten der Sketis zeugen gegen das Koinobion. Die Zelle ist der entscheidende Ort des Anachoreten72, dies wird immer wieder betont:
„Ein Bruder kam in die Sketis zum Altvater Moses und begehrte von ihm ein Wort. Der Greis sagte zu ihm: ‘Fort, geh in dein Kellion und setze dich nieder, und das Kellion wird dich alles lehren.“ (Moses 6)(Apo 500)
Evagrios Pontikos unterscheidet bezüglich der Kampftaktik der Dämonen:
„Gegen die Anachoreten kämpfen die Dämonen offen, an die Cönobiten aber oder an jene, die in Gemeinschaft mit anderen die Tugenden üben, machen sie sich über nachlässige Brüder heran. Die zweite Art zu kämpfen ist nicht so gefährlich wie die erste, denn auf der ganzen Erde gibt es niemanden, der so verbissen wie die Dämonen kämpft, niemanden, der gleichzeitig alles Böse im Menschen zu stützen sucht.“73
Der wesentliche Gegensatz zwischen Anachoretentum und Koinobion bestand offensichtlich nach dem Zeugnis der Apophthegmata in der Einschränkung des Selbstbestimmungsrechtes des Einzelnen durch die Gemeinschaft und ihre
Erfordernisse und Regeln74, so auch Abbas Poimen:
„Ein Bruder wandte sich an den Abbas Poimen: ‘Ich will ins Koinobion gehen, um dort zu wohnen.’ Der Abbas fragte ihn: ‘Du willst ins Kloster gehen? Wenn du nicht auf alle Unterhaltung und auf jedes Geschäft vergessen kannst, dann kannst du auch kein Klosterleben führen. Denn dort hast du nicht einmal ein Recht auf einen einzigen Becher.“ (Poimen 152)(Apo 726)
Dies betraf in der weiteren Entwicklung auch den entscheidenden Punkt der Seelenführung. Der Anachoret suchte sich seinen geistlichen Vater selbst und wechselte ihn unter Umständen, im Koinobion wurde entweder der Klostervorsteher zum Seelenführer der Gemeinschaft oder es mußte eine Regelung innerhalb der Gemeinschaft gefunden werden. Das Wort Abbas (Vater), bzw. auch Amma (Mutter), ursprünglich die Ehrenanrede für die „Geistträger“75, denen man sich als Schüler anvertraute76, wurde immer mehr zur Bezeichnung des institutionalisierten Amtes des Klostervorstehers. Das ursprünglich charismatische, geistgefüllte Wort Abbas wird nach und nach zur rein juridischen Bezeichnung.77
Ist bei Pachomius noch von der Einheit zwischen charismatischer Begabung und juridischer Funktion auszugehen78, so bestimmt er selbst bereits in seiner Regel, daß die Gebote der „seniores“ zu achten seien und daß diese vom Mönch nicht unbeachtet bleiben sollen79, damit er seine Gedanken prüfen kann.80
Diese Spannung findet sich auch noch in der Regel Benedikts. Im 49. Kapitel heißt es bezüglich des Fastens: „Was aber jeder als Opfer darbringt, muß er seinem Abt unterbreiten, damit es mit seinem Gebet und seiner Zustimmung geschieht; denn was ohne Erlaubnis des geistlichen Vaters geschieht, gilt als Anmaßung und eitle Ruhmsucht, nicht als Verdienst. Deshalb soll man alles mit Zustimmung des Abtes tun.“81 Abt und geistlicher Vater sind also gleichgesetzt. Daneben zeigt aber die Tatsache, daß es neben dem Abt noch andere „seniori spirituali“82 gibt, daß der Prozeß der Unterscheidung von geistlicher und juridischer Vaterschaft bereits im Gange ist.83
I.1.D. Die Apophthegmata und Vitae Patrum
I.1.D.a. Quellenlage und Verfasserfrage
Der Text ist in Coteliers Ecclesiae Graecae monumenta I 338-712 (Abdruck bei Migne PG 65,71-440) erhalten.
Ein Vorwort des Redaktors berichtet davon, daß ihm „verworrene und ungeordnete“ Aufzeichnungen vorlagen, die von ihm selbst alphabetisch nach den Namen der heiligen Männer geordnet worden seien. Die anonym überlieferten Worte habe er inhaltlich geordnet.84
Der Text des zweiten Teils ist verlorengegangen, in Coteliers Text und damit auch bei Migne PG 65 findet sich nur das Alphabeticon.
Mit dem Alphabeticon hängt aufs engste eine zweite Sammlung zusammen, die in der lateinischen Form in Rosweydes Sammlung Vitae Patrum unter V und VI (Migne PL 73,851-1024) vorliegt. Photius kannte noch das entsprechende griechische Werk, das auch noch in griechischen Handschriften erhalten ist.
Nach eingehender Untersuchung, die hier nicht referiert werden muß, kommt Bousset zu dem Urteil, daß Buch V und VI bei Rosweyde ein Auszug aus dem Alphabeticon ist und daß dies auch die einzige primäre Quelle darstellte. Die 270 Nummern des anonymen Materials, die sich darüber hinaus in Rosweydes Vitae Patrum V und VI finden, dürften dem verlorengegangenen, inhaltlich geordneten und anonymen Teil der Apophthegmata entstammen.85
Die Apophthegmata beziehen sich in ihrer ursprünglichen Form auf das sketische Mönchtum und einige verwandte Kreise in einem Zeitraum von der Mitte des vierten bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts. Die Blütezeit des sketischen Mönchtums fällt etwa in das Zeitalter des Patriarchen Theophilos (385-412), der wiederholt auftaucht.86 Als letzter in der Chronologie der Väter erscheint Abbas Poimen, dem fast ein Fünftel der Sprüche des Alphabeticons zugeordnet werden.
W. Bousset hält den Schülerkreis Poimens für den Abfassungsort des größten Teils der Apophthegmata und kommt damit zu einer Abfassungszeit zwischen 460 und 500. Die ausführlichen Begründungen brauchen hier nicht referiert zu werden.87
F. Dodel weist aufgrund der Übereinstimmung des Logions Antonios 10 (Apo 10) mit der Vita Antonii, die 357 von Athanasios verfasst wurde, darauf hin, daß um die Mitte des 4. Jahrhunderts bereits einzelne Apophthegmata oder kleine Sammlungen im Umlauf waren.88
L. Regnault äußert sich in seiner französischen Übersetzung der Apophthegmata etwas zurückhaltender, mit Poimen hätten die Schule der Spiritualität der Wüste und auch das Genre der Apophthegmata ihren Höhepunkt erreicht.89
K.S. Frank hält dies zumindest für eine Möglichkeit, die durch die zentrale Bedeutung Poimens in der Sammlung gestützt werde.90
Poimen repräsentiert, so J. Driskoll, zumindest teilweise die erste Generation von Mönchen (oder eine Übergangsgeneration), die die mönchische Tradition nach der origenistischen Krise weitergeführt hat. Damit zusammen hängt eine Tendenz in den Apophthegmata, die von Origenes beeinflußten Mönche in der Darstellung eher unfreundlich zu behandeln.91
Trotz der vielen Stellen, die von Poimen berichten, ist eine Rekonstruktion seiner Vita äußerst schwierig, da sich das Zeitgeschehen in den Poimenlogien praktisch nicht niedergeschlagen hat und sich aus den Angaben über seine Gesprächspartner eine weit über 100 Jahre reichende Lebenszeit ergäbe, d.h. einige dürften legendarischer Natur sein und Poimen in einen Zusammenhang mit berühmten Altvätern setzen wollen.92
Einzig sicheres historisches Datum ist die Zerstörung der sketischen Mönchssiedlungen durch die Maziken im Jahre 407/8. „Die Welt hat Rom verloren, die Mönche die Sketis“, klagt Abbas Arsenios.93 Daraufhin zog Poimen mit seinen Brüdern nach Terenuthis am westlichen Nildelta und scheint dort geblieben zu sein.94
K. S. Frank vermutet: „Getrennt vom ursprünglichen Ort und zeitlich schon weit entfernt von den Anfängen des Wüstenmönchtums, mag in dem Kreis, der sich in Terenuthis um Abbas Poimen scharte, die Erinnerung an die sketische Heimat und die Frühzeit des sketischen Mönchtums besonders gepflegt worden sein. Der verehrte Vater wurde zum Garanten der Überlieferung, der die Sprüche und Anekdoten der Alten weiterzugeben wußte, seine eigene Unterweisung in knappe Worte faßte, und sich nicht dagegen wehren konnte, wenn ihm andere Worte in den Mund gelegt wurden.“95
Dies erklärt einerseits die Breite der Präsenz Poimens in den Apophthegmata, gerade auch als Überlieferer von Sprüchen und als Sprecher in Logien anderer Väter96, sowie gleichzeitig das Faktum, daß in der Überlieferung außerhalb der Apophthegmata fast nichts von ihm zu hören ist.
I.1.D.b. Die literarische Form
Die Sammlung der verschiedenen Apophthegmata zeigt keine formale oder inhaltlich Ordnung, außer der alphabetischen der Ausgabe bei PG. Formal lassen sich einzelne Gattungen bestimmen.
I.1.D.b.α. Anekdotisches Apophthegma
Da wäre zunächst das „anekdotische Apophthegma“ zu nennen97, Einzelgeschichten, die Anekdotisches berichten, entweder verbunden mit einem Logion oder auch ein „wortloser Spruch“, der in knappen Worten den Mönchsvater charakterisieren will.98 „Mit greifbarer Lebendigkeit steht in diesen kleinen Momentphotographien das Leben und Treiben der sketischen Mönche vor uns.“99
I.1.D.b.β. Das Logion
Neben der Anekdote ist es vor allem das einzelne Logion, der einzelne Ausspruch eines Altvaters, der im Kreis der sketischen Brüder eine offensichtlich sehr wichtige Rolle spielte. Der Väterspruch ist meist ein erfragtes, ein erbetenes Wort. Der Schüler, der jüngere Mönch kommt mit einem Problem, einer Frage zum Altvater, er sucht Antworten, meist nicht intellektueller Art, sondern praktischer und darin oft existentieller Art. Er will etwas begreifen, etwas durchschauen, was ihn verwirrt, was ihm zur Frage geworden ist, was sich als Problem erwiesen hat. E. Ghini hat unter der Überschrift „Der Schüler, ein Fragender“ die Fragen in den Apophthegmata untersucht und systematisiert100, sie kommt zu dem Urteil: „Die Pluriformität der Fragen der Schüler zeigt das totale Vertrauen, das sie in den Vater setzten, dem sie wie einem Sprachrohr Gottes zuhören... .“101
Eine Form der Einleitung einer Frage in den Apophthegmata sind die stereotypen Formeln: „Sag mir ein Wort!“102; „Sag mir ein Wort, wie ich gerettet werde?“103; „Sage mir, was ich tun soll!“104; „Sage mir, was ich tun soll, damit ich gerettet werde!“105; „Was soll ich tun?“106. Die Bitte kann sehr eindringlich vorgetragen werden, der Altvater Poimen selbst etwa bittet Abbas Makarios unter Tränen um ein Wort.107
Mit der Frage wird eine Beziehung hergestellt und erkennt der Fragende den Altvater als geisterfüllten und erfahrenen Mönch, als Pneumatiker an. Deutlich wird das in folgender Erzählung:
„Altvater Moses sprach einmal zum Bruder Zacharias: ‘Sage mir, was ich tun soll!’ Als er das hörte, warf er sich auf den Boden zu seinen Füßen und sprach: ‘Du fragst mich, Vater!?’ Der Greis antwortete ihm: ‘Glaube mir, mein Kind Zacharias: Ich sah den Heiligen Geist auf dich herabkommen, und deswegen bin ich gezwungen, dich zu fragen.’ “ (Zacharias 3)(Apo 245)
Die Frage ist hier fast wie ein Initiationsritus in die Rolle des Altvaters, des Abbas zu verstehen, sie schließt auf jeden Fall die Erkenntnis beim Fragenden ein, daß der Befragte den Hl. Geist besitzt. Die Initiative und damit auch das Urteil darüber, ob jemand Abbas ist oder nicht, liegt beim Fragenden, darauf wird an anderer Stelle noch näher einzugehen sein.
Das Wort, das der Abbas dem Fragenden mitgibt, hat Gewicht und Bedeutung. Bousset nennt es „Orakelwort“108, was einerseits den manchmal auch verschlüsselten und nicht gleich offensichtlichen Charakter des Wortes hervorhebt109, was aber andererseits zu sehr an esoterische Praktiken erinnert. J.C. Guy nennt das Väterwort charismatisches Wort und unterstreicht damit die Geistgewirktheit, was sicherlich zutrifft. H. Dörries bezeichnet die Frage als Beichtfrage und die Antwort entsprechend als Beichtwort, was hier unbrauchbar scheint, denn es handelt sich nicht um eine Beichte, und es geht auch nicht immer um Fragen von Schuld und Vergebung.110
Am deutlichsten getroffen wird der Sachverhalt doch wohl von der Bezeichnung K.S. Franks, der von einer „Heilsfrage“ und einem „Heilswort“ spricht.111 Darin ist auf der einen Seite die Dringlichkeit der Frage eingefangen, es geht um die Rettung, und andererseits der heilende, der therapeutische Charakter des Väterspruches betont. Darüber hinaus ist auch deutlich, daß dieses Heil immer nur geistgewirkt sein kann.
Eine zweite Art sind konkrete Fragen, die oft mit der Bemerkung eingeleitet werden: „Ein Bruder fragt den Altvater“, dann wird die Frage wiedergegeben.112 Aus der allgemeinen und offenen Heilsfrage ist eine konkrete Frage geworden. Die generelle Antwort „so und so muß ein Mönch sein, so und so lebt man in der Wüste“ provoziert neue, konkretisierende Fragen zur Wüstenaskese, bis hin zu ganz praktischen Fragen wie: „Man hat mir ein Erbe hinterlassen, was soll ich damit tun?“113. K. S. Frank nennt diese Form die Lehrfrage, geht es doch darin mehr um die Entfaltung einer Lehre und nicht so direkt um das Heil.114 W. Bousset spricht von „kleinen Dialogen“115, was wiederum den erweiterten Charakter dieser Form betont. Von Abbas Agathon etwa wird berichtet wie er seine zwei Schüler befragt, um sie zu belehren.116
Unter den Logien sind noch die unerfragten Weisheitssprüche zu nennen, es sind allgemein gültige Worte, die eigentlich jedem Mönchsvater in den Mund gelegt werden können.
Bei Abbas Poimen sind etwa 75 solcher Logien zu finden, was ungefähr ein Drittel des Materials ausmacht. Dies spricht, so K.S. Frank, für das Ansehen des Mönchsvaters, denn anonym überlieferte Worte wurden offensichtlich ihm zugeschrieben, neuerfundene Worte wurden mit seiner Autorität versehen.117 In diesen Logien heißt es dann einfach: „Abbas Poimen sprach“118 oder „wiederum sagte er“119.
H. Dörries bemerkt sehr richtig, daß diese Worte formal durch die fehlende Frage von den so benannten Heilsworten, inhaltlich jedoch kaum von diesen zu unterscheiden seien.120
I.1.D.b.γ. Gleichniserzählungen
Anhand von erzählten bildhaften Geschichten oder demonstrativen Aktionen von Altvätern, die wiederum auch erzählt werden, wird eine Lehre erteilt121, z. T. in allegorischer Form122.
I.1.D.c. Schriftbezug123
Einige Apophthegmata beschäftigen sich mit der Schrift, bringen ein Schriftzitat oder eine kurze Schriftdeutung.124 Diese sind nicht sehr häufig, was verschiedene Gründe hat. Viele der Mönche waren des Lesens nicht kundig, Bücher oder Handschriften waren selten und teuer125, so daß der Verzicht auf diesen kostbaren Besitz um der Armut willen empfohlen wurde.126
Die Psalmen waren den Mönchen natürlich vertraut und sicher Stücke aus der Schrift, die bei den Gottesdiensten vorgetragen wurden. In einigen Apophthegmata gibt es gewisse Vorbehalte bezüglich des Schriftstudiums bzw. des Sprechens über die Schrift127, allerdings findet sich auch die gegenteilige Meinung. Von Abbas bzw. Bischof Epiphanios etwa wird berichtet:
„Wiederum sagte er [Epiphanios]: ‘Der Besitz christlicher Bibeln ist denen notwendig, die sie haben. Denn schon das bloße Anschauen der Bibel allein macht uns zögernder gegenüber der Sünde, und sie leitet uns an, uns mehr der Gerechtigkeit zuzuwenden.’ “ (Epiphanios 8)(Apo 203).
„Auch das sagte er: ‘Große Sicherheit gegen die Sünde ist das Lesen der heiligen Schriften.’ “ (Epiphanios 9)(Apo 204)
„Ebenso sagte er: ‘Ein jäher Abhang und ein tiefer Abgrund ist die Unkenntnis der Schrift.’ “ (Epiphanios 10)(Apo 205).128
Die Schrift taucht auf im Zusammenhang mit der „Meditation“ der Wüstenväter, auch wenn die Stellen nicht sehr zahlreich und ergiebig sind.129 Abbas Poimen betont:
„Die Natur des Wassers ist weich, die des Steines hart - aber der Behälter, der über dem Steine hängt, läßt Tropfen um Tropfen fallen und durchlöchert den Stein. So ist auch das Wort Gottes weich, unser Herz aber hart. Wenn nun aber der Mensch oft das Wort Gottes hört, dann öffnet sich sein Herz für die Gottesfurcht.“ (Poimen 183)(Apo 757)
Meditation meint demnach die ständige Wiederholung von Schriftworten, das Wiederkäuen der Schrift und zwar halblaut vor sich hin gesprochen.130
G. Gould machte darauf aufmerksam, daß die Auslegung der Schrift zu den Hauptaufgaben des Altvaters gehört und bis in die frühesten Schichten der Apophthegmata nachgewiesen werden kann.131
D. Burton-Christie folgt dieser Einschätzung in seiner Studie und verdeutlicht, daß in allen Schichten des Textes „patterns of biblical events and phraseology were transformed into the structure and language of monastic experience.“132
Für den Schüler konnte die Schrift oft „kaum Antwort geben auf die alltäglichen Fragen eines Anachoreten in der Wüste. Diese Antworten wurden erst aus der Erfahrung beispielhafter Mönche möglich.“133
Für die Wüstenväter war das Wort der Schrift nicht einfach geschriebenes bzw. zu lesendes Wort, sondern und besonders ein gesprochenes, ein gehörtes und gelebtes bzw. zu lebendes Wort. Sehr eindrücklich wird dies in der Stellungnahme eines Mönches, die Evagrios Pontikos überliefert:
„Alles, was einer der Mönche besaß, war ein Neues Testament. Das verkaufte er und gab das Geld den Armen. Seine Erklärung dazu verdient, nicht vergessen zu werden: ‘Ich habe genau das Wort verkauft, das da lautet, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen.“134
Zusammenfassend kann man sagen, daß die Väter es ablehnten, theoretisch und spekulativ über die Schrift zu sprechen, weil es die praktischen Konsequenzen des Schrifttextes waren, deren Erforschung sie interessierte.135