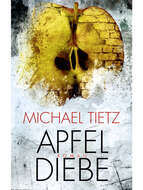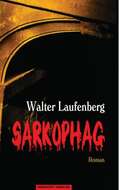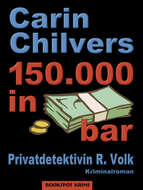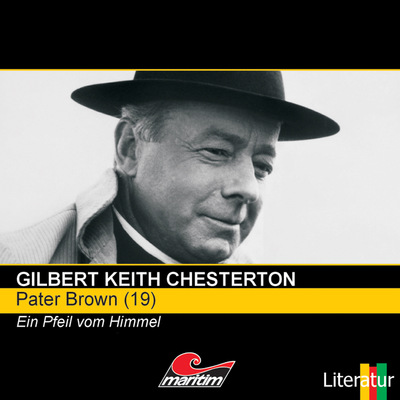Kitabı oku: «Rattentanz», sayfa 10
15
15:43 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Aufzug 2
Thomas Bachmann war durch steinerne Wände und Stahl vom Rest der Welt getrennt. Er spürte in der Abgeschiedenheit seiner Kabine Angst und Unsicherheit, spürte, dass da draußen wilde Panik um sich griff. Hinter seinem schützenden Vorhang hörte er Stimmen vorüberhasten. Das Trampeln schneller Schritte. Die Wesen da draußen (waren es Menschen?), sie hatten Angst.
Angst vor was?
Sie hatten die unproduktive Angst, die Angst, die den Ängstlichen verharren lässt und einsam macht. Thomas spürte deutlich, dass es sich um eine egoistische Angst handelte, destruktiv, zerstörerisch und böse. Würde sie den Weg zu ihm finden? Sie war schon ganz nah gewesen, diese Angst, vorhin, nach den Schreien. Da hätte sie ihn beinahe gefunden. Aber etwas musste sie weggelockt haben, hin zu einem fetteren Opfer, fort von ihm.
Thomas hatte einen Schluck Tee getrunken.
Komm, hihi, trink aus! Mach’s leer, es reicht ja doch nicht für die Ewigkeit! Jaaa, trink, trink schneller, schneller, umso schneller ist unser Leiden vorbei.
Er hatte Nummer drei gefolgt und getrunken, zuerst langsam Schluck für Schluck, abgesetzt und gewartet. Aber sein Durst war nicht geringer geworden, im Gegenteil! Und so hatte er den Inhalt der kleinen Thermoskanne hemmungslos runtergestürzt. Nun, mit dem Wissen nichts mehr zu haben, war der Durst nur noch schlimmer. Wie lange dauerte es, bis man verdurstete? Drei Tage oder fünf?
Für Thomas roch der Aufzug nach Tod und Verwesung. Am Morgen, als Lastenaufzug 2 stecken geblieben war, hing dieser Geruch noch nicht in der Luft.
Tod. Riecht der Tod? Riecht er so? Würde er selbst – Thomas Bachmann – einmal so riechen? Oder das, was von ihm später einmal übrig bliebe?
Wenn jemand in zehn oder hundert Jahren diesen Aufzug öffnet, ist nichts weiter von dir übrig als ein Häufchen blanker Knochen! Ach, wäre es doch schon so weit, wären wir doch endlich tot!
Thomas hatte seine schwarze Aktentasche ganz nah an sich herangezogen. Sie besaß einen silbernen Verschluss, so einen, den man mit dem Finger hineindrücken musste, damit sie sich öffnete. Er drückte und hörte unmittelbar darauf das willige Klicken, mit dem sie aufsprang. Aber ebenso leer wie seine Thermoskanne war auch Thomas’ Tasche. Er tastete nichts in ihr, keine Wurstbrote, kein Taschentuch, keine Taschenlampe, noch nicht einmal ein Feuerzeug.
Wozu ein Feuerzeug? Nummer zwei war da. Willst du dir beim Sterben zusehen? Vielleicht noch alles in Brand setzen?
Was soll hier schon brennen, knurrte Nummer eins.
Thomas freute sich, ihn zu hören. Nummer eins beruhigte das kleine Kind in Thomas ein wenig, betrog die Wirklichkeit mit dem Gefühl der Sicherheit.
Sicherheit? In seiner Situation?
Aber es war genau so und wäre er jetzt mit den anderen beiden Stim men allein gewesen, ohne dass ab und zu mal jemand in seinem Kopf für Ordnung sorgte, hätten ihn Angst und Wahnsinn mit Bestimmtheit längst aufgefressen. So wie es damals beinahe geschehen wäre, als er zum ersten Mal Nummer zwei hörte. Das war der peinlichste Moment seines Lebens.
Mit elf Jahren hatte seine Umgebung, vor allem seine Eltern und mehrere Lehrer, den Eindruck, dass er mit einer gehörigen Portion Medikamente vielleicht besser funktionieren und eher dem Bild eines normalen Elfjährigen entsprechen könnte. Wenn sie unter »normal« Antriebslosigkeit, Übelkeit und diese unendliche Müdigkeit meinten, die ihn jeden Tag so gegen zehn überfiel, dann hatten sie ihre Vorstel lungen wunderbar umsetzen können. Aber das, so erklärte ein Arzt seiner Mutter, waren nur Nebenwirkungen der Medikamente, die Thomas irgendwann in einen ganz normalen Menschen verwandeln sollten. Irgendwann!
Wohl wieder eine Nebenwirkung, setzte die Pubertät bei ihm erst mit siebzehn ein und dies auch erst, nachdem eines der Mittelchen, die er täglich viermal schlucken durfte, kurzzeitig abgesetzt war. Plötzlich veränderten sich seine Stimme und sein Körperbau, begannen Haare an den unmöglichsten Stellen zu wachsen und, wie er vollkommen irritiert entdeckte, wuchs auch etwas anderes an ihm. Wenn er ihn anfasste, zum Wasserlassen oder im Bad, fühlte es sich mit einem Mal vollkommen anders an. Es kitzelte, aber es war nicht das quälende Kitzeln der Mädchen aus seiner Nachbarschaft, die ihn, den kleinen und schmächtigen mit der hohen Stimme, packten und hinter einen Busch zerrten. Zu zweit oder dritt hielten sie ihn, während eine ihn kitzeln durfte, bis er weinte.
Nein, dieses neu entdeckte Kitzeln war anders, angenehm. Und warm war es. Und es zog sich von dieser einen Stelle bis in die Haarspitzen und − andere Richtung − zu den Zehen. Es war schön. Es war so schön, dass er sich manchmal abends im Bett, in den wenigen Minuten, die ihm blieben, bevor die Medikamente ihn mit bleiernem Schlaf ausgossen, leise berührte.
Und eines Abends war es so weit: Etwas Unbekanntes ergoss sich aus ihm, es schoss heraus und hinterließ einen großen, klebrigen Fleck auf dem Laken.
Wenn das Mutter sieht!, zeterte da zum ersten Mal Nummer zwei. Lass ihn doch.
Ja, riechst du das! Na, wie riecht das? Wie Käse oder vielleicht wie Salami? Und es hinterlässt große, hässliche Flecke, die können das ganze Bett ruinieren, ja vielleicht sogar Löcher hineinätzen?
Hör auf!, grummelte Nummer eins, eher amüsiert denn böse.
Aber für Thomas verband sich seither, wenn er Nummer zwei schimpfen und abwägen hörte, ihre Stimme mit dem unangenehmen Gefühl dieses Abends. Sie hatte ihn erwischt, auf frischer Tat ertappt. Und es hatte Jahre gedauert, bis er keine Angst mehr vorm Erblinden hatte. Davon kann man blind werden, blind wie ein Maulwurf! Warum waren Maulwürfe blind?
Es war nie wieder passiert. Aus Angst vorm Erblinden und weil er seine alten Medikamente irgendwann wieder nehmen musste. Und diese Medikamente vertrieben zielgerichtet jedes angenehme Kitzeln aus seinem Körper. Vielleicht waren sie auch nur deshalb da.
16
15:44 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Intensivstation
Was ihm zu schaffen machte, war weniger, wie der Tote sich anfühlte als das Wissen, dass es ein Toter war. Obwohl – als er darüber nachzudenken begann …
Unter dem Bettlaken, mit dem Eva die Leiche und Beck abgedeckt hatte, verschwammen die Geräusche der Station. Das Zischen der Beatmungsmaschinen, die Sauerstoff in kranke Lungen pressten, piepsen de Geräte und Pumpen, dazwischen das Stöhnen von Verletzten sowie Stillers Anordnungen, die er Augenblicke später revidierte, waberten durcheinander. Einzig Ritters Stimme war laut und deutlich zu vernehmen.
»Wo ist dieser Stiller, verdammt noch mal!«
Beck, etwa einen Kopf kleiner als der hochgewachsene, hagere Tote neben ihm, lag mit dem Kopf halb unter dessen Schulter. Seinen Rücken drückte er gegen ihn, die Beine hielt er leicht angewinkelt und unter den verstorbenen Beinen versteckt. Für einen Unwissenden war von außen nichts Auffälliges zu entdecken; da lag nur ein stattlicher Herr, soeben verschieden, und wartete auf seinen Abtransport, wohin auch immer.
Der Beckenkamm der Leiche drückte in Becks Rücken. Genau gegen die Wirbelsäule. Und unter seinem Arm roch es nach bitterem, kaltem Schweiß, den er im Sterben noch versprüht haben musste. Der Mann, der den herrlichen Maimorgen hatte nutzen wollen und mit seiner Frau zu einer Fahrt nach Schaffhausen an den Rheinfall aufgebrochen war, wurde zufällig fast unmittelbar vor den Toren der Klinik Opfer eines Handynutzers, der, einen Moment abgelenkt, die bestehenden Vorfahrtsregeln missachtete und in den ältlichen Ford des Rentnerehepaares krachte. Die Frau war sofort tot (»Der Gurt schnürt mich immer so ein. Ich bekomme da drin keine Luft, Liebling. Ich lass ihn heute mal weg.«). Er wurde vom Unfallverursacher in die Klinik getragen und einem Arzt übergeben. Der Unfallverursacher hatte dem Unfallopfer seine eigene Jacke um den Bauch gewickelt und so die hervorquellenden Därme bis zur Notaufnahme zurückhalten können. Und sich erbrochen.
»Stiller!«
»Ja, was ist denn los?« Der Stress ließ Dr. Stiller blass und kränklich aussehen. Seine Augen standen weit hervor. Mit wedelnden Armen stand er auf dem Flur. Gollum! Er strich sich mit seiner in einem Gummihandschuh steckenden Rechten die dünnen Haare aus der Stirn.
»Brüllen Sie hier so rum?« Wie ein wütender Terrier kläffte er Ritter und seine Kumpane an. »Was wollen Sie?«
»Wo ist der Polizist?« Ritter kam ohne Umschweife zur Sache. Er sah Stiller an, kalte Herausforderung blitzte in seinen Augen. Er wartete auf Stillers Antwort, aber er würde bestimmt nicht lange warten.
»Was für ein Polizist? Hier war keiner, hier ist keiner und«, er machte auf den Absätzen kehrt, »es wird sicher auch keiner kommen Leider.«
»Halt!«, brüllte Ritter. Mario und Mehmet schnitten Stiller den Weg ab und bauten sich vor ihm auf. Mehmet hielt seine P7 deutlich sichtbar. »Entweder, du sagst mir jetzt, was ich wissen will, oder ich mach Kleinholz aus dir! Wäre dir das recht, he?«
Stiller starrte in die Waffe. Er hatte noch niemals zuvor eine Pistole gesehen, außer im Fernsehen. War die echt? Waren die Männer echt? Einen kurzen Moment dachte er an einen Streich und eine versteckte Kamera, aber dann überzeugten ihn die Augen der Männer von der Wahrheit. Er war kein Mann, der für Ideale, geschweige denn für andere Menschen, seine Gesundheit riskieren wollte. Der Gedanke an Widerstand kam ihm nicht einmal. Er überlegte nur, wo der Gesuchte hin sein konnte. Er wollte alles sagen.
Angesichts der drohenden Übermacht stand Stiller mit hängenden Schultern und unterwürfigem Blick zwischen den Männern. Der kläffende Terrier zog den Schwanz ein und winselte: »Aber Sie können mir glauben, hier war kein Polizist. Und wenn, würde ich es Ihnen sagen. Sie haben sicher wichtige Gründe, ihn zu suchen.«
»Das haben wir«, lachte Ritter.
»Vielleicht hat er ihn auch nicht erkannt?« Hermann Fuchs, der sich bis jetzt im Hintergrund gehalten hatte, kam an Ritters Seite. »Wie du erzählt hast, sah er ja nach deiner Unterhaltung mit ihm nicht mehr so gesund aus.«
»Stimmt.« Ritter klopfte dem ehemaligen Sozialhilfeempfänger anerkennend auf die Schulter und humpelte einen weiteren Schritt auf Stiller zu. Jetzt standen sie alle genau vor der weit offenen Schiebetür zu Becks doppelt belegtem Bett.
»Der Bulle ist klein und mickrig, so wie du ungefähr, Doktorchen. Mit so ’nem Möchtegernbärtchen um den Mund. Nase und ein Auge waren Matsch.«
Stiller schluckte, er war es gewohnt zu schlucken. Und, irgendwann einmal, sich dann an alles zu erinnern und zurückzugeben. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
»Ja, der war hier.«
Ritter packte den Arzt und schüttelte ihn. »Und wo ist er jetzt, he? Wo hast du ihn versteckt?«
Stiller versuchte sich dem Schraubstockgriff zu entwinden. »Nein, ich habe ihn nicht versteckt! Ihr müsst ihm doch begegnet sein!«, quiekte er. »Ich hab ihn in die Ambulanz runtergeschickt, weil hier alles voll ist und weil …«
»Wir kommen aus der Ambulanz, kleiner Mann!« Ritters Gesicht kam näher. »Wo könnte er hin? Uns ist er jedenfalls nicht begegnet. Habt ihr einen Notausgang?«
Stiller nickte und zeigte ans andere Ende des Flurs, wo hinter einer wuchtigen Glastür eine Stahltreppe lag. Der offizielle Fluchtweg, wenn auch keiner wusste, wie schwerstkranke Patienten, beatmet und im Koma, über diese Treppe gerettet werden sollten.
»Aber da ist keiner raus. Wir haben vor einer Stunde abgeschlossen, weil Leute hier rein wollten und …«
»Überprüf das!« Ritter nickte Mehmet zu. Dann kümmerte er sich wieder um Stiller: »Da er uns nicht entgegenkam, der einzige Fluchtweg abgeschlossen ist und da er sich ja auch nicht in Luft aufgelöst haben kann, muss der Bulle also noch irgendwo hier sein.«
Stiller zitterte.
»Niemand verlässt den Laden hier!«, brüllte Ritter. »Ihr zwei«, er zeigte auf Mario und Fuchs, »ihr bewacht den Ausgang und wir«, er nahm Mehmet in den Arm, »wir werden mal schauen, ob wir unseren lieben kleinen Bullen hier nicht irgendwo finden. Weißt du, Doktorchen, der Drecksack hat mir eine Scherbe ins Bein gestochen.« Er zeigte stolz auf seinen breiten Verband. »Und sollte ich ihn hier entdecken, hieße das, dass du mich angelogen hast. Was meinst du wohl, was ich dann mit dir mache, he?«
»Aber glauben Sie mir doch, ich wüsste, wenn er sich hier versteckt halten würde. Ich leite doch hier alles!«
Beck hatte fast alles mithören können. Eva, die noch immer vor dem Bett mit der Leiche und Joachim Beck stand, war nervös. Ihr Äußeres drückte zwar Selbstsicherheit aus, aber in ihr sah es ganz anders aus. Ritter und Mehmet durchsuchten systematisch jedes Patientenzim mer. Sie öffneten jeden Schrank, warfen Wäschestapel aus ihren Fächern und sahen unter Bettdecken nach.
Da wurde die Eingangstür auf- und Fuchs, der sich neben Mario wichtig aufgebaut hatte, in den Rücken gestoßen. Ein Arzt und ein Pfleger, beide in grüne Kittel gehüllt und mit Mundschutz und Haube, brachten einen weiteren Patienten aus dem OP.
»Gehen Sie aus dem Weg!«, fuhr der Arzt die Wächter an und wollte weiterfahren, als Fuchs ihn zur Seite riss und das Bett stoppte.
»Hier ist geschlossen!«, fauchte er.
»Richtig!«, pflichtete ihm Mario bei und begann das Bett zurückzuschieben. Der Pfleger, am Fußende, hielt dagegen.
»Aber die Frau muss auf die Intensivstation! Sonst stirbt sie!« Der Arzt versuchte Fuchs abzuschütteln, als dieser sein Maschinengewehr unter dem Mantel hervorholte und dem Mediziner an den grünen Mundschutz hielt.
»Wenn ihr hier nicht schleunigst verschwindet, dann puste ich dir ein schönes großes Loch in deinen Mundschutz. Dann brauchst du den zum Essen wenigstens nicht mehr abzunehmen!« Fuchs lachte und zeigte seine gelben Zahnstummel.
»Wir werden die Polizei holen!«, drohte der Arzt. Es war eine gewohnheitsmäßige Drohung und das überlegene Lachen der beiden Männer holte ihn in die neue Realität zurück.
»Willst du etwa anrufen? Na mach doch«, höhnte Fuchs. »Selbst wenn es im Revier klingeln sollte, bezweifle ich, dass noch einer rangehen kann.«
Damit schoben sie das Bett endgültig zurück, schlossen die Tür und widmeten sich erneut der Untersuchung der Station. Ritter hatte inzwischen seine Runde fast abgeschlossen. Er humpelte in das letzte verbleibende Patientenzimmer, in dem eine Frau mit weit aufgerissenen Augen abwechselnd den Eingang und einen Monitor mit ihrer eigenen unregelmäßigen EKG-Kurve taxierte. Von Eva abgesehen war sie die Einzige, die wusste, wo sich der Gesuchte befand. Eva tat so, als würde sie gerade letzte Handgriffe an dem Verstorbenen erledigen.
Mehmet riss auch hier die Schränke auf und warf, obwohl inzwischen selbst er eingesehen haben musste, dass in deren winzigen Fächern kein Erwachsener ein Versteck finden konnte, die Wäsche auf den Boden. Er hatte seinen Spaß! Ritter stand zwischen den beiden Betten und hob am Fußende die Decke der Herzinfarktpatientin an. Die zog erschrocken die Beine an.
»Keine Angst, Oma.« Ritter spielte mäßig den Charmanten. »Ich guck dir schon nix weg.« Dann wandte er sich Becks Bett zu. Er griff nach dem Laken und wollte es gerade anheben, als Eva ihm den Zipfel sanft aus der Hand nahm, sich deutlich sichtbar bekreuzigte und das Laken glatt strich.
»Gerade gestorben.« Ihre Stimme war belegt und sie flüsterte.
»Mausetot?«, wollte Ritter wissen und ging ans Kopfende. Eva nickte. Ritter und sie standen beide auf der Seite zum Fenster hin, die Seite, auf der Joachim Beck lag. Mehmet kam neugierig heran.
»Zeig mal!« Mehmet streckte seine braunen Finger nach dem schneeweißen Laken aus.
»Finger weg!«, zischte Eva. Und noch bevor Mehmet das Laken herunterreißen konnte, was er eigentlich vorhatte, schlug Eva das Tuch zurück und das friedliche Gesicht eines Toten war zu sehen.
Lieber Gott. Mach, dass sie den Mann nicht entdecken. Beschützte mich bitte. Und beschütze Lea und Hans und das Baby. Bitte mach, dass alles vorbeigeht! Bitte! Mach alles wieder normal …
Beck wartete auf das Ende. Sie mussten ihn sehen! Sie mussten sehen, wie das Laken zitterte, wie das ganze Bett wackelte! Konnte man es nicht schon hören? Hörten sie seine klappernden Zähne? Er presste die Kiefer zusammen, schmiegte sich gegen und halb unter die Leiche. Es stank unter der Decke, stank nach Eisen im Blut, nach Urin und trocknendem Schweiß. Er würde sich übergeben! Nicht nachher, nicht später. Nein jetzt, in diesem Augenblick würde es aus ihm herausbrechen und sie würden ihn entdecken und töten. Beck hielt die Augen fest geschlossen. Winzige Lichtpunkte tanzten vor seinen Pupillen und draußen, vor dem Bett, lauerte der Tod. Der Tod, neben dem er bereits lag, an den er sich schmiegte wie frisch verliebt. Sollte er aufspringen? Hätte er eine Chance, wäre das Überraschungsmoment auf seiner Seite? Aber nein, sie sind zu zweit, einer rechts, einer links. Es stank! Er wollte sich übergeben! Bitte!
Da, sein Fuß hatte gezuckt! Er hatte sich bewegt, unwillkürlich, vielleicht Reaktion der zum Bersten gespannten Muskulatur. Hatten sie es gesehen?
»Okay. Der scheint hinüber.« Ritter wendete sich ab und humpelte zur Tür. In seinem Gesicht spiegelten sich Enttäuschung und das schmerzende Bein. »Wo könnte er sonst noch sein? Vielleicht im OP?«
Stiller zuckte mit den Achseln.
Ritter gab seinen beiden Türstehern das Zeichen zum Aufbruch. »Scheint wirklich nicht da zu sein.«
Mehmet stand noch immer vor dem Bett mit Beck. Eva beobachtete ihn aus den Augenwinkeln und hantierte mit einer Klemme. Er wird meine Nervosität bemerken, wird sehen, was ich tue und wie blödsinnig es ist. Aber Mehmet hatte nur Augen für das Laken, unter dem sich die Konturen der Leiche abzeichneten. Seine Augen hatten einen seltsamen Glanz bekommen, wie bei einem Kind, das ein neues Spiel entdeckt und überlegt, wie es wohl funktioniert. Nur die Kälte in seinem Blick verriet, dass er längst kein Kind mehr war.
Ein neues Spiel.
»Der Typ ist völlig im Eimer?«, fragte er, ohne dabei jemanden anzusehen. owohl Eva als auch Ritter, der noch auf dem Flur stand, nickten. »Ja«, antworteten sie wie abgesprochen.
»Und dann merkt der auch nix mehr, oder?«
»Nein, verdammt. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Wir müssen weiter.«
»Cool. Dann wird er das auch nicht merken!« und bevor Eva eingreifen konnte, hatte Mehmet Becks alte Dienstwaffe gezogen und dreimal auf das Bett gefeuert. Das EKG der Frau gegenüber begann nun völlig außer Kontrolle zu geraten und auf dem Flur schrien Menschen. Stiller trieben die Schüsse unter ein Patientenbett, wo er sich zusammenrollte und die Ohren zuhielt.
»Du Idiot!«, schrie Ritter und packte den Jungen am Arm. »Musst du wirklich jeden auf uns aufmerksam machen, he? Mach jetzt, dass du rauskommst!« Mit diebischer Freude im Gesicht kam Mehmet Ritters Befehl nach.
»Die nehm ich lieber«, meinte Ritter und nahm Mehmet die Pistole weg.
Die Projektile hatten in Höhe von Kopf, Bauch und noch etwas tiefer kleine Löcher in das Leichentuch gerissen.
17
16:17 Uhr, Wellendingen
Assauers Erscheinen hatte die Versammlung im Gasthaus Krone beendet. Durch den unvermuteten Fund ermutigt, wollten einige die Suche nach Überlebenden umgehend fortsetzen. Andere zog es in ihre Häuser, um dort nach dem Rechten zu sehen.
»Es ist ein Wunder, dass er fast völlig unverletzt überlebt hat!« Susanne Faust hatte das Blut an Händen und Unterarmen des Mannes behutsam abgewaschen, aber außer einigen unbedeutenden Prellungen und kleineren Schürfwunden keine weiteren Verletzungen gefunden. Assauer ließ alles teilnahmslos mit sich geschehen.
»Das Blut muss von dem Jungen sein«, erklärte jetzt Bubi. »Er hielt ein totes Kind in den Armen, dem irgendwas den ganzen Nacken aufgerissen hat.«
Fantastische Bilder!
Als die Maschine über das Feld schlitterte, saß Assauer angeschnallt und mit seinem Enkel in den Armen in seinem Sessel. Die Verankerung des Sessels brach und katapultierte sie aus dem Loch im Rumpf der Maschine. Sie überschlugen sich sieben oder acht Mal. Schon beim ersten Aufprall schlug Kevins Nacken gegen einen Felsbrocken, den die sich in das Feld fressende Maschine ausgegraben hatte. Kevin war sofort tot. Sein Genick fing die ganze Gewalt des Zusammenstoßes ab und brach. So rettete er seinem Großvater das Leben.
»Was soll jetzt aus ihm werden?« Hildegund Teufel kam mit ihren klappernden Stöcken heran und betrachtete den Mann. Er tat ihr leid. »Er muss irgendwo hin. Vielleicht ins Krankenhaus nach Stühlingen?«
Faust schüttelte den Kopf. »Selbst wenn wir die paar Kilometer schaffen, bezweifle ich, dass sich dort jemand um ihn kümmern will. Schließlich fehlt ihm nichts.«
»Von dem Schock mal abgesehen«, ergänzte Susanne. Provisorisch verband sie die Unterarme des Fremden.
»Aber hier kann er nicht bleiben.« Berthold Winterhalder kam dazu und blieb mit verschränkten Armen neben Faust stehen.
»Wieso eigentlich nicht?«, fragte der. »Ihr vermietet doch Fremdenzimmer.«
Der Wirt nickte. »Das schon. Aber der sieht nicht aus, als ob er ein Zimmer bezahlen kann. Außerdem wird er auch essen und trinken wol len und wer weiß schon, wann alles wieder normal funktioniert. Nein, nein«, er schüttelte den Kopf, »wenn er oder irgendwer sonst für ihn bezahlen kann, von mir aus, aber so?«
»Lasst nur«, Susanne war mit dem Verband fertig und richtete sich auf, »wir nehmen ihn mit zu uns, nicht war, Lea?« Die Siebenjährige nickte.
»Oh ja. Er kann in meinem Bett schlafen!«
»Langsam, langsam!«, fuhr Faust dazwischen. Susanne zuckte zusammen. »Ich habe da sicher auch noch ein Wörtchen mitzureden!«
»Lass sie doch, Vater«, Bubi hoffte auf noch mehr Fotos, vielleicht ein Interview. »Bis wir jemanden anrufen können, der den Alten abholt, kann er doch bei uns bleiben. Die zwei Tage.«
Faust sah sich um. War denn keiner hier, der den Abgestürzten mitnehmen wollte? Aber nach der ersten Begeisterung über den Geretteten hatte sich die Menschentraube vor dem Gasthaus zügig aufgelöst. Die wenigen, die noch herumstanden, zerstreuten sich jetzt.
»Bitte, Onkel Frieder!«, bettelte Lea. »Er hat bestimmt Hunger. Und er ist doch ganz allein.«
So wie du, dachte Faust und sah sich um. Von Leas Mutter keine Spur.
Faust musterte Assauer. Fausts Haus war groß genug, der Fremde könnte diese eine Nacht im Gästezimmer schlafen. Spätestens der kommende Tag, wusste Faust, würde Klarheit bringen. Klarheit über das, was hier eigentlich geschah, über die Verantwortlichen und wer für alles geradezustehen hatte. Und den Fremden würde man dann den Rettungskräften übergeben.
»Also gut.« Lea hüpfte ausgelassen um Assauer herum.
»Wenn Mama kommt, nehmen wir ihn mit zu uns! Dann darf er in meinem Bett schlafen!«
»Und wo willst du dich verkriechen, du Zwerg?«, fragte Bubi.
»Ich schlaf in Papas Bett. Papa kommt erst morgen zurück. Er bringt mir Muscheln mit.«
»Wo ist dein Papa?«, fragte Martin Kiefer, Evas erster Mann. Er hatte bisher etwas abseits gestanden und sich aufs Zuhören beschränkt.
»Papa ist in Schweden. Er kauft gaaanz viele Fische. Und für mich Muscheln.«
Faust nahm Assauers Arm. Ohne Widerstand, ohne eine Regung, ließ der sich zu Fausts Pick-up führen und stieg ein.
»Was kochst du, Susanne? Ich hab solchen Hunger!«
Bubi und sein Vater brachten Assauer in die Küche und drückten ihn auf einen Stuhl. Susanne folgte den Männern und sah sich um. War dies hier wirklich ihre Küche?! So wie jetzt hatte die Küche noch nie ausgesehen! Sie hatte gemeinsam mit Lea das Haus kurz nach dem ersten Flugzeugabsturz verlassen und war seitdem nicht wieder hier gewesen. Im Spülbecken stapelte sich noch das Frühstücksgeschirr und vor dem riesigen Kühlschrank hatte sich eine große Wasserlache gebildet. Faust und Bubi hatten den Fremden mitten durch diese Lache geführt und nur zu gern, so schien es, löste das Wasser den Schmutz aus dessen Schuhsohlen.
Ohne sich weiter um die Menschen in ihrem Haus zu kümmern, packte Susanne einen Lappen, ging auf die Knie und rutschte über den Küchenboden. Die braunen Schuhabdrücke verschwanden und langsam ging es ihr wieder besser. Peinlich, einen Fremden in eine solche Küche zu führen! So etwas war ihr noch nie passiert!
Am Küchentisch angekommen, zog sie Eckard Assauer die Schuhe aus und trug sie vor das Haus in die Sonne.
»Machst du mir ein Brot, Onkel Frieder?«, fragte Lea. Sie hatte wie die anderen seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.
»Ich mach dir gleich etwas«, sagte Susanne als sie zurückkam.
»Wollt ihr auch etwas?«
»Lass das mit den Broten«, entgegnete Faust. »Wir haben noch Fleisch im Gefrierschrank im Keller. Das muss jetzt weg, bevor es verdirbt.«
Susanne ging zum Herd und probierte die einzelnen Schalter aus. An und aus, an und aus, als erinnere sie dieses Ritual an eine bessere Zeit.
»Ich werf’ den Grill schon mal an«, sagte Faust. Seine Frau nickte und ließ den Herd in Ruhe.
»Wie heißt der Mann, Susanne? Darf ich Opa zu ihm sagen? Oder Onkel?«
»Wir wissen nicht, wie er heißt«, antwortete stattdessen Bubi. Er hat te eine Flasche Wasser vor sich und betrachtete stolz die Bilder im klei nen Display seiner Kamera. Er war zum ersten Mal in seinem Leben wirklich stolz auf sich! Heute hatte er etwas vollbracht, etwas wirk lich Einmaliges und Großes! »Er hat weder Papiere noch einen Reisepass bei sich. Wahrscheinlich kann er nicht einmal unsere Sprache.«
»Ist doch egal, wie der Mann heißt«, sagte Susanne. »Es gibt nun wirklich Wichtigeres.« Sie leerte zwei Flaschen Mineralwasser in das Spülbecken und begann das Geschirr vom Morgen zu reinigen.
»Wirklich Wichtigeres.«
»Dann sag ich eben Opa zu ihm«, entschied Lea. Sie setzte sich ihm gegenüber, stützte das Gesicht in beide Hände und betrachtete Assauer.
»Aber du hast doch schon zwei Opas«, murmelte Bubi. »Wie heißen sie?«
»Opa Willi und Opa Gerhard. Aber die sind nie da. Und sie erzählen mir auch nie eine Geschichte.«
Evas Eltern waren vor vier Jahren an den Bodensee gezogen. Altersruhesitz, mein Kindchen. Da ist das Klima um so vieles angenehmer als hier oben in den Bergen. Eva hatte es nicht bedauert.
»Der sieht aber auch nicht gerade so aus, als ob er dir viele Geschichten erzählen will«, sagte Bubi. Das Bild des weinenden Assauers, mit seinem Enkel im Arm und den Flugzeugtrümmern im Hintergrund, war das Beste. Reif für ein Titelbild.
Susanne hatte den Abwasch bewältigt und ging auf die Toilette. Während sie dort saß, fiel ihr Blick auf die heutige Zeitung, die ihr Mann nach dem Frühstück immer mit hierher nahm und dann liegen ließ. 23. Mai, las sie. Dieses Datum wird also jetzt für immer mit den Flugzeugkatastrophen in Verbindung stehen. Und mit dem Tag, an dem der Strom ausfiel. »Und das Wasser!«, murmelte sie, als sie spülen wollte.
»Oder wie wäre es mit Samson?« Lea hielt den Kopf schräg und betrachtete ihr Gegenüber. Dessen Blick ging ins Leere. Lea sprang vom Stuhl und stellte sich vor Assauer, hoffte, dass er sie doch noch wahrnahm und seine Pupillen bewegte. Aber umsonst, er sah durch das Mädchen hindurch als wäre sie ein Geist, ein Schatten am Abend.
»Ich bitte dich, Lea! Samson!«, rief Susanne aus dem Bad, wo sie sich kämmte. »Er ist doch kein Zottelbär aus dem Fernsehen!«
»Dann vielleicht Freitag? So wie in der Geschichte von Robinson, die Papa mir erzähl …« Lea brach mitten im Satz ab. Sie schlug beide Hände vor den Mund und schluckte schuldbewusst. Ihre Ohren glühten. Papa hatte gesagt, dies sei ihr beider Geheimnis, denn Mama würde wahrscheinlich ein bisschen schimpfen, wegen der Kannibalen und so.
»Was? Dein Papa erzählt dir Robinson Crusoe? Bist du dafür nicht noch ein bisschen zu klein?«
»Nein. Außerdem hat er das mit den Menschenfressern weggelassen!« Oje, nächster Fehler!
»Oh ihr zwei«, schimpfte Susanne mit gespielter Entrüstung. Es ging sie nichts an, was ihr Nachbar seinem Kind für Geschichten erzählte. Das war deren Sache. Trotzdem fand sie, dass man einer Siebenjährigen nicht unbedingt diese Geschichte erzählen musste. Sie kannte sie selbst nur aus dem Fernsehen, Bücher gab es in ihrem und Frieders Haus keine. »Dein Vater behandelt dich wie einen Jungen«, sagte Susanne und hatte damit nicht ganz unrecht. Hans Seger hatte sich immer einen Sohn gewünscht, einen Lausbuben mit Zahnlücke und wildem Haar, aufgeschlagenen Knien und jedem Tag einen anderen Streich im Kopf. Und so behandelte er Lea tatsächlich oft wie einen Jungen, erzählte ihr von Tom Sawyer und Huck Finn und ihren Abenteuern mit Indianer-Joe. Meist schlief Lea dabei ein oder spielte mit einer Puppe. Aber (Achtung: Wichtig!) Papa war da!
»Freitag?«, fragte Lea noch einmal, nachdem Susanne und Bubi ihr versprochen hatten, nichts von ihrem Geheimnis am Abend an Leas Mutter weiterzusagen.
»Heute ist Mittwoch, Zwerg. Wenn, dann müsstest du ihn Mittwoch nennen und das klingt blöd, oder?«
»Onkel Mittwoch?«
Susanne schüttelte den Kopf.
»Herr Mittwoch! Bitte, Susanne!«, jubelte Lea und tanzte um den Küchentisch. »Wir nennen ihn Herr Mittwoch, nur bis er wieder sprechen kann! Bitte, bitte!«, flehte sie und klammerte sich an Susannes Bein.
»Wir fragen Onkel Frieder, was er dazu meint. Und Bubi, der hat ihn schließlich gerettet.«
»Is mir egal, wie ihr ihn nennt. Is mir ganz egal«, sagte Bubi ohne aufzusehen.
Frieder Faust stand im Unterhemd und mit einer Flasche Bier in der Hand an seinem selbst gemauerten Grill. Auf dem Rost brutzelten Steaks und mehrere Scheiben Speck. Ein Bild, wie aus den besten Zeiten geordneter Kleinbürgerlichkeit. Wäre nicht das Flugzeugwrack am Horizont gewesen, hätte man durchaus auf den Gedanken kommen können, alles wäre in bester Ordnung. Bubi saß im Schatten an der Hauswand und betrachtete auf dem kleinen Monitor seiner Digitalkamera wieder und wieder seine Aufnahmen. Aufnahmen, die er keinem zeigen wollte und die ihn mit so viel Stolz und Zuversicht erfüllten. Susanne deckte den Tisch auf der kleinen Veranda hinter ihrem Haus. Lea half dabei.