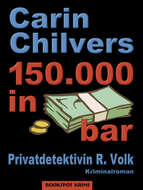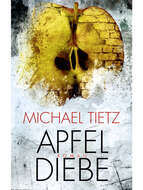Kitabı oku: «Rattentanz», sayfa 17
Kann Wasser riechen?
Ritter wälzte sich auf die andere Seite.
Warum war Fuchs so still? Beobachteten ihn seine Ohren? Warte te er nur darauf, dass Ritter einschlief, um ihn dann im Schlaf zu töten? Der Gebirgsbach sprang ausgelassen über blank polierte Steine. Gräser und gelbe Blumen säumten den Weg des Wassers und in den winzigen Tropfen, die wie tanzende Kinder hoch in die Luft sprangen, spiegelte sich dunkelrot die Sonne. Blutrot.
Aber nein, überlegte Ritter, Fuchs würde ihm nichts antun. Sie waren aufeinander angewiesen. Sich gegenseitig zu töten wäre ein klassisches Eigentor. Das Wasser war blutrot! Es war Blut, das durch das Bachbett tobte, rechts und links standen hässliche Fratzen Spalier, die Fratzen dieses Tages. Sie waren alle da und starrten mit leerem Blick ins Wasser. Ins Blut.
Sollte er hier irgendwo in eine Ecke pinkeln?
Ihn schauderte bei dem Gedanken, in einem Raum zu schlafen, in den er auch urinierte. Morgen, dachte er, morgen werden wir hier raus kommen. Morgen. Wie wohl der Tote aussieht, in den Mehmet seine Hände gesteckt hatte? War es ein Mann, eine Frau, ein Kind? Aus dem Zapfhahn schoss ein dicker Strahl goldenes Bier.
Amputieren.
Blutiges Bier.
Fuchs, du hast das Bein gestohlen.
Pinkeln, bitte, nur ein bisschen.
Endlich, es war inzwischen kurz vor drei am Morgen, schlief er ein.
Hermann Fuchs hatte die Beine angezogen und die Arme um sie geschlungen. Er sah hinauf zu den kleinen Lichtpunkten und überlegte, welcher Raum darüber sein könnte, um welche Lichtquelle es sich wohl handeln mochte. Fuchs war nicht müde. Nicht heute, nicht in dieser Nacht. Er spürte das Geldbündel an seiner Brust und ihm kam zum ersten Mal der Gedanke, dass es wertlos sein könnte. Konnte ihn das Geld hier rausbringen? Konnte er sich damit freikaufen? Konnte er es essen oder trinken? Und selbst wenn er hier wieder rauskommen sollte, wie würde diese neue Welt da draußen in Zukunft funktionieren? Würde es noch Geld geben oder nur Tauschhandel und das Gesetz des Stärkeren?
Er war an diesem Morgen auf dem Weg zum Sozialamt gewesen, um sich sein Geld für die zweite Monatshälfte abzuholen. Früher hatte er den kompletten Betrag am ersten oder zweiten des Monats erhalten, aber weil er regelmäßig spätestens am zehnten mit leeren Taschen und Alkoholfahne wieder im Amt aufgekreuzt war, hatte dieses die Teilzahlung eingeführt.
In ihm gierte alles nach einer Zigarette und einem Schluck hinterher.
Später. Wenn er erst mal hier raus war.
Irgendwann schlief er doch ein. Als er erwachte, wusste er im ersten Moment nicht, wo er war. Er fühlte sich benommen, wie nach einer durchzechten Nacht, und rieb sich die Augen. Dann kam die Erinnerung zurück.
Mehmet lag mit offenem Mund auf der Seite und schlief, Ritter ebenso, nur saß der an die kalte Wand gelehnt und hatte sein Bein von sich gestreckt. Unter der zerrissenen Hose konnte Fuchs die Wunde erkennen, sie sah furchtbar aus. Sie sah furchtbar aus? Sehen?
Sein Blick ging zur Decke, dahin, wo in der Nacht die Lichtpunkte waren.
Über ihm wölbte sich eine Milchglaskuppel!
Genau über dem Operationstisch war ein quadratisches Fenster in der Decke eingelassen, vielleicht zwei Quadratmeter groß. Und dahinter kletterte die Dämmerung übers Land. Noch war der Himmel ein blaugraues Gemisch aus Nacht und Tag, aber das diffuse Licht reichte aus, um Einzelheiten erkennen zu können, um zu sehen.
»Es waren Sterne!«
Der ansonsten fensterlose Raum war sicher vier Meter hoch, Boden und Wände grün gefliest. Sehr weit oben sah er mehrere Gitter an der Wand, vermutlich die Klimaanlage. Das Fenster war fest verschlossen, kein Scharnier konnte Fuchs erkennen, keinen Motor zum automatischen Öffnen. Allein und ohne Hilfe, soviel war klar, würde er hier niemals rauskommen. Wenn, dann nur mit Mehmets und Ritters Hilfe. Allein ging nichts.
33
5:42 Uhr, zwischen Donaueschingen und Wolterdingen
Die Sonne ging gerade auf, an einem makellos blauen Himmel und genau zur vorberechneten Zeit. Die Erde hatte sich weitergedreht, ohne von dem, was sich auf ihrem Rücken abspielte, Notiz zu nehmen.
Die Sonne beleuchtete einen Planeten, auf dem in den vergangenen Stunden die Luftverschmutzung drastisch zurückgegangen war. Übrigens eines der vordringlichsten Probleme, denen das zwei Tage zuvor begonnene Gipfeltreffen der G8 galt, welches in diesem Jahr im äußersten Zipfel des russischen Reiches stattfand. Die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, Italien, Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika saßen nun zusammen mit ihren Außen-, Umwelt- und Wirtschaftsministern sowie einem umfangreichen Tross an Beratern und Mitarbeitern gemeinsam in Wladiwostok fest.
Im Irak hatte es in den vergangenen dreiundzwanzig Stunden nur zwei Selbstmordattentate gegeben, beide kurz nach acht auf einem Markt in Bagdad. Seitdem war es ruhig.
Valentin Jost, der erste nicht existierende Patient des vergangenen Tages im Donaueschinger Krankenhaus, saß, mit dem Rücken an eine hundertjährige Tanne gelehnt, im Wald zwischen Donaueschingen und Wolterdingen. Erste Strahlen der gerade im Osten aufgehenden Sonne stahlen sich zwischen den Baumstämmen hindurch und trafen sein Gesicht. Kühle Nebelschleier waberten, schmiegten sich eng an den bemoosten Boden.
Nachdem er am Vortag kurz nach neun die Intensivstation verlassen hatte, machte er sich zu Fuß auf den Weg nach Wolterdingen. Er hatte Kopfweh und der Verband drückte. Nach zwei Kilometern − er hatte bereits mehr als die Hälfte des Weges zurück nach Hause hinter sich gebracht − nahmen die Schmerzen schlagartig zu. Sein Nacken fühlte sich wie ein Brett an und vor Josts Augen tanzten schwarze Schatten. Er war vom Weg abgekommen und in den Wald gestolpert. Mit den Augen stimmte etwas nicht, dann sank er auf den weichen Waldboden.
Gegen halb elf war er noch einmal erwacht. Er hatte Stimmen gehört, die vom Waldweg kamen, der irgendwo hinter den Bäumen verborgen sein musste. Kinderstimmen. Wer er war, hätte er zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr sagen können, denn die unerträglichen Schmerzen in Kopf und Nacken hatten jede Erinnerung vertrieben. Er versuchte noch einmal aufzustehen, aber sein linkes Bein knickte willenlos unter seinem Gewicht zusammen. Die Blutung in Josts Kopf hatte sich ausgebreitet und drückte nun auf Nerven, die daraufhin ihren Dienst einstellten oder diesen nur noch halbherzig erledigten. Seine Augen konnte er nur noch minimal bewegen.
Kinderstimmen.
Sie riefen trotz der Schmerzen ein warmes, angenehmes Gefühl in ihm wach. Er zog mit der Rechten sein Portemonnaie hervor, dann wurde er erneut ohnmächtig.
Fünf Minuten darauf erwachte er und stellte verwundert fest, dass er ein Bild in der Hand hielt. Er konnte kaum noch etwas sehen, die dunklen Schatten breiteten sich aus, übermächtig und zu stark. Aber es schienen Kinder zu sein, zwei kleine Buben. Jost wusste nicht mehr, um wen es sich handelte, aber die Wärme, die Liebe, die ihn beim Betrachten des Bildes überkam, taten gut, machten ihn glücklich. Valentin Jost starb ein paar Minuten vor zwölf mit einem Foto seiner Söhne in der Hand.
34
06:28 Uhr, Wellendingen
Die siebzigjährige Adelheid Nussberger lebte mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Eugen ein Stück außerhalb Wellendingens an der Straße nach Wittlekofen.
An normalen Tagen schlief sie meist bis gegen neun, aber heute war sie schon um fünf erwacht, was vielleicht daran lag, dass sie gestern Abend, so ganz ohne Fernseher, bereits kurz nach Sonnenuntergang ins Bett gegangen war.
Jetzt stand sie in der Küche und sah zu, wie ihr Bruder einen kleinen Campingkocher aufbaute und an eine rote Gasflasche anschloss. In Eugen Nussbergers Mundwinkel tanzte die obligatorische Zigarre.
»Bist du dir sicher, dass das Ding nicht explodieren kann?«
Sie war eine gebildete Frau. Fernsehen bildet. Erst kürzlich hatte sie einen Bericht von einer Gasexplosion gesehen, bei der zwei Menschen in Bayern ums Leben gekommen waren. Die Wucht der Explosion hatte die gesamte Front des Gebäudes einfach so weggepustet.
»Das klappt schon.«
Das Geschwisterpaar hatte seit den Kindertagen so ziemlich jeden einzelnen Tag miteinander verbracht. Bis auf die drei Jahre, in denen sie etwas mit ihrem damaligen Chef hatte. Aber das war jetzt bald vier zig Jahre her und fast schon nicht mehr wahr. Allerdings, die Folgen dieser drei Jahre waren bis zum heutigen Tag noch spürbar. Damals arbeitete Adelheid Nussberger als Sekretärin in einem Großhan delskonzern. Ihr Chef bekam den Auftrag, in Meran die erste Nieder lassung außerhalb Deutschlands aufzubauen. Die Mitarbeiterin, die er bat, mitzukommen, war sie. Es folgten die beiden schönsten Jahre ih res Lebens. Tagsüber konnte sie ihm aus dem Nebenzimmer von ih rem Schreibtisch aus bei der Arbeit zusehen und nachts war er ihr so nahe wie niemals wieder ein anderer Mann, von denen es in ih rem Le ben nur wenige gegeben hatte. Dass er verheiratet war und Kin der hatte, störte sie erst, als er sie fragte, ob sie ein Kind von ihm wollen würde. Natürlich hätte sie gewollt! Nichts lieber als das! Aber nein, scheiden lassen wollte er sich nicht, seiner Kinder wegen.
Sie hielt es nach der Rückkehr aus Meran noch ein weiteres Jahr mit ihm aus. Montag bis Freitag lebte er bei ihr in einer kleinen Wohnung in Waldshut, am Wochenende wohnte er bei seiner Frau und den Kindern. Diese Wochenenden waren schlimm und einsam, voller Gedanken und Fantasien. Während er dort war, wo er eigentlich hingehörte und vor seinen Kindern den liebevollen Familienvater mimte, saß sie allein in ihrer Wohnung und trank. Nur mit Rotwein konnte sie die Bilder in ihrem Kopf ertragen: Sie sah ihn mit seiner süßen Tochter auf dem Schoß, sie sah ihn, wie er am Abend seinen Söhnen Stevensons Schatzinsel vorlas. Sie sah ihn, wie er am Sonntagnachmittag im Kreis seiner Familie am Kaffeetisch saß und sich von den Kindern erzählen ließ, was in der vergangenen Woche alles geschehen war, in der Woche, in der sie, Adelheid Nussberger, den Kindern ihren Vater stahl. Und sie sah ihn, wie er Freitag-, Samstag- und Sonntagabend zu seiner Frau ins Bett stieg. Rotwein nahm ihr die Träume.
Und dann blieb ihre Regel aus. Obwohl sie den Grund hierfür von Anfang an wusste, brauchte sie doch Wochen, um zuerst sich, schließlich auch ihm die Schwangerschaft zu gestehen. Es ist nicht so, versuchte sie sich zu beruhigen. Nur ein Aussetzer. Mein Körper hat einmal vergessen zu bluten. Na und? In vier Wochen wird alles wieder ganz normal sein! Die Übelkeit schrieb sie der Aufregung und dem Rotwein zu, die Schmerzen in den Brüsten einer Hormonschwankung (Die aber nichts mit Schwangerschaft zu tun hatte!). Ihre Regel ließ auch einen Monat später auf sich warten und ihr Gynäkologe sprach schließlich aus, was sie längst wusste, aber nicht hören wollte. Und er gratulierte ihr!
Der Mann, dem sie diesen Zustand zu verdanken hatte, reagierte mit Fassungslosigkeit und Entsetzen. Dann sagte er, dass er sie liebe. Und selbstverständlich die Abtreibung bezahle, es sei doch hoffentlich noch nicht zu spät, das Kind noch nicht zu groß? Das Kind. Ihr Kind. Adelheid Nussbergers Kind! Das Kind, das sie ermordete – zerstückelt im Leib der eigenen Mutter, der doch eigentlich Sicherheit und Heimat sein sollte. Zerstückelt, herausgepresst und weggeworfen wie unnötiger Ballast. Und im selben Maße, in dem dieser Ballast stückchenweise aus ihrem Körper blutete, lud Adelheid Nussberger damals die Gewichte ihres Lebens auf ihre Schultern: Schuld, Angst vor Gott und seinem Urteil, Hass auf den Mann, der sie zu dem gemacht hatte, was sie nun war – eine Mörderin.
Sie hatte sich nie wieder von ihm anfassen lassen und nur drei Tage nach ihrer Tat seine Sachen gepackt und vor die Tür gestellt. Und sie hatte das Schloss ihrer Wohnung austauschen lassen. Er brach die Tür auf, angeblich, weil er seinen Rasierapparat noch holen wollte, und hinterließ zweihundert Mark auf dem Küchentisch. Für die beschädigte Tür. Oder für meine Dienste!, dachte sie damals. Dann betrank sie sich und zerriss die Scheine in winzige Schnipsel.
Nie wieder hatte sie sich so mies gefühlt wie an diesem Tag vor vierzig Jahren. Und wäre ihr Bruder damals nicht gewesen, wer weiß, was dann der Alkohol aus ihr gemacht hätte.
So aber rettete er sie und nahm sie wieder mit nach Wellendingen. Von dem Mann, der drei Jahre ihres Lebens gestohlen und ihre dürren Schultern mit Bleigewichten ausgegossen hatte, hörte sie nie wieder etwas. Soviel zum Thema: Du bist das Wichtigste in meinem Leben.
Männer gab es danach keine mehr. Ihr Liebhaber hatte sie drei Jahre lang benutzt und vertröstet und Hoffnungen in ihr geweckt, die er niemals erfüllen wollte. Und als er gegangen war, hatte er alle Liebe und alle Freundlichkeit mitgenommen und aus Adelheid Nussberger wurde eine alte, verbitterte Frau, neidisch auf das Glück der anderen, voller Häme und Wut und Schuldgefühl.
»Hab ich dir nicht gesagt, dass es klappt.« Eugen Nussberger hatte Herd und Gasflasche miteinander verbunden und eine kleine Flamme entzündet. »Pass aber auf, dass du nur so viel Wasser warm machst, wie wir für den Kaffee brauchen. Das ist unsere einzige Gasflasche und ich weiß nicht, wie viel noch drin ist.«
Adelheid stellte einen Kessel mit Regenwasser auf den Kocher (zum Glück waren die Fässer hinter dem Haus voll) und setzte den Trichter der Kaffeemaschine, in den die Filtertüte gehörte, auf eine Glaskanne.
»Hast du dein Spray genommen?« Adelheid nickte. Seit vor sechs Jahren ihre uralte Mutter gestorben war, bekam sie in regelmäßigen Abständen Asthmaanfälle. Alles psychisch, so ihr Hausarzt. In Stresssituationen müsste sie sich einfach nur beruhigen. Medikamente brauche sie ganz bestimmt nicht. Sie hatte daraufhin den Arzt gewechselt und ihre Medikamente bekommen.
Ob nun bewusst oder unbewusst: sie hatte jedenfalls recht schnell gelernt, dass so ein Asthmaanfall ein wirklich probates Mittel war, wenn es darum ging, Unzufriedenheit auszudrücken, einen Konflikt frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden oder gelegentlich zwei oder drei Tage Urlaub in einem der Krankenhäuser der Umgebung zu machen. Schließlich hatte sie dreiundvierzig Jahre ihre Kassenbeiträge bezahlt. Sie kannte inzwischen die Kliniken in Stühlingen, Waldshut, Neustadt und Donaueschingen so gut, dass sie bereits in jedem der Häuser bei ihrer Einlieferung korrekt mit Namen angesprochen wur de. Und Ärzte und Schwestern hinter ihrem Rücken die Augen verdrehten.
Obwohl sie eine Zusatzversicherung besaß, die ihr ein Einzelzimmer ermöglicht hätte, bestand sie immer auf einer Zimmernachbarin. Aber nicht, weil sie gesellig gewesen wäre(Gott behüte!) und auch nicht etwa, um im Hin und Her eines Gespräches etwas über diese Frau zu erfahren – nein, sie brauchte einfach nur eine möglichst geduldige Zuhörerin, die an den richtigen Stellen durch Kopfnicken ihre eigene Meinung bestätigte. Und so schimpfte sie dann zwei Tage über Schwangere (»Die machen nur Bälger, damit sie auf meine Kosten daheimbleiben können!«), über Ostdeutsche (»Ich kenne keinen Einzigen, der etwas taugt. Alles nur arbeitsscheue Kommunisten, die jetzt von dem leben, was wir hier nach dem Krieg aufgebaut haben!«), Punker(»Arbeitslager. Haare schneiden, waschen und dann ab ins Arbeitslager!«) und Politiker (»Unter Adolf hätte es so was nicht gegeben. Da wurden wenigstens noch Nägel mit Köpfen gemacht! Wissen Sie, ich war im Bund deutscher Mädchen damals. Da herrschten noch Zucht und Ordnung, da hatte jeder noch seinen Platz!«).
Sie war schuldig. Verbittert. Voller Trauer.
»Du bringst die Lebensmittel nachher besser in den Keller.« Adelheid Nussberger hielt eine schmierige Scheibe Wurst ins Licht, dann warf sie diese der Katze auf den Küchenboden. Ihr Bruder nickte. Er deckte den Tisch, wie jeden Morgen. Es duftete nach frisch gebrühtem Kaffee. Sie nahmen beide am Küchentisch Platz.
»Ist das unser ganzes Brot?«, fragte sie zwischen zwei Bissen. Eugen Nussberger nickte.
»Ein paar Scheiben Knäckebrot sind noch da und das eben.« Er deutete auf den winzigen Rest, der von dem Brotlaib, den er vorgestern gekauft hatte, noch übrig war.
Bis vor acht Jahren hatte Eugen Nussberger eine kleine Landwirtschaft mit zuletzt sieben Kühen betrieben, während seine Schwester den ganzen Tag im Bürgermeisteramt in Stühlingen arbeitete. Da er damals den ganzen Tag hier auf dem Hof war und die wenigen Tiere und das ganze Drumherum schnell versorgt waren, hatte es sich so er geben, dass er den größten Teil des Haushaltes und die Einkäufe übernommen hatte. Nur zu bügeln weigerte er sich.
»Und was machen wir jetzt?«
»Selber backen«, antwortete er.
»Kannst du Brot backen? Also ich kann es nicht!« Adelheid fingerte nach ihrem Asthmaspray, und zwar so, dass ihr Bruder es sehen konnte. Er sah es und verzog das Gesicht. Oh, wie ihn dieses Spiel langweilte! Offiziell aber tat er so, als sei er voll und ganz mit seinem Brot beschäftigt.
»Ich schau nachher mal in den Backbüchern nach.«
»Und womit sollen wir backen?«, nörgelte Adelheid. Sie spürte Panik in sich aufsteigen und wie diese Panik nach ihrem Hals griff und ihn zuschnürte. Sie drückte zweimal auf die kleine Dose und inhalierte die rettende Medizin. »Mal angenommen, du bekommst einen Teig hin – sollen wir den dann in die Sonne legen und backen?«
Eugen stellte die Kaffeetasse zurück. Richtig, dachte er, der Elektroherd war nutzlos ohne Strom.
»Fahr doch nach Bonndorf. Vielleicht gibt es ja irgendwo was zu kaufen?«
»Das hatten wir doch schon, oder?« Gestern Nachmittag waren beide in die nahe Stadt gefahren, weil sie dem, was sie gehört hatten, keinen Glauben schenken wollten und mussten mit eigenen Augen die geplünderten Geschäfte und das brennende Schloss ansehen.
»Vielleicht hat im Dorf noch jemand ein Brot übrig.« Adelheid schöpfte neue Hoffnung.
»Und wenn nicht?«
»Was, wenn nicht?!« Nussberger verlor langsam die Geduld. »Ich geh ins Dorf und schau, ob ich was bekommen kann, ja? Und wenn ich mit leeren Händen zurückkomme, dann ist Zeit, sich über das Weitere Gedanken zu machen!« Er hasste diese endlosen Debatten, oder besser, die endlosen Monologe seiner Schwester, in denen sie sich liebend gern über eine Situation und sämtliche nur in Frage kommenden Widrigkeiten auslassen konnte. »Im Notfall«, fuhr er deutlich sanfter fort, »bringen wir den Teig zur Albicker hoch und fragen, ob wir unser Brot bei ihr backen können. Soviel ich weiß, hat sie noch einen alten Holzofen in der Küche.«
»Stimmt!« Jetzt fiel es auch Adelheid wieder ein. »Du bist ein Engel!« Und schon ging es ihren Atemwegen deutlich besser.
»Meinst du nicht, wir sollten uns oben am Hardt mal sehen lassen? Vielleicht brauchen die Hilfe dort.« Schon nach der gestrigen Versammlung im Gasthaus wollte Nussberger Christoph Eisele seine Hilfe anbieten, aber Adelheid hatte ihn zurückgehalten. Und auch jetzt war sie anderer Meinung.
»Willst du allen Ernstes, dass deine kranke Schwester zwischen all den Toten da oben rumläuft?! Nein, nein, vergiss das ganz schnell. Das können die anderen ganz gut ohne uns. Und du bleibst auch hier! Du kannst mich schließlich nicht allein lassen, so ganz ohne Telefon. Stell dir vor, ich bekomme einen Anfall!«
Daran hatte Eugen Nussberger auch schon gedacht. Er kannte die Asthmaanfälle seiner Schwester aus den vielen Vorführungen der letz ten Jahre nur zu gut und ihm lief es eiskalt den Rücken runter, wenn er daran dachte, dass sie einen Anfall bekommen könnte und es wäre kein Arzt erreichbar. Kein Arzt, der sie dann für ein paar Tage in ein Krankenhaus stecken würde.
»Also gut.«
Sie schwiegen und aßen weiter, während draußen die Sonne langsam höher stieg. Es war ruhig heute. An normalen Wochentagen rollte um diese Zeit der Berufsverkehr zwischen Bonndorf und Stühlingen an ihrem Haus vorbei, aber in der letzten Stunde war kein einziges Auto vorbeigekommen.
»Glaubst du, heute gibt es wieder eine Versammlung in der Krone?« Adelheid nahm sich ganz selbstverständlich das letzte Stück Brot, bestrich es dünn mit Halbfettmargarine und legte eine Scheibe Käse darauf. »Wenn ja, könntest du doch vorschlagen, dass man im Dorf die älteren Leute irgendwie unterstützt, jedenfalls so lange, wie das Durcheinander noch anhält.«
»Unterstützt?«
»Na, mit Lebensmitteln zum Beispiel.«
»Und wo sollen die anderen diese Lebensmittel hernehmen?«
Adelheid wollte gerade etwas erwidern, als vor dem Haus ein Fahrzeug zum Stehen kam. Dann hupte jemand.
»Wer kann denn um die Zeit was von uns wollen?« Es war fünf Minuten vor sieben, fast vierundzwanzig Stunden nach dem Aus. Adelheid stand auf und ging zur Tür. Sie hatte diese noch nicht richtig geöffnet, als sie ein Faustschlag mitten ins Gesicht traf. Zeit für einen Asthmaanfall blieb ihr nicht mehr. Sie fiel einfach nur um.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.