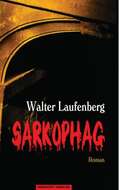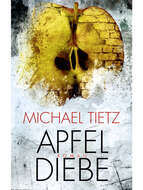Kitabı oku: «Rattentanz», sayfa 12
20
19:51 Uhr, Wellendingen, Hardt
Frieder Faust wusste, dass er alles andere als ein Führer war. Meinte es zu wissen. Er warf einen weiteren Kronkorken aus dem Fenster seines Pick-ups und sah zu, wie Uwe Sigg stolz mit dem Bagger von Wünsches Baustelle den asphaltierten Feldweg zum Hardt hinauftuckerte und dort begann, zwischen den Trümmern des Airbusses eine Grube auszuheben.
Faust hatte nicht lange mit Sven Wünsche diskutieren müssen. Die Übermacht der Männer – neben Faust, Mettmüller und Eisele waren noch Uwe Sigg und drei andere bei Wünsche aufgekreuzt – hatte diesen schnell davon überzeugt, dass seine Baugrube auch noch einen weiteren Tag Verzug vertragen konnte. »Und solltest du Langeweile haben«, hatte Faust ihm zugerufen, »Christoph kann bestimmt noch Helfer gebrauchen.« Mettmüller hatte ihm daraufhin mit dem Ellenbogen in die Seite gestoßen und gesagt, dass vielleicht genau dies der Grund sei, warum die Leute im Dorf ihn, Faust, riefen und nicht irgendeinen anderen.
Er hatte im Pick-up das Radio eingeschaltet und den automatischen Sendersuchlauf betätigt. Nachdem alle Frequenzen fünfmal durchgelaufen waren, ohne dass aus den vier Lautsprechern etwas anderes als sphärisches Rauschen gekommen wäre, legte er eine CD ein. Und schaltete dann wieder ab.
Wie fleißige Ameisen liefen Menschen über die Absturzstelle und trugen etwas zusammen; er wusste, was es war. Frauen sammelten Gepäckstücke ein und stapelten sie auf einem Haufen. Man wollte sie unten im Ort in der Grundschule lagern, bis jemand käme, um sie für die Hinterbliebenen abzuholen. Aber im Augenblick musste man sie erst einmal vor Plünderern schützen, die bereits zwischen den Trümmern nach Brauchbarem suchten. Die Männer sammelten die Toten ein. Über Bonndorf stieg eine dunkle Rauchwolke auf, ebenso zwischen Buchberg und Eichberg, ganz am Horizont, dort wo Blumberg lag.
Er kam mit den Veränderungen, die dieser Tag in so rasendem Tempo gebracht hatte, nicht zurecht. Alles brach weg. Wichtiges war plötzlich unwichtig, wie das brennende Schloss in Bonndorf, und Unwichtiges wichtig, wie Albickers Kühe.
Faust sehnte sich nach seiner Baustelle, nach einem Dachstuhl, an dem er arbeiten durfte. Er wollte Holz zusammenfügen, wollte tun, was die vergangenen dreißig Jahre sein Job war, wollte einfach nur Frieder Faust sein: Prügelknabe als Kind, respektiert als Erwachsener. Und sonst nichts!
Bisher waren doch auch alle ohne ihn zurechtgekommen! Wieso also dann ausgerechnet er, wieso jetzt?
Er hatte nie etwas auf die Meinung oder gar auf die Bewunderung anderer gegeben. Ihm reichte, dass sie ihn akzeptierten und anerkennend auf die Schulter klopften, wenn seine Arbeit gut war. Mehr wollte er nie; keine Öffentlichkeit, keine Vereine, keine Politik – nur seine Ruhe, die war ihm wichtig. Und ein Bier.
Vor ihm lag Wellendingen, durchflossen vom Ehrenbach, an dem er als Kind Staudämme gebaut hatte und Wasserräder rattern ließ. Er war in Wellendingen geboren, im Schlafzimmer über dem Stall seines Elternhauses, an dessen Stelle er später das eigene Haus errichtete.
Obwohl die Sonne noch eine Stunde bis zu ihrem Untergang hatte, wurden die Schatten der einzelnen Tannen am gegenüberliegenden Hang bereits merklich länger. Von dort ging es hinab ins Steinatal und dahinter dehnten sich die Bergkuppen des Schwarzwaldes – dunkel und geheimnisvoll, schützend. Das hier, wurde ihm bewusst, war sein Zuhause. Das war Heimat.
21
19:54 Uhr, Kernkraftwerk Civaux, Frankreich
Block zwei des französischen Kernkraftwerkes Civaux explodierte kurz vor acht. Die radioaktive Wolke trieb am Abend über das gleichnamige Städtchen und seine noch neunhundert Einwohner.
22
20:04 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Klinikküche
Hermann Fuchs und Daniel Ritter saßen in der Kantine.
Fuchs kannte das Krankenhaus recht gut. Bis zur Bewusstlosigkeit abgefüllt, war er bereits dreimal hier eingeliefert worden. Er schlief jeweils zwei Tage seinen Rausch aus und erkundete in einem Bademantel, den ihm die Schwestern freundlicherweise zur Verfügung stellten, Klinik und Park, bis man ihn wieder auf die Straße setzte. Eine Sozialarbeiterin mit knallengen Jeans und einem Dekolleté, bei dem ihm heute noch das Wasser im Mund zusammenlief, versuchte ihn zur Resozialisierung (es klang süß aus ihrem Mund) zu überre den. Er sagte nie nein, sondern vertröstete die Kleine immer auf den nächsten Tag, was ihn in die glückliche Lage versetzte, jeden Tag eine bescheidene Peepshow zu bekommen.
Ein weiterer Besuch in der Klinik wurde unvermeidbar, als sein Blinddarm platzte und, laut Chefarzt, seine Därme schon im Eiter schwammen. Aber sie hatten ihn wieder hinbekommen und ihm sogar jeden Abend zwei Bier statt des sonst üblichen Kräutertees spendiert. Es war schon nicht übel, dieses Krankenhaus; er hatte es warm, konnte die Menschen beobachten und genoss es, den Unbeholfenen und Kran ken zu mimen und damit eine der Schwesternschülerinnen zur Hilfe zur animieren. Aber meistens kam stattdessen Schwester Brunhild, ein monströser Drachen von fast einsneunzig, mit Bartstoppeln am Kinn und tiefer Stimme, die Fuchs aus dem Bett hob.
»Wird schon wieder!«, hatte sie immer gesagt und ihm dabei sanft, wie sie meinte, den Rücken getätschelt, was ihn umgehend quer durch das Patientenzimmer bis ans Waschbecken schubste.
Der letzte Aufenthalt lag zwei Jahre zurück. Ein alter Tatterkreis, den seine Prostata und ein nerviger Köter nicht schlafen ließen, hatte Fuchs halb erfroren in einem Straßengraben gefunden. Fuchs konnte sich an diese Nacht kaum noch erinnern. Irgendwann nach Mitternacht − er würfelte mit zwei anderen Pennern, die sicher auf der Durchreise waren, in einer Bushaltestelle um den nächsten Schluck − war sein Film gerissen. Hier im Krankenhaus sagten sie ihm, dass er bis auf die allseits bekannte schmutzige Unterwäsche nackt gewesen wäre, als der Alte ihn fand. Er wäre zwar in eine löchrige Decke eingewickelt gewesen, aber die Füße eben nicht. Und dann hatten die Ärzte bei Visite auf seine Füße gezeigt und ihm erklärt, dass sie die Zehen leider nicht mehr retten konnten. Deswegen also das komische Gefühl.
»Kannst jetzt wieder Kinderschuhe tragen«, war der Kommentar seines Bettnachbarn, nachdem die Weißkittel aus dem Zimmer geschwebt waren. Und er hatte gelacht, wie ein Irrer, dem sie vergessen hatten, seine Tabletten zu geben.
Das machte also fünf Krankenhausaufenthalte. Und er hatte keinen Pfennig dazu bezahlt! Im Gegenteil − allerdings fiel niemandem ein Zusammenhang zwischen seinen Aufenthalten hier und den zeitgleichen Diebstählen aus Nachttischen und Kleiderschränken auf. Man musste eben sehen, wie man zurechtkam, war seine Lebensdevise, und wenn sich eine Gelegenheit ergab, wäre man ja blöd, diese un genutzt vorüberziehen zu lassen!
Als sie nach ihrer erfolglosen Suche nach diesem feigen Polizisten zum Ausgang marschiert waren − Ritter marschierte nicht, er humpelte −, überfiel die vier zeitgleich ein unbändiges Hungergefühl. Auslöser war die Klinikküche. Durch das Notstromaggregat weiter funktionsfähig, hatten die beiden Köche und zwei Helferinnen unbeirrt Es sen für Patienten und Personal zubereitet, drei verschiedene Menüs. Vergeblich versuchten sie jeden Tag, den vorgekochten, billigen Produkten so etwas wie Geschmack und Persönlichkeit zu verleihen, aber meist schmeckte das eine wie das andere, was blinde Esser dazu verdammte, immer den Tischnachbarn fragen zu müssen, was das nun ei gentlich wäre. Aber glücklicherweise waren die Sehenden in der Überzahl und so assoziierte das Sehen auch einen passenden Geschmack. Jedenfalls hatte der Geruch von gebratenem Fleisch, der durch das Treppenhaus wehte, bei ihnen den Hunger geweckt.
»Kommt, wir essen erst mal was!«, hatte Ritter entschieden. »Ha ben ja nichts weiter vor im Moment, oder? Hat einer irgendwelche wichtigen Termine?«
Sie hatten gelacht und nachdem Mario seinen Bruder geholt hatte, der im Wagen vor der Klinik die Waffen bewachte, war Fuchs vorausgegangen und hatte ihnen den Weg in die Kantine gezeigt. Zu dieser Zeit, kurz nach vier, war im Regelfall geschlossen – heute nicht. Also setzte Ritter sich an einen der Tische mit Blick hinaus in den Park und legte das lädierte Bein auf einen Stuhl. Fuchs, Mario, Alex und Mehmet gingen in die Küche. Dort hantierte ein einsamer Koch zwischen riesigen Töpfen, Warmhaltebehältern und Pfannen herum. Seine Verzweiflung war ihm anzusehen. Das Patientenessen war nicht abgeholt worden, seine Mitarbeiter gegangen und er versuchte nun – Don Quichotte mit einer überdimensionierten Suppenkelle – sein Werk wenigstens warm zu halten.
Mehmet zwang ihn mit vorgehaltener Pistole, seine Aufgabe zu vernachlässigen und ihnen einen Servierwagen mit Suppe, Kartoffeln, Nudeln, Gemüse und Fleisch (»Hast du nichts anderes als Schweinefleisch?!«) in den Speisesaal zu bringen, wo Ritter wartete.
In der folgenden Stunde aßen sie, während der Koch bei ihnen stehen bleiben musste.
»Kann ja sein, wir brauchen noch etwas«, hatte Ritter gesagt. »Oder dein Fraß schmeckt nicht«, ergänzte Mehmet und legte die Waffe neben seinen Teller. »Wo sollten wir uns beschweren, wenn du nicht mehr da wärst!«
Der Koch, erstaunlich schlank – was kein gutes Licht auf seine Künste warf – blieb, zur Salzsäule erstarrt, am Tisch stehen und beobachtete seine ungebetenen Gäste. Angstschweiß perlte von seiner Stirn. Unter seiner hohen weißen Mütze grübelte er über diesen verfluchten Tag nach. Es war nicht sein Tag gewesen! Erst der Stromausfall und die Staus in der Stadt, weswegen er zweiundvierzig Minuten zu spät zur Arbeit erschien, was ihm in einem Vierteljahrhundert Kochdasein noch nie passiert war. Dann die Gehilfin, die im Aufzug fast erfroren wäre, das viele Essen, was keiner holte und seine Kollegen, die einfach ihre Schürzen an einen Haken hingen und gegangen waren. Und jetzt auch noch das hier!
Mehmet bestand anschließend auf Erdbeercreme zum Nachtisch. Der erschrockene Koch bot ihm Pudding (Vanille, Schokolade, Mandel, Waldfrucht) an, Quarkspeisen und Eis, aber Mehmet wollte Erdbeercreme. »Und zwar genau die Gleiche, die meine Mutter immer macht«, hatte er hinzugefügt und dabei den Koch, der die Hände vor der Brust gefaltet hatte, kalt taxiert.
»Dieser kleine Türkenbengel wird seinen Weg machen.« Ritter klang richtig stolz und sah dabei dem Jungen nach, der den Koch in die Küche begleitete. Er rieb sein verletztes Bein und verzog das Gesicht.
»Hast du Schmerzen?«
»Das siehst du doch, du Idiot!« antwortete Ritter. »Dieser Mistkerl von einem Bullen! Wenn ich den erwische …« Er kam nicht weiter, weil eine plötzliche Bewegung, die er sofort bereute, die Schmerzen noch schlimmer machte. Ritter schickte Alex und Mario wieder in die Ambulanz. Sie sollten Schmerzmittel besorgen. »Und wagt bloß nicht, ohne etwas wiederzukommen!«, brüllte er den Brüdern hinterher und warf seinen Teller durch den Raum.
Bis auf eine einsame Leiche waren die Räume der Ambulanz leer. Der Tote lag mit gefalteten Händen und inneren Verletzungen, die keiner mehr behandelt hatte, auf einer Trage. Kein Arzt, keine Schwester, keine Kranken. Schränke standen offen und am Boden lagen Binden, Tupfer und Medikamentenschachteln.
»Hat wohl noch einer Schmerzen gehabt.«
Alex nickte.
Plötzlich hörten sie aus einem der Behandlungsräume ein Klirren.
»Ist da jemand?« Aber sie erhielten keine Antwort. Durch die Fenster schickte die Abendsonne warmes Licht in die Räume.
»Hallo?« Nichts.
»Du gehst da lang«, Alex zeigte nach rechts, »und ich hier.« Mario nickte.
Die Ambulanz bestand aus zwei parallelen Fluren, einer für die Wartenden, einer für das Personal und deren Computer. Dazwischen, mit Türen zu beiden Fluren, lagen die vier Kabinen, in denen jeweils eine Liege und ein Stuhl sowie das Nötigste in einem kleinen Schrank lag, das der Arzt für die erste Untersuchung benötigte. Alex und Mario schlichen durch die beiden Flure und kontrollierten eine Kabine nach der anderen. Als Mario in die letzte Kabine sah, traf ihn eine Stuhllehne mitten ins Gesicht. Er ging wortlos zu Boden. Alex, der einen Tick später in der Tür erschien, sah eine junge Frau mit Medikamenten in den Taschen, die über seinen Bruder sprang.
»Bleib hier, du Miststück!«
Er rannte ihr hinterher, durch den Wartebereich, die dunkle Treppe hinab zum Haupteingang. Als er am Haupteingang ankam, hatte er sie aus den Augen verloren. Weit und breit nichts von ihr zu sehen. Die Fahrzeuge vor dem Haus schienen verlassen. Auch zwischen den wenigen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch im Wartebereich ausharrten und noch immer auf jemanden hofften, der sie endlich ho len würde, war nichts von ihr zu sehen.
Die drogenabhängige Frau saß derweil mit zerstochenen Unterarmen hinter dem Tresen, an dem an normalen Tagen eine freundliche Empfangsdame Auskünfte gab. Sie hatte sich unter der Holzplatte versteckt, zwischen Kabeln und Leitungen, einem Papierkorb und einer Handtasche. In der Handtasche erkannte sie eine angebrochene Colaflasche und eine Packung Tampons.
»Die ist weg, die Schlampe!«, fluchte Alex, als sein Bruder die Treppe heruntergekommen war. Der hielt sich die Hand vors Gesicht.
»Ist es schlimm?«
»Geht schon. Blutet nur ein bisschen.« Die Stuhllehne hatte ihn hauptsächlich an Wange und Oberlippe getroffen, die Hauptwirkung des Schlages hatte sein rechter Arm, den er nach oben gerissen hatte, als er den Stuhl kommen sah, abgehalten. Aus der aufgeplatzten Oberlippe troff Blut.
»Wenn ich die erwische, wird sie sich wünschen, nie geboren worden zu sein!«
Die Frau hinter dem Tresen machte sich noch kleiner.
»Die ist bestimmt in die Stadt runter.« Alex kratzt sich am Kopf und musste einen Moment nachdenken.
»Komm, hinterher! Der Wagen steht doch noch draußen!« Mario war schon auf dem Weg zur Tür, als ihn sein Bruder zurückhielt.
»Lieber nicht. Ritter wartet bestimmt schon!«
»Was geht uns dieser Ritter an, he?« Mario betrachtete das Blut in seiner Hand. Zorn stieg in ihm auf. »Bloß weil der einen Bullen abgeknallt hat, hat er uns noch lange nichts zu sagen!« Mario trat wütend gegen den Tresen und traf mit der Faust einen Flachbildmonitor. Das Gerät schwankte einen Augenblick auf seinem schmalen Fuß, bevor es sich für einen geräuschvollen Abgang entschied und neben der Drogensüchtigen auf den Boden fiel.
»Ja schon, aber …«
»Was aber? He, Großer, wir kennen doch den Typen erst seit heute Morgen! Und hast du gesehen, wie kalt der den Bullen umgenietet hat?« Alex wurde nachdenklich. Er hatte toll gefunden, wie Ritter mit der Maschinenpistole in der Hand aus dem Polizeirevier getreten war und den Bullen auf die Stufen warf. War besser als jeder Bruce-Willis-Kracher! »Und der Türke, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Rennt mit seinem Pferdeschwanz rum wie ’ne Tunte. Und der Blick von dem!« Mario schüttelte sich. »Wenn wir ohne Schmerztabletten zurückkommen, was meinst du, was die mit uns machen? He? So, wie die drauf sind!«
Mario hatte seinen älteren Bruder fast überzeugt.
»Weißt du, was wir machen? Wir verschwinden mit den Waffen und drehen auf eigene Faust ein Ding! Irgend ’ne Bank oder so! Oder wir fah ren rüber nach Villingen und schauen uns dort ein bisschen um. Los Bruder«, er boxte Alex gegen die Brust und tänzelte mit erhobenen Fäusten, wie Henry Maske in seinen besten Zeiten, um seinen Bruder herum. »Los, du und ich mit den Knarren und dem Auto – das ist es!«
Nachdem die Brüder mit quietschenden Reifen abgehauen waren, blieb die Frau unter dem Tresen noch lange in ihrem Versteck.
»Scheiße Mann, wo bleiben die Wichser?!« Ritter schleuderte einen weiteren Teller Richtung Eingangstür. Über eine halbe Stunde war inzwischen vergangen, ohne dass die Brüder aus der Ambulanz zurückgekehrt wären. Und er hatte Schmerzen!!!
»Soll ich mal nachsehen?«, bot sich Fuchs an.
»Ach was, die sind sicher abgehauen.« Ritter lockerte den Verband, denn der saß inzwischen so fest, dass er drohte, das Bein abzuschnüren. Das Bein hatte in den letzten Stunden deutlich an Umfang zugelegt und in der Wunde klopfte es wie ein im Keller eingesperrtes Kind, das gegen die Tür hämmert. »Die feigen Säcke sind über alle Berge, sonst wären sie längst zurück.«
In der Küche stand Mehmet mit gezogener Pistole lässig an die Wand gelehnt und beobachtete, wie der Koch die gewünschte Erdbeercreme zubereitete. Der Koch zitterte. Er hatte Todesangst. Warum war er nicht mit seinen Kollegen gegangen? Warum dieses verfluchte Pflichtbewusstsein? Wozu?
Ohne ein Wort zu sagen musterte Mehmet den Mann, beobachtete, wie der in einer Mikrowelle tiefgefrorene Erdbeeren auftaute, Sahne schlug und Zucker unterrührte. Schon nach den ersten Handgriffen wusste Mehmet, dass er den schwitzenden Koch würde töten müssen, denn was der da zubereitete, hatte mit der Erdbeercreme seiner Mutter so viel zu tun wie ein Pekinese mit einem Wolf. Geistesabwesend streichelten Mehmets Finger die Waffe. Sie fühlte sich gut an, machtvoll und ehrlich. Seit seinen Schüssen in die Leiche auf der Intensivstation war er wie elektrisiert. Es hatte ihn einiges an Überre dungskunst gekostet, von Ritter die Waffe zurückzubekommen, aber jetzt hatte er sie. Und das war gut. Sehr gut sogar.
Auf die Fragen des Mannes antwortete er nicht, weigerte sich auch zu kosten oder ihm die Rezeptur seiner Mutter zu verraten. Er beobachtete einfach still und fühlte sich unendlich stark und mächtig. Sein Zeigefinger umspielte den Abzug.
»Es ist fertig, die Creme, äh, die Erdbeercreme ist fertig. Bitte.« Der Koch hielt Mehmet die Schüssel hin, in der kleine Erdbeerstücke in einer sahnigen Masse schwammen. »Ich hoffe, sie ist richtig so.«
Mehmet steckte einen Finger in die Creme, ohne dabei den Koch aus den Augen zu lassen. Dessen Blick verfolgte Mehmets Finger und wartete auf eine Reaktion des Jungen. Er wusste, dass der Kleine verrückt war. Er hatte es dessen Augen angesehen, hatte die ganze Zeit, während er den Nachtisch zubereitete, den kalten Blick zwischen seinen mageren Schulterblättern gespürt. Wie gefrorene Pfeile. Der Blick eines Irren!
Mehmet kostete.
Und schüttelte wie in Zeitlupe den Kopf.
23
20:18 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Aufzug 2
Thomas Bachmann konnte den Druck in seiner Blase kaum noch aushalten! Es schmerzte und er lief wie ein eingesperrtes Tier in der engen, stockfinsteren Fahrstuhlkabine umher. Zwei kleine Schritte hin, zwei kleine zurück, zwei hin und wieder zurück. Im Haus war es still. Oder meinte er das nur, weil sich alles in ihm auf seine Blase konzentrierte?
Er war ein Bettnässer. Früher jedenfalls, jetzt nicht mehr. Außer, es geschah etwas Ungewöhnliches. Wenn ihn beispielsweise eine Frau ei nen Moment länger ansah und er daraufhin errötend den Kopf senkte. Dann wollte sie ihm nicht mehr aus dem Kopf, schlich sich in seine Träume und Nummer drei verspottete ihn, während er von Nummer zwei nur ein pikiertes Räuspern erntete. Und am nächsten Morgen war dann manchmal sein Laken nass. Oder vor wichtigen Arztterminen, wenn es darum ging, dass bestimmte Mittelchen abgesetzt oder andere, vor deren unbekannten Nebenwirkungen ihm graute, neu hinzukamen. Deshalb weigerte sich Mutter auch weiter standhaft, das schmutziggrüne Gummilaken aus Thomas’ Bett zu entfernen. »Man weiß nie, mein Junge«, sagte sie in solchen Momenten, wenn er wieder einmal all seinen Mut zusammengekratzt hatte und mit gesenktem Haupt darauf hinwies, dass ein Achtundzwanzigjähriger und ein Gummilaken nicht zusammenpassten. »Man weiß nie, mein kleiner Liebling«, und sie wuschelte durch sein Haar und er wusste, das Thema war vorerst abgeschlossen.
Schreien durfte er jetzt nicht! Nummer zwei hatte es verboten, denn sonst käme der Tod. Der Tod, auf den Nummer drei doch so hoffte.
Nein, er durfte nicht schreien!
Aber der Urin musste raus aus ihm, die Schmerzen wurden unerträglich, wie Krämpfe oder Koliken oder beides zusammen. Als ob man ihm einen Dolch in den Unterleib gebohrt hätte und nun wild mit diesem in seinen Eingeweiden herumrührte. Es tat so weh. Thomas sank auf die Knie und krümmte sich vor Schmerz, sprang aber sofort wieder auf die Beine, weil diese Haltung den Druck auf seine Blase nur noch verstärkte. Er spürte, dass erste Tropfen seinen Körper verlassen hatten und schämte sich so sehr. Er schämte sich.
Hin und her, immer zwei Schritte, nicht nachdenken, laufen, laufen, einfach nur laufen und dabei tief einatmen und wieder ausatmen. Er würde nicht in die Hosen pinkeln!
Und wenn doch?
Nimm doch die Thermosflasche. Es war Nummer zwei, die endlich von sich hören ließ. Wie viel passt in sie rein? Ein Liter? Obwohl, sie zögerte, solltest du doch mal wieder Tee einfüllen wollen … Also, ich weiß nicht. Machs lieber doch nicht! Vielleicht geht ja gleich das Licht wieder an, die Tür öffnet sich und – stell dir das nur vor – vor der Tür stehen Menschen und du stehst hier im Aufzug, mit heruntergelassenen Hosen und pinkelst gerade in deine Thermosflasche. Nein, nein, lass es lieber! Gibt es eine Alternative?, fragte Nummer eins. Instinktiv wusste Thomas, dass es keine gab! Sonst würde Nummer eins sie ihm verraten.
Es gab keine Alternative.
Er bückte sich und tastete nach seiner Aktentasche, die hier irgendwo liegen musste. Klick – öffnete er sie, riss die Flasche heraus und schraubte den Verschluss auf, riss ihn herunter. Er öffnete seine Hose und – es ging nicht! Thomas atmete tief ein und wieder aus. Du kannst es. Du darfst endlich.
Er presste. Er drückte, aber irgendetwas in ihm hatte Spaß daran, ihn zu quälen. So sehr er sich auch anstrengte, es kamen nur ein, zwei lauwarme Tropfen, die hohl in seine Thermoskanne fielen.
Denk nicht daran. Denk an etwas anderes.
Er versuchte es.
… Die Psychiatrie. Er wurde von Pflegern gepackt, auf eine Pritsche geworfen und an Händen und Füßen festgeschnallt. Ein Arzt beugte sich über ihn und lächelte. Stimmen. Dann ein winziger Stich in der Ellenbeuge. Gleich werden die Medikamente kommen …
Es tat so weh!
Denk an etwas Schönes.
… Konnten Vögel Stimmen hören? So wie er? …
Thomas ging in die Knie. Seine Beine waren weich. Sie wollten ihn nicht mehr halten. Wie ein mit lauwarmem Wasser gefüllter Luftballon lag seine Blase im Unterleib, machte sich breit und breiter, drückte gegen Darm und Bauchdecke, schob alles zur Seite. Der Ballon drückte auf Muskeln und Nerven.
Weißt du noch, fragte Nummer eins, wie sie uns angesehen hat? In der Apotheke? Wir haben unsere Pillen geholt. Sie hatte ihr Haar nach oben gesteckt und wir sahen ihren Nacken. Jedes kleine Härchen und sogar den Leberfleck hinter ihrem Ohr.
Thomas erinnerte sich. Wie schön die Frau war. Wie verwirrt er den Kopf unter ihrem Blick senkte und sein Herz raste und … und er das Wasser nicht mehr halten konnte, es einfach so aus ihm herausgelaufen war, am Tresen der Apotheke.
Warme Tropfen fielen auf seine Hand.
Endlich ließ er es laufen! Und es tat ihm so unendlich gut. So gut. Thomas atmete tief und hörbar aus, der erste Laut, den er seit Stunden von sich gab.
Als der Urin in seine Thermoskanne sprudelte, klang es erstaunlicherweise genau so, wie wenn er am Morgen heißes Wasser einfüllte und seinen Melissentee aufgoss. An Tagen wie diesem. Zuerst das laute, erste Auftreffen von Flüssigkeit am Boden der Metallkanne, anschließend plätscherte es gleichbleibend. Nur die Höhe des Tones änderte sich dabei, war zuerst tief und wurde langsam, mit zunehmendem Flüssigkeitsstand, immer höher. Und genau so klang es jetzt auch, selbst die Flasche wurde außen etwas warm.
Nummer zwei hatte sich wieder einmal geirrt, denn das Licht ging nicht an, die Fahrstuhltür öffnete sich nicht und demzufolge blieben ihm auch die anderen Peinlichkeiten erspart.
Aber es hätte sein können.
Der Schmerz verließ seinen Unterleib, ganz langsam, gerade so, dass Thomas diesem Gehen folgen konnte und voll Dankbarkeit wahrnahm, wie Zufriedenheit den Platz des Schmerzes einnahm. Er war gerettet!
Thomas hielt die Augen während des Urinierens geschlossen. Als er fertig und die Flasche zu drei Vierteln gefüllt war, schraubte er den Verschluss sorgfältig wieder zu und tastete sich zu seiner schwarzen Aktentasche. Hier würde niemand etwas anderes als Tee vermuten und niemals würde jemand von diesem Moment erfahren.
Hättest du doch noch ein paar Minuten gewartet, jammerte Nummer drei. Wenigstens fünf. Dann wären wir geplatzt, hihi. Ach, wär das schööön gewesen! Unser Blut und unsere Innereien kleben an den Wänden und vermischen sich mit dem, was du jetzt in der Flasche da versteckst! Dass du immer alles verderben musst, du böser, böser Junge! Oh, ich bin sooo traurig … und tatsächlich tönte die Stimme voller Weltschmerz durch Thomas’ Kopf.
Über dreizehn Stunden dauerte nun schon seine Einzelhaft hier im Aufzug. Inzwischen hatte er jegliches Zeitgefühl verloren. Hatte die Welt sich weitergedreht? War überhaupt Zeit vergangen? Oder geschah dies alles vielleicht in einem winzigen Moment, in dem er die Augen kurz geschlossen und geträumt hatte, und kam ihm nur als dieser unendlich lange Zeitraum vor? Er wusste es nicht, wusste nicht, ob es heute oder morgen war. Oder vielleicht auch gestern. War er allein im Aufzugsschacht oder war der Tod inzwischen näher gekrochen und suchte seine Witterung mit schnüffelnder Nase? Es war egal. Er hatte Wasser gelassen und der krampfende Schmerz war weg. Endlich glitt er die Kabinenwand hinab und hockte sich auf den kalten Boden. Alles andere zählte nicht.