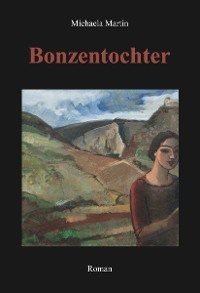Kitabı oku: «Bonzentochter», sayfa 3
Ich bin seit fünf Jahren mit Klaus zusammen und bis heute immer treu gewesen. Dazu hat mich meine Mama erzogen und so soll es auch bleiben, selbst wenn es ab und zu schwerfällt.
Sollte ich mit Klaus zusammenbleiben, steht zu befürchten, dass ich in einem der wichtigsten und vor allem aufregendsten Bereiche meines Lebens weit unterdurchschnittlich bleibe. Ich habe es immer gehasst, Mittelmaß zu sein, musste aber lernen, es zu akzeptieren. Damit habe ich mich inzwischen abgefunden, alles andere wäre lächerlich. Aber muss ich denn wirklich in Sachen Liebeserfahrung unter dem Durchschnitt bleiben? Das wäre doch zu ärgerlich!
Schluss mit trüben Gedanken, egal ob Durchschnitt oder nicht, heute Abend heißt mein Traummann Klaus, alles Weitere ergibt sich später.
Meine Freundin Karin leistet in diesem Bereich weit Überdurchschnittliches, so viel steht heute schon fest. Auf ihren Neuen bin ich schon sehr gespannt, obwohl sie immer demselben Beuteschema erliegt und ihre Männer alle aussehen wie die kleinen Brüder von Alain Delon, was ja grundsätzlich für einen guten Geschmack spricht.
Wir müssen morgen unbedingt mit den beiden ins Kino gehen. Wenn ich richtig nachrechne, geht Karin jetzt schon fünf Wochen mit Toni. Wie ich das Tempo meiner Freundin kenne, neigt sich der erst Liebesrausch auch schon wieder dem Ende zu. Es besteht die Gefahr, dass Toni morgen schon wieder Geschichte ist, und zwar bevor ich seine Bekanntschaft gemacht habe. Das wäre wirklich schade, denn ich habe den Ehrgeiz, jeden Lover meiner Freundin mindestens einmal zu sprechen. Schon um mir die Frage beantworten zu können, ob ich mit meiner spießigen, monogamen Beziehung mit Klaus Wesentliches verpasse. Bisher kommt noch kein Neid auf, aber man weiß ja nie, wen Karin noch anschleppt.
Ich habe Durst und gehe zurück in die Küche, um eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank zu nehmen. Vergeblich suche ich ein Wasserglas im Küchenschrank. Kurzfristig bin ich versucht, aus der Flasche zu trinken, eine kleine Schwäche aus meiner Singlezeit. Aber die ist ja nun vorbei, inzwischen bin ich ja eine Art Mutterersatz und muss Vorbild für meine kleine Schwester sein.
Seitdem ich in einer Wohngemeinschaft lebe, habe ich mir angewöhnt, aus einem Glas zu trinken, in der stillen Hoffnung, dass es meine Mitbewohner mir gleichtun. Ich liebe sie zwar beide sehr, aber der Gedanke, dass wir alle drei abwechselnd an ein und derselben Mineralflasche nuckeln, ist mir zuwider. Doch auch in der Spülmaschine werde ich nicht fündig. Das Geschirr der letzten zwei Tage steht dreckig in der Maschine und verströmt einen leicht säuerlichen Geruch. Die Spülmaschine ist das einzige Luxusobjekt in unserem Haushalt und wurde ausschließlich zur Wahrung des Familienfriedens angeschafft. Den handbetriebenen Abwasch hassen wir alle drei so sehr, dass an der Spülmaschine kein Weg vorbeiführte. Wir wollten nicht riskieren, dass wir uns wegen dreckigem Geschirr ständig in den Haaren liegen. Erstaunlicherweise hat keiner ein Problem damit, das dreckige Geschirr in die Spülmaschine zu stellen und auch das Ausräumen der Maschine klappt in der Regel wunderbar. Der heutige Tag beweist allerdings, dass wir noch daran arbeiten müssen, dass sich immer auch einer finden muss, der die Spülmaschine in Betrieb setzt. Das Problem wird sich lösen lassen, da bin ich mir sicher.
Schnell schließe ich die Spülmaschinentüre wieder und vergesse spontan alle meine guten Vorsätze und mein Grauen vor fremdem Speichel. Genüsslich setze ich die kühle Mineralflasche an meinen Mund und lasse das eiskalte Wasser meinen Rachen herunter rinnen. Nachdem ich die Flasche wieder in den Kühlschrank gestellt habe, setze ich mich an den Küchentisch, um einen kurzen Blick in die Post zu werfen.
Kapitel 2
Welche Tochter ist entführt worden? Ich habe keine Tochter. Wenn es sich um keinen makaberen Scherz handelt, dann muss der Brief aus Versehen bei mir gelandet sein. Ein Irrtum des Postboten? Nein, der scheidet aus, denn ohne Briefmarke wird kein Briefträger tätig. Es handelt sich auch nicht um eine Nachricht in einem Umschlag, sondern es ist nur ein DIN A4-Blatt. Der Entführer muss sich im Briefkasten geirrt haben! Mir wird plötzlich schlecht, mein Magen rebelliert. Jetzt nur keine Panik! Ich schließe die Augen und atme mehrfach tief durch. Es nutzt nichts: Mein Puls ist auf 200, mein Herz rast. Jetzt spinnst du komplett, rede ich mir ein. Ich bin überarbeitet, meine Nerven liegen blank. In wenigen Minuten wird sich alles aufklären. Wahrscheinlich sehe ich zu viele Krimis und die Fantasie geht mit mir durch. Ich schließe die Augen und versuche erneut, mich zu beruhigen. Mensch, mein Badewasser, bitte, bitte, nicht auch noch eine Überschwemmung! Panisch springe ich auf und renne in das Badezimmer. Ich habe noch einmal Glück gehabt. Nichts ist passiert. Während ich den Wasserhahn zudrehe, versuche ich, einen klaren Gedanken zu fassen.
Zu meinen angeborenen Stärken gehört, dass ich normalerweise in Stress- und Krisensituationen innerlich ganz ruhig werde. Kalt, ich spüre dann nichts mehr; keine Angst, keinen Druck, überhaupt keine Emotionen. Ich bin in der Lage, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dieser Eigenschaft verdanke ich es, dass ich als mittelmäßige Schülerin und Studentin immer bessere Noten geschrieben habe, als es mein Wissensstand erhoffen ließ, sehr zum Neid meiner nervösen Mitschüler. Auf dieses Talent muss ich mich jetzt besinnen, sonst drehe ich noch durch!
Also, noch einmal ganz von vorne: Was ist eigentlich passiert? Im Briefkasten liegt ein anonymes Schreiben, ein Fetzen Papier, in dem ein unbekannter Verfasser mitteilt, dass er eine Tochter entführt hat. Er droht an, sie umzubringen, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Fakt ist, dass ich keine Tochter habe, sondern nur eine kleine Schwester. Wenn ich überhaupt der richtige Adressat dieser Nachricht bin, dann kann mit Tochter nur Sylvie gemeint sein. Warum sollte jemand Sylvie entführen? Wir haben kein Geld. Welchen anderen Grund sollte es sonst für eine Entführung geben? Es bleibt nur eine Erklärung: Es handelt sich um den unheimlichen Scherz eines Irren. Oder aber es liegt eine Verwechselung vor. Wahrscheinlich spielen sich in unserer Nachbarschaft wahre Dramen ab. Vielleicht hat sich der Verfasser dieses Schreibens auch nur im Briefkasten geirrt. Vor menschlichem Versagen ist schließlich keiner gefeit. Da stellt sich die Frage, wem unserer Nachbarn die Drohung gelten könnte. Was weiß ich eigentlich von ihnen? Wenn ich so darüber nachdenke, komme ich sehr schnell zu dem Ergebnis, dass ich unsere umliegenden Anwohner nicht kenne. Auf keinen Fall überblicke ich ihre Vermögensverhältnisse und könnte einschätzen, ob sie reich genug sind, um für einen Entführer interessant zu sein. Ein stadtbekannter CSU-Politiker mit seiner Familie wohnt nicht weit von uns in der nächsten Straße. Ich kenne die Familie vom Sehen. Vielleicht ist es doch ein politischer Racheakt, der einen allzu forschen Jungpolitiker in die Knie zwingen soll? Das glaube ich aber nicht, denn der Abgeordnete Singer fällt nicht durch provokative Thesen auf. Also bleibt nur noch die ganz normale Familientragödie, von denen man regelmäßig in den Boulevard-Zeitungen liest.
Ich werde noch wahnsinnig! Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich zu dem Ergebnis, dass alles keinen Sinn macht. Ich zwicke mich in den Arm und stelle fest, dass es richtig wehtut. Leider fantasiere ich nicht. Ich bin hellwach und erlebe einen Albtraum.
Plötzlich kommt mir der rettende Gedanke: Warum nur bin ich nicht schon viel früher darauf gekommen? Ich muss Sylvie irgendwie erreichen. Dann hat der ganze Spuk ein Ende. Um sicherzugehen, dass ich nicht den Verstand verliere, renne ich in ihr Zimmer. Ist sie unbemerkt doch schon nach Hause gekommen?
„Sylvie, Sylvie!“, schreie ich durch den Flur. Es bleibt still. Meine Schwester ist definitiv nicht da.
Nächster Schritt: Ich muss in der Schule anrufen, vielleicht erwische ich sie dort. Ich suche hektisch nach der Nummer in meinem Telefonbuch. Na, wunderbar, da steht sie natürlich nicht. Weder unter „W“ wie Willy Graf Gymnasium, noch unter „S“ wie Schule finde ich einen Eintrag. Ich habe keine Geduld, um jetzt im Telefonbuch die Nummer herauszusuchen, deshalb wähle ich die Nummer der Telefonauskunft. Ich habe Glück, denn die Leitung ist wider Erwarten nicht besetzt. Zwei Minuten später habe ich die Rufnummer des Gymnasiums. Es ist später Freitagnachmittag, sodass kein Mensch mehr im Büro der Schule anzutreffen ist, das hätte ich mir vorher denken können. Als das Freizeichen und anschließend das Band des Anrufbeantworters ertönt, lege ich den Hörer enttäuscht auf.
So komme ich nicht weiter. Was mache ich jetzt bloß? Das Sinnvollste wäre, die Polizei sofort einzuschalten. Aber was ist, wenn mich der Entführer beobachtet und seine Drohung wahrmacht? Was soll ich nur tun? Seit Jahren habe ich nicht mehr gebetet. In diesem Moment fällt mir nichts Besseres ein, als um Hilfe zu bitten. Also spreche ich leise ein schnelles Gebet: „Lieber Gott, bitte mach‘, dass alles nur ein böser Albtraum ist. Bitte, mach‘, dass Sylvie nichts passiert ist.“
Aus heiterem Himmel geht mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Nicht Sylvie ist entführt worden, sondern die Tochter unserer Vermieter muss das Opfer sein. Je länger ich darüber nachdenke, umso sicherer erscheint mir diese Erklärung. Es passt viel besser zusammen.
Der Münchner Norden ist eine geschlossene Gesellschaft. Da wird jeder Neuzugang erst einmal argwöhnisch beobachtet, ganz besonders, wenn es sich wie bei uns um drei junge Menschen mit undurchsichtigen Familienverhältnissen handelt. Sylvie, Klaus und mich kennt man inzwischen, aber nur vom Grüßen. In Freimann geht es zu wie auf dem Dorf, man grüßt artig, immer wenn man sich trifft. Das haben wir schnell begriffen und halten uns an die Sitten und Gebräuche unseres neuen Wohnviertels. Darüber hinaus haben wir aber keinen Kontakt zu unserer Nachbarschaft. Wir verdanken es dem hohen Ansehen unserer Vermieter und unserem Selbstbewusstsein, dass wir uns in Freimann nicht als Außenseiter fühlen. Unsere Vermieter sind uns in den letzten Monaten richtig ans Herz gewachsen. Ich liebe meine regelmäßigen Treffen mit Frau Braun in unserer gemeinsamen Waschküche. Wenn es unsere Zeit zulässt, nutzen wir die Gelegenheit und unterhalten uns über Gott und die Welt, während wir uns nebenbei um unsere Wäsche kümmern. Unser Themenbogen ist weit gespannt. Wir reden über Freud und Leid der deutschen Hausfrau, genauso wie über Atomkraft und neueste Modetrends. In Anbetracht der Tatsache, dass zwischen meiner Vermieterin und mir eine Generation liegt, ist es erstaunlich, wie oft wir einer Meinung sind.
Die einzige Tochter des Ehepaars Braun hat vor zwei Jahren geheiratet und lebt mit ihrem Mann in Garching, keine zehn Kilometer von ihren Eltern entfernt. Die Welt der Familie scheint bis zu diesem Zeitpunkt rundherum in Ordnung zu sein.
Während ich die Treppe hinuntergehe, plagt mich ein fürchterlich schlechtes Gewissen, denn ich wünsche mir so sehr, dass das weiße Blatt mit den schwarzen Buchstaben nur aus Versehen in unserem Briefkasten gelandet ist. Ich hoffe, dass es nur deshalb bei uns lag, weil unsere Postkastenklappe direkt über der von Brauns ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass ihre Post zu uns kommt. Es liegt nahe, dass auch Entführer sich vertun, insbesondere dann, wenn sie unter Druck stehen. Ich hasse die Rolle als Überbringerin einer so schrecklichen Botschaft und das ausgerechnet bei so liebenswerten, netten Menschen wie Brauns es sind. Bevor ich an der Wohnungstür unserer Vermieter ankomme, bin ich der festen Überzeugung, dass man Marie entführt hat und nicht Sylvie.
Ich drücke auf die Klingel und habe dabei ein sehr unbehagliches Gefühl in der Magengegend. Wie wird Frau Braun reagieren, wenn sie die schreckliche Wahrheit erfährt? Wie sagt man einer Mutter, dass ihre Tochter vermutlich entführt worden ist? Was mache ich nur, wenn keiner zu Hause ist? Viel Zeit zum Nachdenken bleibt mir nicht. Denn nachdem ich geläutet habe, höre ich, wie die Wohnzimmertür geöffnet wird und jemand die Diele entlangkommt. Kurz darauf steht Frau Braun vor mir und grüßt mich wie immer sehr freundlich.
Ich entscheide blitzschnell, mich nicht mit Höflichkeitsfloskeln aufzuhalten, sondern komme sofort zum Grund meines Besuches: „Das habe ich heute in unserem Briefkasten gefunden.“ Noch während ich rede, halte ich ihr das Papier mit den bedrohlichen Wörtern hin.
Sie nimmt es und fängt an zu lesen. Ich beobachte sie genau und frage ungeduldig: „Was halten Sie davon?“
„Ich verstehe es nicht. Was ist das?“ Frau Braun schaut mich irritiert, aber keineswegs erschrocken an.
„Das weiß ich auch nicht“, antworte ich ihr ehrlich. „Ich dachte, Sie könnten es mir vielleicht erklären, denn ich habe keine Tochter.“
Langsam ahnt sie, worauf ich hinauswill: „Sie glauben doch nicht, dass Marie entführt worden ist?“
„Ich bin mir nicht sicher“, antworte ich ihr wahrheitsgemäß. „Ich weiß nur, dass ich keine Tochter habe.“
Mein Strohhalm, an dem ich mich krampfhaft festhalte, heißt Marie, so leid es mir für ihre Mutter auch tut. Sylvie kann nicht das Entführungsopfer sein, sie darf es nicht sein!
Frau Braun reagiert in Anbetracht der schrecklichen Neuigkeit erstaunlich gefasst. Ihre Ruhe hat auch einen guten Grund, den sie mir bereitwillig erklärt: „Marie ist zu Hause, das weiß ich, weil ich noch vor ein paar Minuten mit ihr telefoniert habe.“
„Ach, wirklich?“ Ich spüre, wie sich sowohl Enttäuschung als auch neue Panik in mir breit machen.
„Ja, es ist noch keine fünf Minuten her.“
Wenn das wahr ist, dann kann Marie wirklich nicht gemeint sein, denn ich habe das Blatt schon vor fast einer Stunde aus unserem Briefkasten geholt.
Frau Braun bemerkt offensichtlich, welche Wirkung ihre Worte auf mich haben und versucht, mich zu trösten: „Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sie werden sehen, das Problem löst sich von ganz alleine.“
Ich hasse Sprichwörter, ganz besonders in solch einer Situation, denn sie bringen mich kein Stück weiter. Nichts wird sich einstellen, wenn wir nicht irgendetwas unternehmen. In diesem Punkt bin ich mir ganz sicher. Aber was soll ich jetzt tun? Hilflos stehe ich immer noch an der Tür und warte auf eine Eingebung.
Wahrscheinlich tue ich Frau Braun sehr leid, denn sie schlägt vor: „Zur Sicherheit kann ich noch einmal bei Marie anrufen, dann wissen wir Bescheid.“
Obwohl ich kaum noch daran glaube, dass Marie entführt worden ist, nicke ich ihr dankbar zu. Ich spüre genau, sie will mir helfen und allein das tut schon gut.
„Ja, tun Sie das ruhig, obwohl ich jetzt auch nicht mehr glaube, dass man Ihre Tochter gegen ihren Willen mitgenommen hat. Aber bitte sagen Sie Marie nichts von der Entführung. Sie haben selbst gelesen, dass ich die Polizei nicht einschalten soll, wenn ich nicht riskieren möchte, dass Sylvie umgebracht wird.“
Ich habe Angst, dass das Haus beobachtet wird. Vielleicht riskiere ich schon Sylvies Leben, wenn jemand mitbekommt, dass ich mit Frau Braun spreche. Mir wird schlagartig bewusst, dass ich die Verantwortung für Sylvies Leben habe. Ich, die ältere Schwester, nicht die Eltern im fernen Frankfurt. Sie haben ihre elterlichen Pflichten auf mich übertragen. Wenn heute etwas schiefläuft, bin ich dann alleine schuld? Habe ich etwas falsch gemacht? Hätte ich besser auf meine kleine Schwester aufpassen müssen? Vielleicht wäre uns dann dieser schreckliche Tag heute erspart geblieben! Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort weiß.
Dem Blick meiner Vermieterin sehe ich an, dass sie nicht versteht, worum es mir geht, deshalb sehe ich mich veranlasst, meine Bitte zu begründen: „Je mehr Menschen von der Sache Kenntnis haben, umso größer ist die Gefahr, dass irgendjemand die Polizei einschaltet. Können Sie sich das nicht vorstellen? Ich möchte auch niemanden hineinziehen. Am besten ist es deshalb, Sie stellen Marie irgendeine belanglose Frage.“
„Glauben Sie wirklich, dass Marie die Polizei einschalten würde?“, fragt Frau Braun, mehr interessiert als böse oder gar beleidigt. Sie wundert sich offensichtlich darüber, was ich ihrer Tochter alles zutraue.
„Ich weiß es nicht, wirklich nicht“, antworte ich wahrheitsgemäß. „Aber Sie können es auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, oder? Warum also sollen wir ein Risiko eingehen, wenn es nicht sein muss? Marie braucht den wahren Grund Ihres Anrufs nicht zu erfahren. Später können Sie es ihr immer noch sagen.“
Auf keinen Fall möchte ich meine Vermieterin oder ein Mitglied ihrer Familie brüskieren, aber noch weniger will ich das Leben meiner Schwester auf irgendeine Weise gefährden. Mein bittender Blick hat Erfolg, denn sie sagt jetzt: „Sie haben Recht. Meine Tochter wäre auch nur unnötig beunruhigt und das ist nicht erforderlich. Ich werde Marie sofort anrufen und sie fragen, ob es dabei bleibt, dass sie mit ihrer Familie am Sonntagmittag zu uns zum Essen kommt. Das habe ich vorhin nämlich vergessen. Ich bin sicher, sie schöpft keinen Verdacht, denn wir rufen uns immer mehrfach am Tag an.“
„Vielen Dank, Frau Braun, für alles.“ Ich bin erleichtert über ihr Verständnis. Außerdem tut es mir gut, dass sie so erstaunlich gefasst bleibt.
So kann man sich in einem Menschen täuschen, geht es mir durch den Kopf, als ich die Treppe zu unserer Wohnung wieder hinaufgehe. Ich habe meine Nachbarin immer für eine überängstliche und leicht nervöse Frau gehalten. Warum eigentlich? Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie mir im Verlauf unserer zahlreichen Waschküchengespräche häufig von ihren Sorgen um ihre Tochter, deren Mann und natürlich ihrem Enkelkind erzählt hat. Ängste, um die sie viele Mütter und Großmütter in Deutschland beneidet hätten, denn es ging dabei lediglich um Kinderkrankheiten, den ganz normalen Hausfrauenstress und die Wahl der richtigen Geigenlehrerin. Frau Braun nimmt großen Anteil an den Alltagsproblemen ihrer erwachsenen Tochter. Eventuell liegt es daran, dass Marie als Einzelkind in dem Bewusstsein aufgewachsen ist, der Nabel der Welt zu sein. Bei Familie Braun dreht sich auch heute noch alles um die Tochter.
Meine Nachbarin hat mir versprochen, dass sie mich umgehend informiert, sobald sie mit Marie telefoniert hat. Aber nach dem Gespräch mit ihr mache ich mir keine Illusionen mehr darüber, dass Marie statt Sylvie gewaltsam entführt worden sein könnte. Ich muss den Fakten in die Augen sehen. Meine kleine Schwester ist das Opfer einer Entführung geworden. Mir droht der Boden unter den Füßen zu entgleiten. Alles um mich herum dreht sich, sodass ich mich am Treppengeländer festklammere. Was mache ich jetzt bloß? Nein, ich darf nicht in Panik geraten! Ich muss unbedingt Ruhe bewahren, denn es gibt für jedes Problem auf der Welt eine Lösung. Nur welche? Was um alles in der Welt kann ich nur tun?
Sobald ich in unserer Wohnung angekommen bin, setze ich mich an den Küchentisch und starre zum Fenster hinaus. Ich warte, dass etwas passiert, dass ein Wunder geschieht, oder sich die letzten Stunden als Traum herausstellen.
Erst durch das Klingeln an der Tür werde ich wieder aufgerüttelt. Es ist Frau Braun, die mir bestätigt, was ich sowieso schon weiß: Ihre Tochter sitzt mit Mann und Kind gesund zu Hause. Natürlich ist meine Nachbarin ungeheuer erleichtert, als sie mir diese Nachricht überbringt. Ich kann sie gut verstehen, auch wenn damit der letzte Funken Hoffnung in mir erlischt.
Frau Braun, die gute Seele, ahnt wohl, was in mir vorgeht und fragt ganz vorsichtig: „Was machen wir denn nur? Wollen Sie nicht doch die Polizei kontaktieren?“
„Nein, auf keinen Fall“, antworte ich spontan, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken. „Ich rufe jetzt erst einmal meine Eltern an und informiere sie über die Ereignisse. Danach werde ich wissen, was zu tun ist.“
Frau Braun schaut mich erstaunt an: „Ja, haben Sie denn noch gar nicht mit Ihren Eltern gesprochen?“
„Nein, das habe ich bisher noch nicht getan“, entgegne ich ihr. Den Grund für mein Verhalten verschweige ich ihr lieber. Ich kann ihr schlecht beichten, dass ich bis vor wenigen Minuten noch die Hoffnung hatte, dass ihre Tochter und nicht meine Schwester entführt worden ist. Aus meiner Sicht der Dinge habe ich meine Eltern nur davor bewahrt, unnötig in Panik versetzt worden zu sein. Dieses Argument gilt nun aber nicht mehr.
„Ja, dann wird es jetzt aber höchste Zeit, dass Sie das nachholen.“ Ich meine aus der Stimme meiner Vermieterin einen leicht vorwurfsvollen Unterton herauszuhören. Sie, die es gewöhnt ist, dass sie von Marie über jede Kleinigkeit unterrichtet wird, kann es natürlich nicht verstehen, dass ich meine Eltern immer noch nicht über die Entführung ihrer jüngsten Tochter in Kenntnis gesetzt habe. Wie soll sie auch?
Frau Braun schaut mich immer noch erwartungsvoll an, und deshalb sehe ich mich veranlasst, sie zu beruhigen: „Sie haben Recht. Ich muss unbedingt meine Eltern anrufen. Ich sollte mich mit ihnen abstimmen, ob wir die Polizei einschalten, oder nicht. Die Verantwortung kann ich alleine nicht tragen!“
Frau Braun scheint besänftigt zu sein, denn sie bietet mir noch einmal ihre Hilfe an: „Ihnen ist hoffentlich bewusst, dass mein Mann und ich immer für Sie da sind. Das gilt selbstverständlich auch für die gesamte Nacht. Wenn wir irgendetwas für Sie tun können, dann lassen Sie es uns bitte wissen, wir helfen gerne.“
„Vielen Dank. Aber im Moment wüsste ich nicht, was Sie für mich tun könnten. Vielleicht komme ich später auf Ihr Angebot zurück.“
Meine Nachbarin macht immer noch keine Anstalten, wieder in ihre Wohnung zurückzugehen. Stattdessen malt sie sich Sylvies Schicksal in den Händen der Entführer aus: „Wenn ich mir vorstelle, welche Todesangst das arme Kind haben muss! Was sind das nur für Menschen, die so etwas tun? Das ist zum Verrücktwerden! Vielleicht geschieht doch ein Wunder und Sylvie steht heute noch unverletzt vor der Tür.“
Langsam werde ich ungeduldig. Es ist wirklich an der Zeit, dass ich zu Hause anrufe. Ich möchte das Gespräch mit Frau Braun schleunigst beenden, deshalb antworte ich bestimmt, wenn auch nicht unfreundlich: „Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber leider glaube ich nicht mehr an Wunder. Seien Sie mir nicht böse, aber ich muss Sie jetzt bitten zu gehen, denn ich möchte unbedingt meine Eltern sprechen. Ich werde Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, das verspreche ich Ihnen.“
„Tun Sie das. Ich mache die ganze Nacht bestimmt kein Auge zu, das ahne ich jetzt schon. Also haben Sie keine Angst bei uns zu klingeln, wenn Sie etwas brauchen.“
„Das mache ich bestimmt“, sage ich.
Frau Braun geht zurück ins Treppenhaus und ich schließe die Tür.
Es gibt leider wirklich keine Wunder. Weder steht Sylvie unverletzt vor der Tür, noch reagieren meine beiden Eltern anders, als ich es im Stillen erhofft habe. Ich fürchte mich vor dem Telefonanruf. Das wird mir bewusst, als ich zum Telefon gehe und zitternd anfange, die Nummer meiner Eltern zu wählen. Ich hoffe, dass sie zu Hause sind, obwohl ich Angst vor ihrer Reaktion habe. Im Sommer gehen unsere Eltern um diese Uhrzeit sehr häufig ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: Mutter spielt Tennis und Vater schaut ihr dabei von seinem Stammplatz an der Bar zu.
Nach dem vierten Klingelzeichen höre ich meine Mutter: „Schneider“, spricht sie klar und deutlich, wie es ihre Art ist.
„Ich bin’s.“ Mehr sage ich nicht, aber das ist auch nicht nötig. Eine Mutter erkennt die Stimme ihres Kindes immer und überall. Und nicht nur das, sie weiß auch schon nach ein oder zwei Worten, ob sie Grund zur Sorge hat. Die Tonlage verrät uns immer.
So ist es auch dieses Mal. Mutter ahnt sofort: Irgendetwas stimmt nicht in München. Ihre Frage kommt prompt: „Ist etwas passiert? Um diese Uhrzeit rufst du doch sonst nicht an.“
Das stimmt. Wir haben uns nämlich darüber verständigt, dass wir immer sonntags vormittags anrufen. Um diese Uhrzeit sind wir drei nicht nur mit Sicherheit aus dem Bett aufgestanden, sondern haben auch schon gefrühstückt. Kurz nachdem Sylvie bei uns eingezogen war, gab es über die Frage des richtigen Zeitpunkts für die regelmäßige Berichterstattung Ärger. Mutter rief während der ersten zwei Wochen nahezu täglich an, weil sie die mütterliche Fürsorge oder das schlechte Gewissen an den Telefonhörer trieb. Das nervte, denn so viel Neues passierte bei uns nicht, dass wir jeden Tag etwas zu berichten gehabt hätten. Sylvie ließ sich ständig verleugnen und ich fühlte mich kontrolliert, was ich hasse wie die Pest. Wir klärten das Problem. Seitdem ruft Mutter immer am Wochenende an. Unsere Eltern essen seit Jahrzehnten sonntags um 12:30 Uhr zu Mittag. Deshalb waren wir uns sehr schnell einig, dass wir uns bis circa 11 Uhr melden, wenn wir Mutter nicht den Sonntagsbraten verderben wollten, denn das Gespräch dauerte in der Regel gut eine Stunde.
Mutter wartet auf eine Antwort. Es ist ihre besorgte Stimme am anderen Ende der Leitung, die mich aus der Bahn wirft. Ich bringe keinen Ton heraus, die Worte bleiben mir im Hals stecken.
„Hallo!“, ertönt es ungeduldig in der Leitung.
Ich stehe mit dem Hörer in der Hand und kann kein Wort sagen.
„Martina, du bist es doch, melde dich!“
Noch immer bin ich nicht in der Lage, mich zu äußern. Die Stimme meiner Mutter wird lauter und erregter. Sie ahnt, dass das Schweigen am anderen Ende der Leitung nichts Gutes bedeutet. Ich bleibe stumm.
„Du treibst mich in den Wahnsinn, Kind, nun rede doch endlich! Was ist so schrecklich, dass es dir die Sprache verschlägt?“
Ich möchte sprechen, aber es geht nicht. Die Situation ist für uns beide so quälend, dass ich beschließe, dem traurigen Spiel ein Ende zu bereiten. Ich lege auf.
Mutter wird innerhalb der nächsten Minuten zurückrufen, das ist sicher. Bis dahin habe ich Zeit, meine Fassung wiederzufinden. Ich kenne Mutter. Zur Beruhigung wird sie sich jetzt erst einmal eine Zigarette anstecken und über den seltsamen Telefonanruf nachdenken. Mit dem letzten Zug kommt sie zu dem Entschluss, dass sie Gewissheit braucht. Sie drückt die Zigarette im Aschenbecher aus und greift erneut zum Telefonhörer. Ich habe höchstens fünf Minuten Zeit, um meine Sprache zurückzuerlangen. Bis dahin muss ich mir überlegt haben, wie ich ihr schonend beibringe, dass ihre jüngste Tochter entführt worden ist.
Mein Mund ist trocken. Ich hole mir die Flasche, setze sie an und nehme einen tiefen Zug. Dann setze ich mich wieder hin und starre zum Fenster hinaus, ohne etwas wahrzunehmen.
Ich bin im Begriff aufzustehen, um Mutter noch einmal anzurufen, als auch schon das Telefon läutet. Wie ich nicht anders erwartet habe, ist sie am Apparat und möchte endlich wissen, was geschehen ist. Ohne lange nachzudenken, beantworte ich ihre Frage: „Sylvie ist entführt worden“, meine Stimme ist zurückgekehrt, ich rede klar und deutlich.
„Was ist passiert?“ Mutter hofft, dass sie sich verhört hat. Leider kann ich sie nicht verschonen und wiederhole stereotyp den Satz:
„Sylvie ist entführt worden.“
„Entführt? Warum ist Sylvie entführt worden?“
Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. Einen kurzen Augenblick verliere ich die Fassung. Ihre Reaktion macht mich ärgerlich, weil ich mich von Mutter persönlich angegriffen fühle. Ziemlich patzig antworte ich ihr deshalb: „Das weiß ich doch nicht, das musst du die Entführer fragen, nicht mich!“
„Was wollen die von uns?“
„Auch das kann ich dir nicht beantworten!“
Mit der nächsten Frage beweist Mutter, dass sie und ich die gleichen Schutzmechanismen haben, die uns davor bewahren, nach dem ersten Schock in Panik zu verfallen. Wir verdrängen die Tatsachen und flüchten uns in die verzweifelte Hoffnung, dass alles nur ein schrecklicher Irrtum sei. So wie ich auf die Idee kam, dass Marie das Entführungsopfer sein könnte, meldet Mutter nun auch Zweifel an meiner Aussage an: „Wie kommst du überhaupt darauf, dass Sylvie entführt worden ist?“
„In unserer Post war heute ein anonymes Schreiben, in dem steht, dass meine Tochter entführt worden ist, und dass ich die Polizei nicht einschalten soll, wenn ich sie lebend wiedersehen möchte.“
„Welche Tochter? Du hast doch gar kein Kind!“
Obwohl ich mich vor noch nicht allzu langer Zeit in dieselben Hoffnungen gestürzt habe, werde ich meiner Mutter gegenüber immer aggressiver. Meine Antworten fallen kürzer aus und der Ton wird beißender: „Das weiß ich auch.“
Mutter lässt nicht locker: „Ja, wieso bist du der Meinung, dass damit Sylvie gemeint ist?“
„Weil sie nicht zu Hause ist und der Zettel in unserem Briefkasten lag.“
„Könnte es sich um eine Verwechslung handeln?“
„Um welche Verwechslung denn?“
Es ist frappierend. Mutter stellt mir exakt die gleichen Fragen, die auch ich mir noch vor einer Stunde gestellt habe. Es muss an unserem Überlebenswillen liegen, dass wir Menschen Grausamkeiten erst einmal verdrängen, bevor wir ihnen in die Augen sehen.
„Der Zettel könnte fälschlicherweise in euren Briefkasten geraten sein. Vielleicht hat man ein Kind aus eurer Nachbarschaft entführt.“
„Das glaube ich nicht.“
„Warum nicht?“ Mutter bleibt hartnäckig.
„Sylvie müsste schon längst zu Hause sein.“
„Weswegen?“
„Sie war heute Nachmittag beim Sport in der Schule und der ist schon lange zu Ende.“
„Vielleicht ist sie noch zu Freunden nach Hause gegangen?“
„Dann hätte sie mich angerufen.“
„Das kann sie vergessen haben.“
„Sylvie versäumt so etwas nicht. Sie weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn sie nicht pünktlich hier ist.“
Es bleibt still am anderen Ende der Leitung. Mutter denkt offensichtlich über die nächsten Schritte nach. Das Ergebnis ihrer Überlegung überrascht mich sehr, denn sie ruft wider Erwarten ihren Mann an den Apparat. Ich werte das als Ausdruck tiefer Verzweiflung.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.