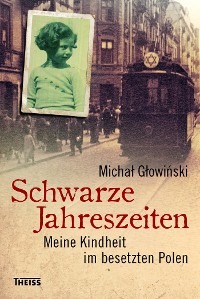Kitabı oku: «Schwarze Jahreszeiten», sayfa 3
Großvaters Selbstmord

Ich begegnete ihm nur wenige Male im Leben und er hat sich meinem Gedächtnis nicht allzu gut eingeprägt – im Gegensatz zu meinem Großvater mütterlicherseits, den ich von frühester Kindheit an kannte und den ich lange kannte, denn er überlebte den Krieg und starb im Jahre 1952, als ich schon studierte. Über diesen weniger vertrauten Opa möchte ich aber einige Worte schreiben, denn ich bewundere ihn für seine Entscheidung in einer Extremsituation.
Sein ganzes Leben verbrachte er in Słupca, doch eines Tages tauchte er bei uns in Pruszków auf. Er war damals nicht mehr jung, ich erinnere mich an einen großen, schlanken Mann, der leicht – aber deutlich – gebückt war. Ich war damals drei, höchstens vier Jahre alt und bin dem älteren Herrn, der mich auf die Knie nehmen wollte, ganz und gar nicht zugeneigt gewesen. Ich weiß nicht wieso, aber er löste bei mir Angst aus. Erst nach einiger Zeit wurde ich mit ihm vertraut. Doch nur kurz, denn nach einer Weile rief er bei mir Entsetzen hervor: Ich erschrak, als er unerwartet ein kleines rundes Käppchen aufsetzte, wie es die orthodoxen Juden tragen. Er war nicht orthodox, lebte aber in der jüdischen Tradition, in Einklang mit ihren Regeln, und es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade Sabbat war. Zwar wurden die religiösen Regeln in meinem Elternhaus nicht eingehalten, es bestand jedoch kein Grund, dass ein älterer Mensch ihnen nicht treu blieb, selbst wenn er sich nicht durch besondere Frömmigkeit auszeichnete. Ich weiß wirklich nicht, warum er mir von dem Moment an, in dem er das Käppchen aufsetzte, bedrohlich, merkwürdig, fremd vorkam – und ganz anders als noch vor einer Weile. Die Reaktionen kleiner Kinder sind sonderbar und schwer vorherzusagen, also habe ich keinen Grund, mich groß mit meinem Verhalten auseinanderzusetzen. Ich möchte nur anmerken, dass dieses plötzliche Entsetzen groß gewesen sein muss, da es eine meiner deutlichsten Erinnerungen aus der frühen Kindheit war.
Leider erinnere ich mich an den Großvater im Ghetto nicht, obwohl ich ihn zumindest gelegentlich gesehen haben muss. Ich weiß noch nicht einmal, aus welchen Gründen er sich hinter den Mauern in Warschau befand, mit dem er zuvor nichts zu tun gehabt hatte; ich weiß nicht, ob alle Juden aus Słupca hierhergebracht wurden oder ob er Bemühungen unternommen hatte, um zur Familie zu stoßen (er war seit mindestens einem Vierteljahrhundert Witwer). Er wohnte bei seiner ältesten Tochter, die in der Familie unter dem polonisierten Vornamen Zosia bekannt war, am anderen Ende des Ghettos, und somit für die Verhältnisse des abgeschlossenen und maximal komprimierten Stadtteils – sehr weit weg. Mir ist in Erinnerung geblieben, wie wir sie einmal mit Vater besuchten. Immer noch sehe ich ihren Mann vor Augen, der damals schon schwer krank war, mit geschwollenen Beinen im Bett lag und sehr litt (anscheinend gelang es ihm nicht, vor der Deportation nach Treblinka zu sterben). Ich erinnere mich aber nicht an meinen Großvater, obwohl er dort gewesen sein muss.
Alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, ist nur eine Vorbereitung auf die Reflexion über seine letzte Tat, eine Tat, zu der ich in Gedanken oft zurückkehre. Zur Reflexion, nicht zur Erzählung, denn ich weiß zu wenig über die wahren Geschehnisse, die damit einhergingen, um davon erzählen zu können. Ende Juli, Anfang August 1942 (das genaue Datum kenne ich nicht), nachdem die Deutschen schon mit der Deportation nach Treblinka begonnen hatten, beging mein Großvater Selbstmord. Er sprang aus dem zweiten oder dritten Stockwerk, sprang mit Erfolg, denn er war sofort tot. Ich erinnere mich, wie diese Nachricht bis an den entlegenen Rand des Ghettos gelangte, wo wir wohnten, und wie Vater sich um die Beisetzung kümmerte. Ich schreibe bewusst nicht Beerdigung, denn in der Zeit, in der die Deportationen vom Umschlagplatz nach Treblinka stattfanden, wurden im Ghetto keine Beerdigungen im normalen Sinn mehr organisiert. Die Leichen wurden in ein Massengrab auf dem jüdischen Friedhof geworfen. Hierher kam auch der Körper meines Großvaters. Ich weiß nicht, ob außer Vater ihn jemand bis zur Grube begleitete, in die man die Glücklichen fallen ließ, denen es gelungen war, hier, an Ort und Stelle, zu sterben … und der Gaskammer zu entgehen.
Ich würde viel darum geben, zu erfahren, welche gedanklichen und emotionalen Prozesse meinen Großvater zu seiner Entscheidung gebracht haben. In dem Augenblick, in dem er sie fasste, war er bereits ein alter Mann. Ich kenne sein genaues Geburtsdatum nicht, weiß aber, dass er zu Beginn der 1870er-Jahre auf die Welt gekommen ist, also in einer Zeit, in der selbst der pessimistischste Visionär sich keine Welt hätte vorstellen können, in der man massenhaft in Gaskammern ermordet wird. Einmal habe ich darüber gedacht: Der Holocaust betraf auch im 19. Jahrhundert geborene Menschen, also – kürzer – Menschen des 19. Jahrhunderts, die aus dieser Epoche ihre Sitten mitgebracht haben, ihre Weltsicht, Gewohnheiten und Vorurteile. Drei Jahrzehnte im Leben meines Großvaters entfielen auf dieses Jahrhundert, doch weiß ich nicht, ob man ihn einen Menschen des 19. Jahrhunderts nennen kann. Eher nicht, denn eine solche Bezeichnung wäre wahrscheinlich falsch; mein Großvater hatte mit Sicherheit keinen Kontakt zu den großen Ideen des vergangenen Jahrhunderts. Er hatte sich nicht in seine herrliche Literatur eingelesen, er war ein bescheidener Provinzkaufmann, der mit seinen Angelegenheiten beschäftigt war, er erzog seine Kinder und war bestrebt, dass seine nicht allzu große Firma der Familie die materielle Existenz sicherte. Und er hat wohl nicht viel von der Welt außerhalb von Słupca und dessen nächster Umgebung gesehen, die größten Brüche in seiner täglichen Routine waren Fahrten nach Posen von Zeit zu Zeit. Mein Großvater war ein einfacher Mensch, ein jüdischer Kleinbürger, der nur eine elementare Schulbildung besaß, und wenn ich nun gerade an seine Bescheidenheit und seine Normalität denke, kommt seiner finalen Geste in meinen Augen eine besondere Bedeutung zu.
Ich würde also viel dafür geben, zu erfahren, wie er zu dieser letzten Entscheidung gelangt ist. War ihm klar geworden, dass er keine Perspektiven mehr hatte? Er, Lajzer Głowiński, ein besonnener, höflicher, auf seine Weise religiöser Mensch, der die Siebzig überschritten hatte, war alt und kränklich, konnte also nicht damit rechnen, das Kriegsende zu erleben und zu einem normalen Leben zurückzukehren, in Słupca oder sonst irgendwo. Die Entscheidung könnte eine rein persönliche Dimension besessen haben, doch ich glaube, dass sie breitere Bezüge aufwies, etwa aufgrund des Zeitpunkts, zu dem sie umgesetzt wurde. In den Zeiten der Shoah gibt es keine privaten Selbstmorde, denn jeder Tod, vor allem ein solcher, wird gewissermaßen öffentlich. Ich kann nicht sagen, dass mein Großvater sich völlig im Klaren darüber war, was die Deportation nach Treblinka bedeutete, dass er sich bewusst war, dass es sich dabei um keine Ansiedlung im Osten oder um ein Arbeitslager handelte. Doch kann ich auch nicht ausschließen, dass er sich keinerlei Illusionen machte – und dass er nur einen Tod in Verachtung und Qualen vor sich sah. Er wollte ihm entkommen, wählte deshalb das, was er unter den extremen Bedingungen noch wählen konnte, und gab sich selbst den Tod. Er erkannte, dass in der Zeit der „Endlösung” für ihn der Selbstmord die beste Lösung war. Seine Entscheidung war richtig, er hatte schließlich keine Überlebenschance, jede Rettung war ihm versperrt. Das Einzige, was er hätte erreichen können, waren ein paar Tage Aufschub, also unter Aufbringung größter Anstrengungen eine Verschiebung des letzten Wegs auf den Umschlagplatz von, sagen wir, Montag auf Freitag. Für einen solchen Aufschub brauchte man sich nicht anzustrengen, zumal mit ihm keinerlei Hoffnung auf eine zumindest ein wenig längere Zukunft einherging. In dieser Zeit bedeutete das Ende wirklich das Ende. Diesbezüglich gab es kaum Zweifel. Die Beschleunigung des eigenen Endes war ein Akt der Freiheit, damals fast der einzig mögliche. Und mein Großvater traf im sterbenden Ghetto genau diese Wahl.
Ich denke daran mit der größten Bewunderung, zumal ich mir bewusst bin, dass ein Selbstmord, der unter solchen Umständen begangen wird, eine besondere symbolische Bedeutung besitzt. Ich hege die Überzeugung, dass diesem Freitod, einem Tod, zu dem sich dieser alte Mensch entschloss, etwas Imponierendes innewohnt. Es ist eine der Taten, die allein dadurch, dass sie aus freiem Willen entstehen und Folge einer freien Entscheidung sind, das infrage stellen, was man die Logik (oder Ordnung) des Holocaust nennen kann. Wer in einer solchen Situation zum Tode verurteilt wurde, stellt sich dadurch, dass er sich selbst das Leben nimmt, dem Urteil entgegen und demonstriert, dass er moralisch von ihm unabhängig ist. Und das ist auch dann der Fall, wenn dieser Akt die einfache Folge von Verzweiflung ist. Ich weiß nicht, ob es im Warschauer Ghetto oft Selbstmorde gab, wahrscheinlich wurden keine Statistiken geführt. Selbstmorde konnten in seiner Anfangszeit ja etwas anderes bedeuten als in seiner finalen Phase, als die Züge vom Umschlagplatz nach Treblinka aufbrachen.
Kurzum, über den Selbstmord meines Großvaters, den er in einer von der Shoah gezeichneten Zeit beging, denke ich wie über eine heroische Tat, eine Tat mit größter moralischer, existenzieller oder auch nur menschlicher Aussagekraft. Dieser Mensch hatte verstanden, dass in der Lage, in der er sich mit Millionen Verurteilten befand, die einzige verfügbare Form, über das eigene Schicksal zu entscheiden, und die einzige Form von Freiheit der sich selbst zugefügte Tod war, ein Tod aus eigenen Stücken. Würde ich die Geschichte meiner Familie schreiben oder ihre Legende erschaffen wollen, so würde ich meinem Großvater viel Platz widmen, der sich nicht ermorden ließ, weil er es vorzog, es selbst zu tun. Ich würde das tun, obwohl ich ihn wenig kannte und mich kaum an ihn erinnere. Ja, die Erinnerung von vor dem Krieg, aus der frühesten, so idyllischen Kindheit hängt überhaupt nicht mit dem finalen Akt zusammen. Die Mechanismen des Erinnerns unterliegen jedoch keiner rücksichtslosen Logik und keiner Hierarchie der Wichtigkeit. Damals, am Ende der 1930er-Jahre, konnte nicht nur ich, der ich damals nicht älter als vier war, sondern überhaupt niemand vermuten, dass dieser bescheidene Provinzkaufmann zu einer solchen Tat fähig sein würde. Und obwohl das Grauen bereits an die Tür klopfte, konnte sich auch in diesen Jahren niemand vorstellen, dass jemand Gaskammern in Betrieb nehmen würde, um darin mit industriellen Methoden zu morden.
Im Zusammenhang mit der Shoah ist oft vom „würdevollen Tod” die Rede, und gelegentlich gibt es wenig gescheite und leichtsinnige Meinungen dazu. Jeder, der durch verbrecherische Urteile starb, ist würdevoll gestorben – das muss gesagt werden, selbst wenn man Brutus recht gibt, der, unmittelbar bevor er seinem Leben ein Ende setzt, in Shakespeares Julius Cäsar sagt: „Der Feind hat uns zum Abgrund hingetrieben. / Es ziemt sich mehr, von selbst hineinzuspringen, / Als zu erwarten seinen letzten Stoß.” Es gab nur unterschiedliche Stile des Sterbens. Stile der Opfer, die sich ohne Proteste in die Gaskammern bringen ließen, und die Stile derer, die es vorzogen, aktiv zu sterben. Die einen – wie die Aufständischen des Ghettos – leisteten Widerstand, andere begingen Selbstmord. Ein Mensch, der so alt war wie mein Großvater, konnte nur den Selbstmord wählen.
Die Bohnen und die Geige

Es war gleich zu Beginn der Zeit, in der meine Eltern im Többens-Shop arbeiteten. Ich war damals schon ein so bewusster Teilnehmer und Beobachter der Ereignisse, dass ich verstand, was mit dem Wort Shop assoziiert wurde, das in dieser Bedeutung wohl weder davor und noch danach verwendet wurde. Auch der Namen Többens war mir nicht fremd, schon deshalb, weil er mir ständig zu Ohren kam. In dieser Firma unterzukommen, in der die einzige Art von Arbeit Zwangsarbeit war, bot die Hoffnung, der Deportation zu entkommen, erlaubte es, an eine Überlebenschance zumindest zu denken. Der Shop von Többens, zu dem sich meine Eltern täglich begaben und von dem sie bei verschiedenen Gelegenheiten sprachen, blieb für mich ein ferner und unbekannter Raum. Ich war nie dort, ich wusste nicht, wie er aussah und wo er sich befand, ich hätte ihn nicht unterbringen können auf der Karte des schrumpfenden und sich immer weiter entvölkernden Ghettos. Mein einziges Terrain blieb die Wohnung – eigentlich nur ein Zimmer –, in der wir uns seit längerer Zeit aufhielten, in einem Haus, das sich gleich an der Mauer befand und nach der Aktion, die auch eine räumliche Verkleinerung des Ghettos verursacht hatte, in ihm verblieben war. In den Winkeln dieser Wohnung sollte ich mich so gut wie möglich verstecken, wenn Gefahr drohte. Oft hielt ich mich hier übrigens allein auf, obwohl die Eltern eigentlich versuchten, zu unterschiedlichen Schichten in den Shop zu gehen.
Einst war die Wohnung belebt gewesen, viele Personen hatten hier Unterschlupf gefunden. Das begann sich in der Zeit zu ändern, von der ich jetzt erzähle, die erste Phase der Deportationen näherte sich ihrem Ende oder war bereits beendet. Ich könnte von wirklich großen Bevölkerungsbewegungen in der Wohnung sprechen. Verschiedene Personen kehrten nicht zurück, weil sie vom Umschlagplatz ihren letzten Weg antraten, der direkt zum Gas führte, einigen gelang es, auf die arische Seite zu wechseln. Nur an wenige von ihnen erinnere ich mich. In meinem Bewusstsein ist Frau Franka geblieben, die kurz zuvor ihr einziges Kind verloren hatte, einen Jungen in meinem Alter oder jünger. Sie war eine Bekannte meiner Familie aus der Vorkriegszeit. Sie überlebte, behielt nach dem Krieg Vor- und Nachnamen aus der Besatzungszeit und war bis zum Ende ihres langen Lebens als Frau Natalia bekannt. Irgendwo am Rand meiner Erinnerung taucht eine anonyme Frau auf, die sich nicht lang in der Wohnung aufhielt. Festgesetzt hat sie sich nur durch eine Erzählung, ja vielleicht nur durch einen Satz. Sie berichtete von der Selektion, bei deren Durchführung den Deutschen ein gewisser Jude half, ihr Bekannter von vor dem Krieg. Mit tiefer Überzeugung seufzte sie: „Was für ein ordentlicher Mensch!”, da er bewirkt hatte, dass man sie diesmal in Ruhe ließ. Als der Deutsche auf sie zeigte, habe er ihm nahegelegt, eine andere zu nehmen.
Mich beschäftigen die Mechanismen der Erinnerung, die dazu führen, dass sich gerade diese Äußerung in ihr erhalten hat und gewissermaßen für immer konserviert wurde, während sich so viele andere Sätze und Ereignisse verflüchtigt haben und auf keine Weise mehr rekonstruiert werden können. Ich kann es nicht erklären, schließlich war mir nicht bewusst, wie schrecklich das war, was diese Frau erzählte. Die moralische Reflexion eines knapp achtjährigen Kindes kann die Aussage von derlei Erklärungen nicht begreifen und bewerten. Das Kind kann nicht darüber nachdenken, wie die Wirklichkeit, in der es lebt, die Entstehung von Kriterien bei der Beurteilung von Einstellungen und menschlichen Verhaltensweisen beeinflusst, wie sie dazu zwingt, in Kategorien zu denken, die sich, wenn die Dinge günstiger gelaufen wären, sicherlich nicht ausgeprägt hätten. Es bleibt jedoch eine Tatsache, dass ich mir gerade diesen Sachverhalt behalten habe, obwohl er mich gar nicht interessiert haben dürfte. Umso mehr, als ich diesen jüdischen Kollaborateur nie gesehen hatte und seinen Namen nicht kannte, auch nicht wusste, wer diese „eine andere” war.
Ich erzähle hier nicht die Geschichte dieser Frau, über deren Schicksal mir nichts bekannt ist, ich weiß nicht, ob es ihr gelang, sich vor Treblinka zu retten. Ich will vielmehr von drei Schwestern erzählen, die – freilich nur kurz – ein Zimmer in der Wohnung belegten, in der auch wir wohnten. Ich erinnere mich an ihren Nachnamen: Urstein. Ihr Bruder, der gleich zu Beginn der Besatzungszeit gestorben war, war ein bekannter Musiker. Er hat einen Eintrag in der Mała Encyklopedia Muzyki, im Kleinen Musiklexikon: „Urstein, Ludwik, geb. 1874 in Warschau, gest. am 5.10.1939 ebd., polnischer Pianist und Pädagoge. Er studierte am Warschauer Konservatorium. Bedeutender Begleiter und Kammermusiker.”
Dieser unter anderem aufgrund zahlreicher Auftritte im polnischen Rundfunk geschätzte Künstler hatte Glück: Er starb zum richtigen Zeitpunkt, er umging das Ghetto und die mit ihm verbundenen Qualen. Doch seine Schwestern erlitten sie. Ich erinnere mich daran, wie sie aussahen: Sie waren schwarz gekleidet. Einander sehr ähnlich, kamen sie mir alt vor, obwohl sie sicherlich kaum die mittleren Lebensjahre überschritten hatten. Ich wechselte kein Wort mit ihnen. Sie hielten sich abseits und knüpften keinen Kontakt zu den Mitbewohnern, ich verbinde mit ihnen Stille und Schweigen. Sie sprachen wohl nur untereinander, und das flüsternd. Vielleicht wollten sie auf diese Weise ihre Privatsphäre bewahren. Vielleicht wurden sie aber auch von Unglück und Leiden erdrückt, sodass sie es vorzogen, diese in familiärer Isolation zu erdulden und nicht in der Lage waren, Kontakte aufrechtzuerhalten, auch nicht mit denen, die so wie sie zu Erniedrigung und Qualen verurteilt waren, zum Verlust ihrer Liebsten und zu unaufhörlichem Warten auf den Tod.
Nichts Konkretes kann ich über diese Frauen sagen – ich weiß nicht, ob sie verheiratet oder Witwen waren, ich weiß nicht, ob sie jemals eigene Familien besaßen und sie im Zuge der Liquidierung des Ghettos verloren hatten, ich weiß nicht, ob sie einander schon immer so nahe standen oder ob erst der Aufenthalt hinter der Mauer diese Vertrautheit hatte entstehen lassen. Auf jeden Fall haben sie sich meinem Gedächtnis als Personen eingeprägt, die stets zusammen waren, als drei schwarze Gestalten, die gemeinsam die Wohnung verließen, um zur Arbeit in Többens Shop zu gehen, und gemeinsam zurückkehrten. Und eines Tages kehrten sie solidarisch – also wieder gemeinsam – nicht zurück. Es war schwer, nicht zu erahnen, was geschehen war: Sie waren zur Deportation ausgewählt worden, es fand sich kein „ordentlicher Mensch”, der sie davor beschützt hätte. Ich weiß natürlich nicht, wie das vorging. Vielleicht suchten diejenigen, die die Selektion durchführten, an diesem Tag alle drei heraus und verurteilten sie zum Tod im Gas. Vielleicht riefen sie auch nur eine heraus und die beiden anderen meldeten sich von selbst, weil sie beschlossen hatten, nicht nur gemeinsam zu leben, sondern auch im Familienkreis zu sterben. In solchen Fällen spricht man in der Regel davon, dass das Geheimnis mit ins Grab genommen wird, hier jedoch wäre diese Formel widersinnig, da die ermordeten Juden ihre Geheimnisse mit ins Gas nahmen.
Ihre Geheimnisse nahmen auch die Schwestern Urstein mit, an die sich heute kaum jemand mehr erinnert, vielleicht auch niemand – außer mir. Doch ich rufe sie mir auf besondere Weise ins Bewusstsein, so wie man Gestalten und Ereignisse aus der Kindheit evoziert, auch aus der makabersten. Das ist ein karges Erinnern, nur wenig lässt sich daraus hervorluchsen: sie lebten … und sie kamen um …
Sie ließen ein abgeschlossenes Zimmer zurück, und damit hängt zusammen, was ich jetzt erzählen will. Sie hatten keine Familie mehr, die all das, was sie hinterlassen hatten, übernehmen und ordnen konnten. Das Zimmer, das sie vor nicht allzu langer Zeit bezogen hatten, war zu Niemandsland geworden, und die Dinge, die ihnen noch gestern gehört hatten, konnte sich jeder, der wollte, aneignen. Im Ghetto hörten in der Zeit der Liquidierung die meisten Gesetze zu gelten auf, das Eigentumsrecht hatte seinen Sinn verloren, wo doch das Eigentum noch vor Kurzem vielen Menschen als heilig gegolten hatte. Wertvolles konnte ebenso wie Wertloses herrenlos werden, herrenlos wurden auch die persönlichen Erinnerungsstücke, die noch am Vortag für jemanden sehr kostbar gewesen waren.
Dessen war sich zweifellos ein junger Mann bewusst, den niemand unter denen, die immer noch in der Wohnung ausharrten, kannte. Er erschien einige Tage nach dem Verschwinden der Schwestern Urstein, erklärte, er wisse, dass sie eine wertvolle Geige hinterlassen hätten, und sagte, dass er sie mitnehmen wolle. Anfangs fragte man ihn aus, welches Recht er darauf habe. Mit Sicherheit waren das keine allzu weitreichenden Ermittlungen, denn dieser Unbekannte legte keine Beweise vor, die seine Ansprüche hätten begründen können. Doch man sprach mit ihm; das Instrument konnte nun ihm ebenso gehören wie jedem anderen. Das Zimmer der Schwestern Urstein war verschlossen, den Schlüssel hatten sie mit auf ihre letzte Reise genommen. Man musste es also auf andere Weise öffnen. Die Tür wurde nicht aufgebrochen, sie ließ sich leicht öffnen, fast ohne Mühe. Und tatsächlich, die Geige befand sich an einem exponierten Platz. Der Herr, der gekommen war, um sie zu holen, sagte, sie sei alt und wertvoll, er nannte sie die Violine von Ludwik Urstein. Aber hat Ludwik Urstein tatsächlich auf ihr gespielt? Er war schließlich Pianist, der zwar Geiger begleitete, aber kein Virtuose auf diesem Instrument. Vielleicht gehörte sie einer der Schwestern und sie hatte darauf gespielt? Ich weiß natürlich nicht, wie sich die Dinge verhielten, ich weiß nicht, wer der Mann war, der sie mitnahm, ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Vielleicht konnte sie das Ghetto verlassen, denn in dieser Zeit konnte sie hier schließlich niemand mehr gebrauchen, in der Zeit der Deportationen, als der Umschlagplatz zum zentralen Ort innerhalb der Mauern wurde, spielte niemand mehr irgendetwas. Vielleicht gelangte sie so heraus wie die Menschen, die vor der Vernichtung auf die arische Seite flohen. Vielleicht ist sie erhalten geblieben und dient – wenn sie wirklich gut war – heute einem Künstler, der Bach und Beethoven darauf spielt, ohne sich bewusst zu sein, welch dramatische Geschichte sie hat. Aber vielleicht ist sie auch zerstört worden, ist im schrecklichsten Sinn des damals fundamentalen Wortes „untergehen” untergegangen, zusammen mit dem jungen Mann, der meinte, sie müsste nach dem Verlust der Schwestern ihm gehören. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er Geiger war und an seinen letzten Lebenstagen auf einem ordentlichen Instrument spielen wollte.
Ich könnte noch lange Mutmaßungen anstellen, doch ich möchte lieber über das berichten, woran ich mich erinnern kann. In diesen Erzählungen über das Ghetto beschäftigen mich nicht die möglichen Welten, sondern mich interessiert, was in seinem Wesen noch kurz zuvor unmöglich gewesen zu sein schien – und zwar aus vielen Gründen –, nun aber Wirklichkeit war, die schrecklichste Realität aller Wirklichkeiten war, die noch vor zwei oder drei Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen waren. Wirklichkeit war zweifellos das Zimmer, das die Schwestern Urstein hinterlassen hatten. Es war nun ohne Besitzer, offen, für jeden zugänglich, der es betreten wollte. Vater ging hinein, und ich mit ihm. Ich kann nicht sagen, wann das geschah, gleich nach dem Abschied des Mannes mit der Geige oder etwas später. Für mich, der auf Dauer in der Wohnung eingesperrt war, der die Welt schon lange nicht mehr betrachtet hatte und keine anderen Freuden kannte, war das gewiss eine Abwechslung und Attraktion: etwas zu sehen, was ich bis dahin nicht gesehen hatte, zumindest nicht im jetzigen Zustand. Denn ehe die drei Schwestern es bezogen hatten, hatte ich mich oft in diesem Zimmer aufgehalten.
Sie hatten hier nur wenige Tage gewohnt, hatten sich noch nicht einleben und einrichten können, alles lag herum und war in Unordnung. Vielleicht wollten sie aber auch gar keine Ordnung herbeiführen, in dem Bewusstsein, dass dies ein Provisorium kurz vor dem Tod war, dass jedes Bemühen um Ordnung und jedes Wurzelschlagen, sofern es überhaupt möglich gewesen wäre, ein Betrug an ihnen selbst war – in der Zeit vor dem Tod. Der Unordnung kam entgegen, dass es in dem Zimmer fast keine Möbel gab. Mit Sicherheit fehlte in ihm ein Schrank, und so lagen verschiedene, die elementarsten, für die bescheidenste Existenz notwendigen Gegenstände offen herum: ein paar Teller, vielleicht auch Küchengeschirr, vor allem aber Teile der Garderobe. Das war alles, was von den Schwestern geblieben war. Diese Unordnung wurde zu einem Zeichen eines plötzlich und gewaltsam unterbrochenen Lebens, eines Lebens, dem sich keine Chance mehr bot.
Vielleicht waren auch einige Essensreste geblieben und ganz sicher etwas, was einen Schatz darstellte: eine Tasche mit einigen Kilo Bohnen. Diesen Vorrat hatten die Schwestern sicherlich für eine schwarze Stunde angelegt, für eine Zeit schlimmen Hungers. Ich erinnere mich, dass Bohnen im Ghetto ein besonders geschätztes Nahrungsmittel waren. Dieser Schatz war nun, so wie die Geige, herrenlos, ein Gut ohne Besitzer. Vater nahm ihn und wir aßen diese Bohnen eine Zeit lang und teilten sie sparsam in Portionen auf, damit sie länger reichten.
Aber bald wurden auch unsere Habseligkeiten herrenlos. Wie verließen das Zimmer und ließen alles zurück. Ich weiß nicht, ob es noch jemand geschafft hat, von diesen Dingen Gebrauch zu machen, zu essen gab es darunter eher nichts. Wir verließen das Zimmer, zum Glück nicht zum Umschlagplatz und in die Öfen der Krematorien getrieben – wir gelangten auf die arische Seite.