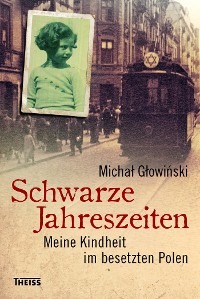Kitabı oku: «Schwarze Jahreszeiten», sayfa 4
Das Verlassen

Ich gebrauche dieses Wort nur deshalb, weil ich kein anderes bei der Hand habe, eines, das passender wäre. „Flucht” ist für mein Gefühl noch weniger angemessen. Freilich, es hat großartige Konnotationen, es lässt an die biblische Welt denken, doch würde ich den Ausdruck „Exodus” nicht verwenden, weil er in Bezug auf derlei Ereignisse sowohl viel zu erhaben als auch zu prätentiös klänge. Und wenn von einer furchtbaren Welt die Rede ist, von einer der furchtbarsten, welche jemals Menschen bereitet wurde, sind alle erhabenen und feierlichen Worte überflüssig. Ein Missklang stiehlt sich in sie hinein. In den Geschichten, aus denen sich die Shoah zusammenfügt, gibt es noch nicht einmal Analogien zu den grausamsten Episoden der Bibel. Auch in den Fragmenten, in denen nicht vermieden wurde, von erschütternden, ungeheuerlichen Ereignissen zu erzählen, hat die Heilige Schrift stets gewisse Werte festgelegt, hat angenommen, dass es in der Welt eine gewisse Ordnung gibt, die ihren Sinn hat. In der Shoah gab es so etwas nicht. Hier war ein System des Verbrechens am Werk, und in dem, was zur Rettung menschlichen Lebens führte, spielten Zufälle eine gewaltige Rolle – dunkle und unermessliche, die sich nicht beherrschen, verstehen, ordnen lassen.
Ich habe diese allgemeinen Erörterungen gerade hier aufgegriffen, weil das Wort „Verlassen” mich darauf gebracht hat, obwohl sie auch in die anderen Erzählungen passen würden. Ich weiß nicht, aus welchem Grund es eine Konvention geworden ist, vom „Verlassen des Ghettos” (wyjście z getta) zu sprechen, wenngleich man auf Polnisch nicht sagen kann: „das Verlassen des Konzentrationslagers” – und zwar sowohl dann, wenn es um eine dramatische, höchst risikoreiche Flucht ging, als auch dann, wenn man an eine Freilassung denkt (die natürlich im Fall der Juden ganz unvorstellbar war). Also unser Verlassen – das meiner Eltern und meines – des Ghettos erfolgte gleich Anfang Januar 1943, wohl einen Tag nach Neujahr. Wir verließen es als letzte von dem Teil der Familie, der innerhalb der Mauern lebte und ein geschlossenes Ganzes bildete. Ich denke nicht an die Großeltern, die aufgrund eines reinen Zufalls noch vor Beginn der Deportationen auf die arische Seite gelangt waren, ein außergewöhnlicher Zufall, der für sie unerwartet gnädig war. Ich denke an meine beiden Tanten, die eine nach der anderen mit ihren Kindern herauskamen. Und dann an ihre Männer: Beide gelangten etwas später über die Mauer und kamen kurz darauf ums Leben.
Diejenigen Verwandten sowohl meiner Mutter als auch meines Vaters, die an anderen Stellen des Ghettos wohnten, kamen nicht heraus – und nicht mit dem Leben davon. Sie machten sich von dort aus auf ihre letzte Reise, direkt nach Treblinka. Es ist unbekannt, an welchen Tagen das geschah und unter welchen Umständen genau. Als man versuchte, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, was zweifellos nicht leicht war, musste man feststellen, dass sie nicht mehr da waren. Sie waren, existierten, lebten – und dann waren sie auf einmal nicht mehr da. Niemand konnte sich Täuschungen hingeben, es war bekannt, was geschah. Doch ich vermag nicht zu sagen, ob man auf Nachrichten dieser Art reagierte wie auf Trauerbotschaften. Ist denn in einer systematisch und geplant ermordeten Gemeinschaft Trauer in der Form, wie sie sich in etwas normaleren Zeiten zeigt, überhaupt möglich? Wenn ein Tod auf den anderen folgt, wenn er allem und jedem einzeln droht, ist es schwer, zu kontemplieren. Wenn das Nachdenken über ihn überhaupt möglich ist, so lediglich in den Dimensionen eines Augenblicks, nicht in längeren Zeiteinheiten.
Wir waren also von dem Teil der Familie, der der Vernichtung entkommen konnte, am längsten im Ghetto. Ich weiß nicht, was dafür den Ausschlag gab: Vielleicht waren die Umstände ungünstig, vielleicht war es schwer, zu einer Entscheidung zu gelangen, zumal die Entscheidung keine Kleinigkeit war. Das Risiko, die gut bewachte Grenze zu überschreiten, die mitten durch die Stadt führte, musste bedacht werden. Und es war kein Geheimnis, dass man gleich nach der Ankunft auf der anderen Seite leicht in die Hände von szmalcownicy fallen konnte, was bedeutete, erpresst zu werden, gelegentlich aber auch gleichbedeutend mit dem Tod war.
Das Verlassen organisierte Vater – und er machte es gut. Die Operation verlief rasch und reibungslos. Wir zwängten uns, im Gegensatz zu einer Tante, nicht durch die Kanäle (hätte ich eine Flucht durch unterirdische Wege erlebt, so würde ich ihr wohl die Platzangst zuschreiben, die mich in unterschiedlicher Intensität seit der frühen Jugend plagt). Ich weiß nicht, wie Vater es geschafft hat, und ich werde es auch nie mehr erfahren, denn ich habe nicht daran gedacht, ihn nach den Einzelheiten zu fragen, wobei ich auch gar nicht sicher bin, ob er sie behalten hatte. Wie viele von denen, denen das Verlassen gelungen war und die den Krieg überlebt hatten, mied er die Erinnerungen, er unterdrückte sie wohl. Vielleicht war das eine der Bedingungen für die Rückkehr zu einer normalen, banalen Alltäglichkeit, in der sich selbst ernste Schwierigkeiten bewältigen lassen. Doch die Verwirklichung dieser Absicht, bei der es um das Leben ging, die Verwirklichung dieses Auszugs aus einem Teil der Stadt in den anderen, der den hinter den Mauern eingesperrten Menschen als Domäne der Freiheiten und der Normalität vorkam, obschon auch er sich unter der Besatzung befand und schreckliche Dinge in ihm geschahen – diese Verwirklichung war keine leichte Aufgabe. Es ging darum, die Grenze zu überqueren, die von einer Mauer markiert wurde, aber auch darum, etwas auf der arischen Seite vorzubereiten, um nicht im Leeren zu landen, nicht sofort in unerwünschte Hände zu geraten und in eine ausweglose Situation zu kommen, selbst wenn sie eine Folge des Auswegs war.
Wir zogen gemeinsam aus, alle drei, auf riskante Weise. Aber damals gab es nichts, was nicht riskant gewesen wäre. Der Einsatz beim Retten des Lebens war das Leben selbst. Auf riskante, zugleich aber auf – ich muss dieses hier so unangemessene Wort verwenden – luxuriöse Weise: Wir fuhren durch das Tor, welches das Ghetto von der arischen Seite trennte, in einem von einem deutschen Soldaten gelenkten Automobil. Als wir hinausfuhren, war es noch dunkel, es ging alles schnell, den Soldaten habe ich wohl überhaupt nicht gesehen. Ich habe mir das Auto auch nicht angeschaut, ich erinnere mich nicht daran und weiß nur, dass es kein Lastwagen war, aber es war auch kein Personenwagen im engeren Sinne. Mit einer Plane bedeckt war es vielleicht ein Militärwagen, wie sie damals zur deutschen Ausrüstung gehörten. Wir sollten hinten sitzen, gebückt und so gekleidet, dass wir am wenigsten auffielen.
Aber unserem Hinausgehen war ein Ereignis vorausgegangen. Es ist mir nicht klar, wie Vater das Verlassen des Ghettos eingefädelt hatte, ich erinnere mich aber, dass er die Sache mit einem nicht mehr jungen Menschen Namens Kryształ erledigte. In der Endphase des Ghettos übte er irgendeine Funktion aus, er war wohl ein Beamter, der Kontakt zu den Deutschen hatte. Ich weiß nichts über ihn, ich vermag nicht zu sagen, ob er für die aussterbende Gemeinschaft tätig war oder ob es sich um einen Kollaborateur handelte, der die Zusammenarbeit vielleicht in der Hoffnung aufgenommen hatte, dadurch sein Leben und das seiner Familie zu retten. Wie auch immer es sich verhielt, er war es, der bei unserem Hinausgehen vermittelte, er erledigte es. Er kannte einen deutschen Soldaten (es gab so einen, vielleicht sogar mehrere), der bereit war, unter bestimmten Bedingungen und gegen Bezahlung Juden aus dem Ghetto herauszufahren. Er verlangte, dass sie kein semitisches Aussehen haben dürften. Wenn ich mich nicht irre, beauftragte er Kryształ mit der Beurteilung. Offensichtlich hatte er Vertrauen in dessen diesbezügliche Fertigkeiten: Er vertraute Kryształs Kriterien und glaubte sicherlich, dass ein jüdisches Auge ein schlechtes Aussehen besser erkenne als sein germanischer Blick. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass er sich aus Sicherheitsgründen nicht mit denen treffen wollte, denen er einen so wichtigen Dienst erweisen sollte.
Mit dieser Rolle Kryształs als Begutachter hängt zusammen, was zum ersten Mal seit Monaten geschah: Ich ging aus der Wohnung, die ich seit Langem nicht verlassen hatte. Vater hatte er schon kennengelernt, Mutter hatte er sich im Shop von Többens angeschaut, nun musste er mich noch ansehen, um festzustellen, wie ich aussehe, ob ich nicht das Stereotyp vom Juden verkörpere. Es war schon dunkel, als wir uns trafen und ich erinnere mich nicht an den Ort, an dem es geschah. Kryształ selbst hat sich in meiner Erinnerung jedoch gehalten: Er war von kleinem Wuchs, ganz grauhaarig, mit kurz gestutztem Bart. Vater besprach lange etwas mit ihm und ich lauschte diesem Gespräch mit Anspannung, weil ich wusste, welch große Sache auf dem Spiel stand. Sicher legten sie die Einzelheiten fest, also Tag und Ort, an dem wir uns gleich nach Ende der Polizeistunde einfinden sollten, aber sie einigten sich auch über die Höhe der Bezahlung. Sie waren eindeutig zu einem Kompromiss gelangt. Kryształ hatte den Preis wohl noch etwas gesenkt, und vielleicht servierte ihm Vater zum Lohn dafür ein Kompliment: „Sie sind ein wahrer Kristall.” Ich schließe nicht aus, dass dieser Satz fiel, nachdem er festgestellt hatte, dass mein Aussehen unsemitisch genug war, um eine positive Meinung über mich abgeben zu können, so also, dass der geheimnisvolle und anonyme Soldat einverstanden wäre, uns fortzubringen. Hätte es dieses Wortspiel nicht gegeben, das sich meinem Gedächtnis eingeprägt hat, so hätte ich vergessen, wie dieser Mensch hieß. Selbst wenn er ein Kollaborateur war, so hat er mit Sicherheit keine größere Rolle gespielt, seinen Namen habe ich in keiner Arbeit über die Geschichte des Warschauer Ghettos je gelesen.
Als sie das Datum festlegten, wurde auch berücksichtigt, welche Mannschaft an diesem Tag am Ghettotor Wache haben würde. Es ging darum, dass sie aus solchen Wachmännern bestand, die – selbst wenn sie nicht geneigt waren, das Hinausgehen zu erlauben – so gleichgültig und wenig neugierig waren, dass sie sich nicht allzu sehr dafür interessierten, wer sich in dem Wagen befand. Wir saßen auf der Rückbank, so zusammengekauert, dass so wenig wie möglich von uns zu sehen war, Mutter mit einem Tuch auf dem Kopf und ich in einer dicken Wollmütze, „Pilotenmütze” genannt, die einen großen Teil des Gesichts verdeckte. Sie war mir noch vor dem Krieg in der ulica Nalewki gekauft worden, in einem Geschäft für Kindermode, das wohl „U Franciszki” (Bei Franciszka) geheißen hat. Diese Pilotenmütze wuchs gewissermaßen zusammen mit mir und leistete mir einige Kriegsjahre hindurch gute Dienste.
Am dramatischsten war die Fahrt durch das Tor. Der Soldat, der eine so explosive Ladung wie eine aus dem Ghetto fliehende dreiköpfige Familie transportierte, musste natürlich anhalten und dem Wachmann seine Dokumente zeigen. Das dauerte nicht lange, die Kontrolle war routinemäßig, und wir fuhren rasch weiter. Am vereinbarten Ort stiegen wir aus, irgendwo in der Innenstadt, wohl nicht allzu weit von der Mauer entfernt. Es war immer noch dunkel. Ich weiß nicht, wie Vater es organisiert hatte, wie es ihm gelungen war, mit jemandem auf der anderen Seite Kontakt aufzunehmen, doch an der vereinbarten Stelle wartete auf uns der Lange zusammen mit einem unbekannten Mann, der – was etwas Besonderes darstellte – ein „blauer Polizist” war. So also gelangten wir auf die arische Seite. Eine neue Etappe meiner Geschichte begann.
Der Lange

Ich erinnere mich an ihn aus den ältesten Zeiten, aus der frühesten Kindheit, aus diesem kleinen Fetzen von ihr, der in jene mythische Zeit fiel, die mit den Worten „vor dem Krieg” bezeichnet wurde. Er verkehrte im Haus meiner Eltern und sah so eigentümlich aus, dass er sich meinem Gedächtnis sofort einprägte und meine Fantasie anregte. Er war sehr groß (es fehlte ihm wohl nicht viel bis zu zwei Metern) und er sprach auf eine ungewöhnliche und charakteristische Weise, doch das begriff ich erst später, denn damals beschäftigten mich derlei Dinge aus naheliegenden Gründen nicht. Es konnte jedoch nicht meiner Aufmerksamkeit entgangen sein, dass er Mühe hatte zu gehen. Er ging schleppend, vom Stuhl stand er mit deutlicher Anstrengung auf und er bewegte sich nicht ohne Stock. Es hieß, er sei schwer krank. Die Schwierigkeiten beim Gehen bildeten einen erstaunlichen Kontrast zu seiner Größe, seine langen Beine konnten noch nicht einmal kleine Distanzen überwinden und waren so wenig brauchbar. Er gehörte zu den Erwachsenen, die die Gegenwart von Kindern nicht ignorieren. Ganz offensichtlich schenkte er mir Aufmerksamkeit, und wenn er zu dem Schluss gelangte, dass ich mich nicht verhielt, wie es sich gehörte, sprach er in einem belehrenden und irgendwie drohenden Ton mit mir, aber doch so, dass er eigentlich keine Angst bei mir hervorrief. Es war ganz einfach der Rat einer klugen und erfahrenen Person. Er warnte mich: „Pass nur auf, wenn du böse bist, dann kommt Łojewski.” Ich wusste nicht, wer dieser geheimnisvolle Łojewski war und was er mir antun würde. Allein die Ankündigung, dass er kommen würde, sollte mich zur Ordnung rufen. Er war eine mythische Gestalt meiner ersten Kindheit, ich erinnerte mich gut und lange an ihn, sodass ich, als ich ein halbes Jahrhundert später vor der Notwendigkeit stand, mir ein Pseudonym auszusuchen, um damit Artikel für die Untergrundpresse zu unterzeichnen, eben den Namen Łojewski wählte. Zweifellos konnte der Gast meiner Eltern nicht vorhersehen, dass er, als er für mich eine fiktive Person erschuf, einen Mythos zum Leben erweckte, auf den ich mich viele Jahre später unter ganz anderen Umständen beziehen sollte, die er nicht kannte, da er bereits seit Jahrzehnten nicht mehr lebte.
Man nannte ihn den Langen, als habe man vergessen, dass er mit Vornamen Józef hieß. So sprach man stets von ihm, weshalb man ihn auch immer so anredete, wohl nicht nur, um ihn unter einigen anderen Józefs hervorzuheben, die es damals im Familienkreis gab. Er war ein enger Cousin meiner Mutter, mehr als zehn Jahre älter als sie. In den alten, meist zahlreichen Familien gab es viele Vettern, ich konnte aber keinen von ihnen kennenlernen oder mich zumindest an ihn erinnern – außer an diesen einen. Er war eine interessante, charakteristische Person mit einer ungewöhnlichen Biographie. Der älteste Sohn der ältesten Schwester meines Großvaters, die den Namen Mechła trug, war wohl um das Jahr 1890 geboren worden und wurde später amerikanischer Staatsbürger. Damit verbindet sich eine ganz merkwürdige und besondere Geschichte.
Die Familie meines Großvaters stammte aus dem nördlichen Masowien, aus der Gegend von Płock, aus einem Ort namens Bielsk, einem unvorstellbar gottverlassenen Nest. Um die Jahrhundertwende zogen die Angehörigen der jüngsten Generation nacheinander fort, um sich in der Gegend von Warschau, in Lodz oder sonstwo niederzulassen. Die Einzelheiten kenne ich nicht, da die Ereignisse von vor einem Jahrhundert im Vergessen versinken und es unter den Lebenden niemanden mehr gibt, der mir glaubwürdige Informationen übermitteln könnte. Auf jeden Fall zog Mechła eine Weile nach ihrer Heirat und schon als Mutter eines ersten Sohnes nach Pruszków, wohin bald auch zwei ihrer Brüder nachkamen, darunter mein Großvater. Ich weiß nicht, wie sich ihr Eheleben gestaltete. Aus der Familienüberlieferung ist mir jedoch zu Ohren gekommen, dass ihr Mann so wie viele junge Juden in jenen Zeiten nach Amerika auswandern wollte. Sie aber habe sich diesem Plan entschlossen widersetzt, vielleicht weil sie befürchtete, sie würden in der neuen, unbekannten Welt nicht zurechtkommen, vielleicht aber auch deshalb, weil sie sich ein Leben außerhalb eines polnischen Städtchens nicht vorstellen konnte (selbst einem wie Pruszków, in dem nicht viele Juden lebten). Schließlich war dieser Raum für sie heimisch, vertraut und gut bekannt. Ihr Mann setzte sich jedoch durch, und zwar auf äußerst eigentümliche Weise: Eines Tages fuhr er nach Warschau und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Tage vergingen, Wochen und Monate, und er gab kein Lebenszeichen von sich. Die arme Mechła wusste nicht, ob sie sich für eine Witwe halten sollte oder für eine – ebenso unglückliche – sitzen gelassene Mutter dreier Kinder, die ihrem eigenen Schicksal überlassen wurde. Wie dem auch sei, es war ein Skandal in der vorbildlichen kleinbürgerlichen Familie. Erst nach einigen Monaten stellte sich heraus, dass sie weder Witwe noch sitzen gelassen war, sondern die Frau eines Mannes, der Einfälle und Fantasie hatte, der auf allen Wegen nach der Verwirklichung seiner Vorhaben strebte – und zudem unverantwortlich war. Sie erhielt einen Brief aus New York, in dem er mitteilte, dass er gerade nach Amerika ausgewandert sei und Arbeit gefunden habe, und – wenn er erst ein wenig Geld verdient habe – für sie und die Kinder Fahrkarten schicken werde. Er hielt Wort, nach einer Zeit machte sich Mechła mit zwei Söhnen und einer Tochter auf den Weg über den Ozean. Sie ließen sich in Brooklyn nieder. Sie starb betagt, einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und so rettete sie der geheime, geradezu irrsinnige Plan ihres Mannes vor der Shoah. Der Lange wurde, ebenso wie seine Eltern und Geschwister, zu einem amerikanischen Staatsbürger, was einige Jahrzehnte später wichtig werden sollte, als er sich in einer Gegend aufhielt, in der sich die Geschichte grausam austobte.
Über seinen Aufenthalt in Amerika weiß ich nicht viel. Als er erwachsen war, arbeitete er als Vertreter für die berühmte, damals auch in Polen bekannte Firma Singer, die Nähmaschinen herstellte. Ich vermute, er hat sie auf Jiddisch oder auch auf Polnisch angepriesen, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass er das auf Englisch getan hat. Polnisch sprach er auf wunderliche Weise, er „jiddelte”, man hörte aber auch Einflüsse des Englischen. Doch ebenso wie Jiddisch sprach er Polnisch von klein auf, während er in das Englische erst als heranwachsender Junge eintauchte, und so könnte ich wetten, dass er es nur schlecht sprach und keine Fertigkeiten besaß, die es ihm erlaubt hätten, die Singer-Produkte auch vor weißen angelsächsischen Protestanten erfolgreich anzupreisen. Zweifelsohne war er in Brooklyn tätig.
Er heiratete, wie es scheint, in jungen Jahren und hatte einen Sohn. Die Ehe hielt nicht lange, sie war von Anfang an verhängnisvoll, da er, wie er immer wieder betonte, an ein schreckliches Weib geraten war, das er heksa, Hexe, nannte. Sie hätte aber wohl auch deshalb nicht lange halten können, weil für den Langen jede Frau, sofern sie nicht allzu betagt war und halbwegs nach etwas aussah, eine Verlockung war. Auf diesem Gebiet besaß er gewaltige Bedürfnisse und Ambitionen. Die Hölle brach los, am Ende gab es einen Prozess. Das Gericht erklärte die Ehe für geschieden, stellte fest, er sei für deren Zerfall verantwortlich, und legte eine gewaltige Alimente fest, die – wie er meinte – im Verhältnis zu seinen Einkünften unverhältnismäßig hoch war. Er hätte ausschließlich für diese Unterhaltszahlungen arbeiten müssen, doch darauf hatte er keine Lust. Um sich davon zu befreien, tat er das, was sein Vater mehr als ein Jahrzehnt zuvor getan hatte: Ohne seine ehemalige Frau über seine Entscheidung zu informieren und ohne sich von seinem Sohn zu verabschieden, machte er sich auf die Reise. Nur in die entgegengesetzte Richtung, nach Polen. Nicht nur mit der heksa, sondern auch mit seinem Sohn unterhielt er keinerlei Kontakte. Es mochte den Anschein haben, dass ihn das alles nicht berühre, als sei der Hass zu seiner geschiedenen Frau auch auf den Sohn übergegangen. Bar aller väterlichen Instinkte interessierte er sich viele Jahre nicht für ihn und wusste nicht, was aus ihm geworden war. Er korrespondierte lediglich mit seinen Eltern und den Geschwistern, denen es in Amerika durchaus gut ging; der jüngere Bruder, Tobiasz, hatte es schon recht bald zu etwas gebracht.
Ich kann diese Ereignisse zeitlich nicht präzise einordnen, nur eines weiß ich sicher: Der Lange kehrte bereits in den 1920er-Jahren nach Polen zurück. Als er das Land nach dem Krieg verließ, ließ er ein Fotoalbum bei meinen Eltern zurück, das sich heute bei mir befindet. Darin habe ich ein Bild von Mutter mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Maria gefunden, sie sind in Begleitung des Langen in Zakopane. Dieses Foto hat für mich einen besonderen Wert, weil es eine der wenigen erhaltenen Fotografien meiner Mutter vor ihrer Ehe ist, es ist sicher um das Jahr 1930 herum entstanden.
Nach seiner Rückkehr suchte der Lange die Nähe meiner Großeltern. Ihr Haus in Pruszków hielt er für seinen familiären Hafen, er war oft bei ihnen und wohnte hier angeblich auch für einige Zeit – stets gehörte er zu den gern gesehenen Menschen. Man mochte ihn wegen seiner Direktheit, seiner Fantasie, seines Witzes. Man mochte ihn, obschon sein Lebensstil zweifellos mit der strengen Atmosphäre des Hauses und den hier geltenden überaus steifen Grundsätzen kontrastierte. Er, ein geschiedener Mann mit einem ungeregelten Privatleben, der sich ständig in neue Romanzen stürzte, von denen er selbst erzählte oder über die es Gerüchte gab, ein Mensch mit einer in jeder Hinsicht instabilen Position, war ein seltsames Geschöpf vor dem Hintergrund einer bis zum letzten Zentimeter geordneten und unglaublich soliden Welt. Ich glaube, es spricht für meine Großeltern, dass sie ihn nicht nur tolerierten, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt auch als Teil der engsten Familie ansahen. Und diese Bande wurden nur noch enger, als sich herausstellte, dass der Lange schwer krank war, dass ihn eine schreckliche und zerstörerische Krankheit befallen hatte, die langwieriges Leiden und den Verlust weiterer Fähigkeiten bedeutete. Doch das ist eine andere Geschichte.
Nach seiner Rückkehr nach Polen musste er alles von Neuem beginnen und er war vor grundlegende Entscheidungen gestellt: Was tun, wo wohnen, wie überhaupt im Leben zurechtkommen? Für eine Zeit lang fand er Unterkunft in Pruszków, doch ich weiß nicht, welcher Beschäftigung er hier nachging. Dann entschloss er sich zu etwas, was heute wunderlich und leichtsinnig erscheinen könnte: Er wollte sich auf dem Land niederlassen und mit dem aus Amerika mitgebrachten Geld ein kleines Landgut kaufen. Einen solchen Lauf der Dinge hätte niemand erwartet, denn in der Familie gab es keine landwirtschaftlichen Traditionen und er selbst hatte nie Kontakt zu Ackerbau und Viehzucht gehabt. Wie alles in seinem Leben schien diese Entscheidung unverantwortlich, ja geradezu verrückt zu sein. Der Lange setzte seinen Beschluss aber um und kaufte vom Grafen Sobański ein fast fünfzig Hektar großes Gut. Ich weiß nicht, wer Graf Sobański war, obwohl er in seinen Erinnerungen oft wiederkehrte und – wie die meisten Personen der Erzählungen, die der Lange bei diversen Gelegenheiten spann – zu einer Art mythischer Gestalt wurde. Dass die Größe dieses Besitzes die Marke von fünfzig Hektar zwar fast erreichte, jedoch nicht überschritt, sollte noch große Bedeutung haben, denn so unterlag es 1945 nämlich nicht dem Gesetz über die Landreform.
Es befand sich in Radziwiłłów, einem großen Dorf an der Bahnstrecke von Żyrardów nach Skierniewice. Der Lange ließ sich hier nieder und machte sich an die Arbeit; er beschäftigte natürlich eine gewisse Anzahl von Leuten, beschloss aber, alles selbst zu beaufsichtigen. Anfangs beging er anscheinend Fehler über Fehler, doch lernte er bei der Arbeit dazu, selbst wenn er, wie ich gehört habe, niemals besonders gute Erträge erzielt hat. Die Arbeiter und die Nachbarn waren sich rasch darüber im Klaren, dass er keine Ahnung hatte, und so taten sie, was sie wollten, redeten ihm diverse irrsinnige Geschichten ein – und ließen ihn Verluste machen. Ich kann nicht viel über diesen Hof sagen, ich habe ihn gesehen, als er schon im Niedergang begriffen war und der Lange sich – nach dem Krieg – auf seine Rückfahrt in die Vereinigten Staaten vorbereitete.
Seine schreckliche Krankheit brach in der Zwischenkriegszeit aus. Zunächst machten sich Schwierigkeiten beim Gehen bemerkbar, bald darauf stellten die Ärzte die Diagnose: Sein Gebrechen war eine sclerosis multiplex. So bezeichnete er selbst seine Krankheit und so sprach man über sie, denn die polnische Bezeichnung – stwardnienie rozsiane – wurde damals vielleicht von Fachleuten gebraucht, hatte aber keinen Eingang in die Umgangssprache gefunden. Er litt sehr und bewegte sich nur mit Mühe. Die Krankheit hatte aber dennoch einen relativ milden Verlauf, schließlich lebte er mit einem aktiven Lebenswandel mehr als dreißig Jahre mit ihr. Anscheinend zeigte sie erst in der letzten Phase ihre ganze Schrecklichkeit, doch dies geschah bereits nach seiner Rückkehr nach Amerika, also in einer Zeit, in der man hier nicht mehr viel über ihn wusste.
Er ließ sich in Polen behandeln, fuhr aber jedes Jahr zur Kur nach Österreich. In dem erwähnten Album haben sich Fotos von ihm aus Baden bei Wien erhalten, wo er Heilbäder nahm. Er ließ sich meist umkränzt von Frauen ablichten. Eine von ihnen taucht mehrfach auf den Bildern auf, eine junge, sich gut präsentierende Frau, die nach den modischen Vorstellungen der Zwischenkriegszeit gekleidet ist. Das ist gewiss Herta, seine langjährige österreichische Geliebte, die er oft erwähnte. Was erotische Eroberungen betrifft, so hatte er viele Erfahrungen und mehrte sie trotz seiner schweren Erkrankung immer weiter. Und das nicht nur bei seinen Kuraufenthalten in dem nahe Wien gelegenen Kurort, sondern auch in Lodz, wo er angeblich auch mit einer Dame verbunden war, die nicht den besten Umgang gepflegt haben soll. Und auch in dem Dorf, in dem er lebte, war er auf diesem Gebiet nicht untätig, was eine ernste Geschichte war, denn in den letzten Jahren seines Aufenthalts in Polen lebte er mit einem Mädchen zusammen, das er beschäftigt hatte, damit sie ihm den Haushalt führe.
In Baden verbrachte er seine Zeit nicht nur bei der Kur und mit dem Anhimmeln der schönen Herta, sondern er genoss auch die Reize des kulturellen Lebens. Meine Mutter erinnerte sich, dass er ihr einmal erzählt hatte (wohl in der Mitte der 1930er-Jahre), er besuche mit Herta Konzerte in Baden, auf denen die gewaltig ausgedehnten Symphonien eines Komponisten gespielt werden, den in Polen noch niemand kennt; er heiße Mahler. So hörte Mutter erstmals diesen Namen, und als sie kurz darauf im polnischen Rundfunk auf seine 4. Symphonie stieß, wusste sie schon, wer er war. Es fällt mir schwer zu sagen, ob sich der Lange stärker für Musik und andere Kunstformen interessierte oder ob die Begegnung mit Mahler das Ergebnis eines Zufalls oder des Einflusses seiner österreichischen Geliebten war, die monumentale Symphonien mochte. Auf jeden Fall ist die Anekdote überliefert, dass er als Halbwüchsiger mit einem Freund eine Aufführung von Halka im Warschauer Großen Theater besuchen wollte. Eine Eintrittskarte wurde ihm verkauft, doch als er vor der Vorstellung im Pelzmantel und mit nicht allzu gut geputzten Schaftschuhen erschien, wollte man ihn nicht in den Saal lassen. Der Arme konnte damals Moniuszkos Oper nicht sehen. Er war sehr jung und wusste nicht, dass man sich ins Theater etwas festlicher und zugleich etwas konventioneller gekleidet zu begeben hatte.
Dann, in einem historisch wichtigen Augenblick, endeten die jährlichen Reisen nach Österreich. Zunächst gab es den „Anschluss” und dann – nun, das ist bekannt. Als der Krieg ausbrach, versuchte der Lange angeblich noch nicht einmal, nach Amerika zurückzukehren, sondern beschloss, auf seinem Hof in Radziwiłłów zu bleiben. Das war ihm nicht vergönnt: Die Deutschen warfen ihn heraus und übertrugen sein Gut einem Treuhänder, einem Volksdeutschen aus dem Posener Raum, der übrigens einen polnischen Namen trug, an den ich mich bis heute erinnere: Er hieß Pawlak. Der Lange verließ das Dorf aber nicht, zumindest vorerst nicht. In dieser Zeit, gleich zu Beginn des Kriegs, vielleicht auch kurz davor, ging er eine Beziehung mit Natka ein (dieser merkwürdige Vorname war wohl eine Verniedlichungsform von Natalia). Ich bin nicht in der Lage, die genaue Chronologie zu rekonstruieren, es gibt niemanden, der mir dabei helfen könnte. Vielleicht lebt Natka noch, wenn ja, dann ist sie eine Frau über achtzig. Ich könnte sie aber nicht finden, selbst wenn ich es wollte, ich weiß nicht, wie ihr Mädchenname lautete und wie der Name, den sie nach der Heirat annahm (denn schließlich heiratete sie, wie wir noch sehen werden); es wäre die Suche nach der Nadel im Heuhaufen – einer Nadel von vor vielen Jahrzehnten.
Der Lange hatte sie noch in Friedenszeiten eingestellt. Sie kümmerte sich wohl auch später um den Haushalt, doch schon bald veränderte sich ihre Rolle radikal, sie wurde ungleich wichtiger. Bis zum Ende seines Aufenthalts in Polen war sie seine Geliebte und machte daraus kein Geheimnis, was in der dörflichen Gemeinschaft, aus der sie stammte, Anlass für viele Gerüchte und für Gerede gewesen sein muss – und als er im Alter immer gebrechlicher wurde, sorgte sie sich um ihn. Sie war auch aktiv, als der Lange dabei half, seine Familie zu retten, indem er sie aus dem Ghetto herausholte. Natka hat sich in der Besatzungszeit viele Verdienste erworben. Als es Ende November, Anfang Dezember 1943 in der Gegend gefährlich wurde und die Deutschen einige untergetauchte jüdische Familien aufstöberten und erschossen, fanden Mutter und ich eine Woche lang Zuflucht in einer Kartoffelmiete, die zu dem winzigen Hof ihrer Familie gehörte. Sie ließ uns jeden Morgen und jeden Abend für einen Augenblick heraus, damit wir unsere körperlichen Bedürfnisse erledigen konnten, und sie brachte uns auch Essen. Der Lange hatte volles Vertrauen in sie, er hatte sie in alle seine Geheimnisse eingeführt und nahm, offensichtlich, ihre Hilfe in Anspruch, um Menschen, denen es gelungen war, aus dem Ghetto zu entkommen, zu verstecken.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.