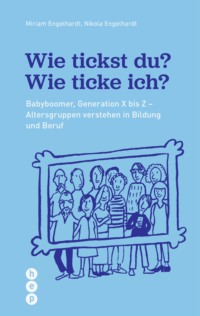Kitabı oku: «Wie tickst du? Wie ticke ich? (E-Book)», sayfa 2
Jugendliche sind klug. All dies lesen sie auf der Wissenschaftsseite in der Zeitung. In derselben Zeitung im Wirtschaftsteil lesen sie von den steigenden Gewinnen der Firmen, die FCKW produzieren. Und Jugendliche kombinieren gerne. Die Jugendlichen der gut versorgten Generation X bekommen das Gefühl, dass ihre Welt hier frontal vor die Wand gefahren wird. Ihre Zukunft gibt es gar nicht mehr. Sie wird von den etablierten

Generation X frontal an die Wand gefahren. Globale Umweltzerstörung, die atomare Katastrophe in Tschernobyl, der Chemieunfall von Sandoz in Basel: Generation X fühlt sich um die eigene Zukunft betrogen.
Erwachsenen kaputtgemacht – von der Wirtschaft, die sich gnadenlos bereichert, und von Politikern, die tatenlos zuschauen. Diese Erwachsenen sind sogar bereit, für kurz- und mittelfristige Gewinne die gesamte Menschheit aufs Spiel zu setzen, FCKW und das Ozonloch sind der Beweis dafür. Als nachkommende Generation hat Generation X offensichtlich nichts mehr zu melden und es gibt nicht mehr viel zu retten. Das ist das ganz tiefe Lebensgefühl der X-ler: no future.
Natürlich wollen sie auch glücklich werden. Wie antworten sie? Sie tragen dieses Gefühl, ihre Zukunft werde ihnen geklaut, nach außen. Sie erleben ja etwas Wohlstand und sind die Ersten, die ein bisschen Taschengeld besitzen. Dieses geben sie für Kleidung und Musik aus. Es entstehen jugendliche Subgruppen: Die Punker tragen die Wut nach außen und machen sie sichtbar. Aggressive Musik, aggressiver Tanzstil, aggressive Kleidung und aggressiver Schmuck – nette Menschen. Dann gibt es die Gruftis: schwarzer langer Mantel, leichenblass geschminkt. Die richtig guten unter ihnen stellen sich einen Sarg ins Kinderzimmer, legen eine Kuscheldecke hinein und gehen abends so ins Bett. Die Mutter kommt ins Jugendzimmer und denkt: «Oh, Gott, mein Kind ist selbstmordgefährdet», sie bekommt bald einen Herzinfarkt. Und die Jugendlichen denken: «Ja, bekomm du mal einen Herzinfarkt, du blöde Kuh.» Bis in die Familien hinein tragen diese Kinder ihren Frust und ihre Wut. Sie kämpfen für eigene Räume und autonome Jugendzentren, weil sie bei den etablierten Erwachsenen nicht mitmachen möchten. Sie kämpfen auch gewalttätig. Es ist die Zeit der Jugendproteste, in der auch Pflastersteine fliegen. Aber die X-ler haben keine echte Vision. Das ist der große Unterschied zu den Babyboomern, deren weltweite Visionen sie lächerlich und blauäugig finden.
Und was passiert, wenn man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wofür man kämpft, sondern hauptsächlich wogegen? Dann geht Energie verloren. Genau das passiert dieser Generation. Da ihr angesichts einer zerstörten Welt die gemeinsamen Ideale und Visionen fehlen, zieht sie sich irgendwann auf sich selbst zurück. Individualismus ist der neue große Wert. Nicht mehr die Welt retten, sondern eigenverantwortlich das eigene Leben möglichst schön gestalten.
Auch hier gibt es eine Subgruppe, die das sehr gut nach außen trägt. Eine neunte, zehnte Klasse in den 80er-Jahren. Die Tür geht auf nach den Sommerferien, herein kommen drei Schüler. Ein Mädchen und zwei Jungs in eleganter Businessgarderobe. Die müssen nichts mehr sagen, die ganze Klasse schaut sie staunend an und die Botschaft ist klar: «Lasst die Welt untergehen. Den letzten guten Job bekomme ich.» Die Popper kommen auf, später die Yuppies und Dinks (double income, no kids). Von ihnen wird der Boden bereitet für Werte wie «Lebensqualität» und «Work-Life-Balance», die bis zur nächsten Generation die Arbeitsmoral der Babyboomer verdrängen werden. Das ist die Antwort von Generation X: Individualismus.
Generation X greift mit dieser Antwort auf eine Ressource zurück, die sie in ihrer Kindheit schon gebildet hat. Sich selbst trösten bei Liebeskummer, sich mit sich selbst beschäftigen, Langeweile aushalten. Angesichts der zerstörten Zukunft ist ihre Antwort: Ich muss mich selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Die Welt – Entschuldigung – können wir nicht mehr retten. Wir kümmern uns um uns selbst.

No Future, Punks und Gruftis. Generation X entwickelt in der Jugend das Lebensgefühl «No future». In Subgruppen wie den Punkern und Gruftis bringt sie ihre Wut und Frustration über eine zerstörte Zukunft zum Ausdruck.
Arbeitsleben
Die Grundhaltung des Individualismus aktiviert die Generation X auch später noch. Für das Arbeitsleben entsteht daraus ein ganz großer Wert: Eigenverantwortung. Wenn Sie ein Projekt haben, das über eine längere Zeit eigenverantwortlich durchgezogen werden muss, geben Sie es einem X-ler oder einer X-lerin – «Endlich mal in Ruhe selbstständig an etwas arbeiten können!», wird er oder sie dankbar sagen.
Was ist sonst noch übriggeblieben bei Generation X im Arbeitsleben? Authentisch sein. Ein kleines Stückchen Pippi Langstrumpf. Es kann Generation X schon mal passieren, dass die Führung morgens nicht alle grüßt. Es kann schon mal passieren, dass ein Mitarbeiter ganz authentisch sagt: «Ich habe heute keinen Bock» und das im 15-Minuten-Rhythmus wiederholt. Dann kann man beobachten, spätestens zur Mittagspause hat er das ganze Team demotiviert. Dieses authentische «Seine-Gefühle-den-anderen-Zumuten» finden wir am ehesten bei Generation X.
Noch ein Punkt. Generation X hat gesehen, man kann pro oder contra Atomkraftwerke sein, aber Tschernobyl fliegt in die Luft. So hat diese Generation tief verinnerlicht, dass alles kritisch hinterfragt werden muss, auch Betriebsentscheidungen, auch Beschlüsse von Vorgesetzten. Sie gehen sogar davon aus, dass kritisches Hinterfragen ein Zeichen von Engagement, Mitdenken und Eigenverantwortung ist. Sie können sicher sein, Babyboomer denken das nicht. Und wieder anders tickt Generation Y: Sie hätte es lieber konstruktiv als kritisch.
Die Kehrseite dieser großen Stärke der Generation X ist, dass sie eine ausgeprägte Eigenverantwortung genauso von den anderen Generationen erwartet, auch von sehr jungen und unerfahrenen Mitarbeitenden. Immer wieder passiert es X-lern, dass sie als Führungskräfte oder in der Ausbildung hauptsächlich Eigenverantwortung erwarten und vergessen, dass sie selbst anleiten, kontrollieren, einfordern, loben und erinnern müssen. Dadurch entstehen häufig Missverständnisse und Enttäuschungen.
Wenn es zu Konflikten in Mehrgenerationen-Teams kommt, werden wir oft zur Teamentwicklung eingeladen. Dann reisen wir an, stellen den Tagesablauf vor, so wie wir ihn uns überlegt haben, und schon geht eine Hand hoch – es ist immer Generation X – und jemand sagt: «Frau Engelhardt, ich zweifle nicht an Ihrer Kompetenz, aber … wenn hier jeder seine Arbeit eigenverantwortlich machen würde, brauchten wir die ganze Teamentwicklung nicht – das ist doch der reinste Kindergarten!» Immer wenn Sie die Wörter «eigenverantwortlich» und «Kindergarten» in einem Satz hören, haben Sie hundertprozentig einen X-ler vor sich.
Das sind die Werte und Aspekte, die Generation X ins Arbeitsleben hineinträgt. Eine verlässliche Generation, aber eine eigenwillige und kritische. Wenn Sie ein Projekt haben, das mal jemand allein durchziehen muss, geben Sie es einem X-ler!
Generation Y
Generation Y, das sind die Jahrgänge ab 1985 bis ungefähr 2000, die Experten sind sich nicht einig, was den Übergang zur Generation Z betrifft.
Welches Bild möchten wir Ihnen zu dieser Generation mitgeben? Generation Y ist abgeschossen in die Galaxie der Möglichkeiten. Alles kann man lernen und studieren und ganz einfach ins Ausland gehen. Die Bildungswege sind durchlässiger geworden. Es liegt aber auch in der eigenen Verantwortung, den besten Weg in dieser Galaxie zu finden, und dadurch entsteht Unsicherheit: «Schaffe ich das, kriege ich das hin?»
Kindheit
Generation Y erlebt einen verständnisorientierten Erziehungsstil. Das Ziel der Eltern ist es, ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern aufzubauen und zu erhalten. Eltern lassen ihre Kinder zu Wort kommen, begegnen ihnen mit Wertschätzung und loben mehr. Sie wollen auf Augenhöhe mit ihnen zusammenleben und binden ihre Kinder sehr früh in Entscheidungen ein, z. B. wohin es in den Urlaub gehen soll. Unglaubliche «Macht» der Kinder, könnte man denken. Aber die Eltern haben schnell gelernt, dass der Urlaub doppelt so erholsam und entspannt ist, wenn sich auch die Kinder wohlfühlen.
Die Jüngeren der Generation Y erleben sogar schon den beratenden oder coachenden Erziehungsstil.2 Hier werden die Eltern zur wichtigen Vertrauensperson. Die Jugendlichen fragen sie bei ganz persönlichen Themen um Rat und vertrauen ihren Eltern ihre Gefühle an. Das ist ein radikaler Unterschied zum hierarchischen Verhältnis der Babyboomer zu ihren Eltern. Dort ist Förderung noch stark mit Strafen gekoppelt und Entscheidungen werden von den Eltern gefällt.
Heute wird gefragt: Was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Entsprechend erleben die Y-ler zuhause keine Prügel, das ist die absolute Ausnahme, sondern Verständnis und Unterstützung. Sie haben nie vor dem Vater gezittert oder vor einem Erwachsenen wegen Prügel oder Spott wirklich Angst haben müssen. Darum haben sie kein Gespür für Hierarchien. Selbstverständlich geben sie Feedback von unten nach oben und sagen dem Chef unverblümt, was sie denken. Sie haben nie gehört: «Schweig, du bist nicht gefragt worden!», wenn sie eine gute Idee hatten, sondern ganz im Gegenteil: «Was meinst du dazu, mein Kind?» Die Eltern von Generation Y sind froh, wenn ihre Kinder von der Schule erzählen, jede Geschichte ist willkommen. Generation Y ist gewohnt zu sprechen, mit jedem und zu jeder Zeit.
Generation Y erlebt schon in der Kindheit eine große Flexibilität der Beziehungen, also häufige Wechsel von Bezugspersonen und Freunden. Diese neue Normalität beginnt schon bei kleinen Kindern. Nehmen wir die traditionelle Familie: Ein Kind wird geboren, die Mutter entscheidet sich, die ersten drei oder vier Jahre zu Hause zu sein. Spätestens dann kommt das Kind in den Kindergarten. Und höchstwahrscheinlich wird es die Erzieherin oder den Erzieher lieben! Es wird ab und an kleine Geschenke basteln oder selbstgemalte Bilder mitbringen. Nach zwei oder drei Jahren findet der Wechsel in die Grundschule statt. Wahrscheinlich sieht das Kind die Erzieherin, die es vorher jeden Tag als enge Bezugsperson hatte, nie wieder! Dann kommt die Schule, auch da macht man noch gelegentlich Geschenke, lässt sich vielleicht noch zum Trost in den Arm nehmen. Und nach zwei Jahren? Fast überall findet ein Klassenlehrerwechsel statt, also wieder der Wechsel einer engen Bezugsperson. Spätestens da sagen die Eltern: «Schätzchen, mach dir keine Sorgen, die Frau Maier, die du nächstes Jahr bekommst, ist genauso nett wie der Herr Schulz, den du dieses Jahr hattest.» Und genau das erleben die Kinder! Jede nächste Bezugsperson ist offen, freundlich, nett, unterstützend. Denn Generation Y erlebt eine vollkommen andere Pädagogik als die vorhergehenden Generationen. Das Kind da abholen, wo es steht mit seinen Stärken und Schwächen, das ist die neue Devise. Willkommen heißen, fördern, unterstützen. Auch die Lehrperson wird zum Lerncoach. Darum bewegt sich Generation Y wie der Fisch im Wasser in dieser Flexibilität der Beziehungen.
Jugend/Junge Erwachsene
Was macht Generation Y für Erfahrungen in ihrer Jugend und im jungen Erwachsenenalter? Die Flexibilität der Beziehungen, die sie aus Kindergarten und Schule kennt, geht weiter. Als Generation Praktikum sind die Y-ler immer wieder wochen- oder monatsweise in ganz neuen Kontexten und Teams. Auch Studium und Ausbildung werden zunehmend modularisiert. Das heißt, in diesem Kurs sind sie mit dieser Gruppe, im nächsten Kurs mit einer anderen. Generation Y kann bestens damit umgehen, unter der einen Bedingung: dass sie von Anfang an gut aufgenommen wird. Flexibilität ist nur lebbar, wenn man sofort willkommen geheißen wird. Das eine ist die Pädagogik: mit Stärken und Schwächen angenommen werden. Das andere ist die Klasse oder das Team. Generation Y braucht ein Nest. Sie will sofort vollwertig dazu gehören.
Dazu kommt das Handy mit Messaging und später auch Social Media und Vernetzungsmöglichkeiten zum Beispiel über Facebook (Gründung 2004) und Instagram. Das ist neu und interessant für die Y-ler. Sie werden die ersten Nutzer, verbringen zunehmend Zeit im Netz. Virtuelle und reale Welt gehen fließend ineinander über, man ist vernetzt mit Freunden, die man auch im echten Leben sieht. Urlaub im Funkloch bedeutet soziale Isolation.
In der Galaxie der Möglichkeiten tun sich permanent neue Chancen auf. Das hohe Tempo, in dem Veränderungen stattfinden, ist für Generation Y normal. Die Y-ler erleben auch, dass die Älteren mit diesem Tempo nicht mehr mithalten. In der Weiterentwicklung der Handys und PCs erleben sie das haut- und produktnah. Generation Y ist hier immer mit der Nase vorn und erklärt Eltern und Lehrern, wie die Technik funktioniert oder was gerade das Neueste ist. In der IT-Branche selbst wissen die Professorinnen und Professoren nicht mehr, was sie in die Lehrpläne schreiben sollen. Nach einem Basisstudium können sie den Studierenden nur noch beibringen, wie sie sich auf dem Laufenden halten. Bevor die Lehrpläne geschrieben sind, hat sich die IT-Branche schon wieder selbst überholt.

Galaxie der Möglichkeiten. Die Welt liegt der Generation Y zu Füßen. Sie ist abgeschossen in die Galaxie der Möglichkeiten. Hier ein Planet, da ein Sonnensystem, Sterne flimmern, es gibt einfach alles.
Generation Y erlebt auch, wie in den Berufsinformationszentren von erwachsenen Beratern erklärt wird, dass es neue Berufe geben wird und dass man die Ausbildungsangebote, Berufe und Tätigkeitsfelder der nächsten zehn Jahre noch gar nicht absehen kann. Ratlosigkeit: Was soll man denn dann werden?
Privat möchte sie auf die Möglichkeit zur Veränderung auf keinen Fall verzichten. Wenn man Jugendliche und junge Erwachsene fragt: «Wenn ich dir jetzt deinen Traumjob bieten könnte: interessante Tätigkeit, gutes Gehalt, Ferien, Weiterbildungsmöglichkeiten, nettes Team, und du bekämst diesen Traumjob unter der einen Bedingung, dass du heute unterschreibst, dass du zwanzig Jahre bleibst. Was würdest du tun?» Fast immer ernten Sie auf diese Frage schreckgeweitete Augen. Heute unterschreiben, dass ich für zwanzig Jahre bleibe? «Nein», sagen die meisten, «das würde ich für den tollsten Job der Welt nicht machen.» Das fühlt sich an wie das Urteil «lebenslänglich».
Arbeitsleben
Wie äußert sich dieses Lebensgefühl «Abgeschossen in die Galaxie der Möglichkeiten» im Arbeitsleben? Man darf nicht verloren gehen in dieser Welt der millionenfachen Möglichkeiten. Das ist bei Generation Y wirklich doppelt gemeint, privat wie beruflich.
Generation Y will sofort freundlich und herzlich aufgenommen werden, ein Nest, einen Anker auch im Arbeitsleben haben. Das Team muss sie ab der ersten Stunde wertschätzen und anerkennen. Fachlich gesehen werden die Y-ler immer die Berufe oder die Ausbildungen wählen, in denen sie das Gefühl haben, da gibt es ohne Ende Anschluss-, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. «Ich habe mich noch nicht festgelegt», hören wir häufig. Es wäre ja auch schlimm, sich festzulegen, wenn rundherum eine Galaxie der Möglichkeiten existiert. Es ist die Generation, die am besten ausgebildet ist, denn genau das, die Ausbildung, die stetige Weiterbildung und immer häufiger das Studium sind ihre Schlussfolgerungen aus dem Wunsch, beruflich anschlussfähig zu sein.
Im Arbeitsleben spüren wir, Generation Y will klare Regeln, klare Ansagen, klare Vereinbarungen, ganz klare Aufträge. Früh haben die Y-ler gelernt, bei Mama darf ich dies, im Kindergarten darf ich das, dann gibt es vielleicht noch einen Tag bei den Großeltern und einen beim Papa. Überall gelten unterschiedliche Standards. Es gibt keine allgemeingültigen Normen oder Selbstverständlichkeiten mehr. Also wünschen sie sich, wo immer sie sind, dass die andere Seite klar sagt: Mach dies und jenes so und so, dann bin ich mit dir zufrieden. Klare Regeln zur Orientierung, damit man schnell Anerkennung bekommt.
Gleichzeitig werden sie bei Regeln immer nach Ausnahmen fragen. Denn die Generation Y hat ab dem Moment, in dem sie sprechen kann, bereits verhandeln gelernt. Ein kleines Kind von zweieinhalb Jahren wird von der Mutter gefragt: «Möchtest du Schokopudding oder Erdbeerjoghurt zum Nachtisch?» Und das Kind sagt: «Beides!» Es wird nach seinen Wünschen gefragt. Nie ist ihm das Sprechen verboten worden. Und die Mutter denkt: Ein Löffel Erdbeerjoghurt, ein Löffel Schokopudding, das ist doch von den Kalorien her in Ordnung. Sie sehen: absolut verhandlungsstark sind die Vertreter dieser Generation im Aushandeln von Ausnahmen. Sie wünschen sich Regeln zur Orientierung und werden doch immer versuchen, eine Ausnahme für sich herauszuholen. Sie nehmen es aber auch nicht übel, wenn sie die Ausnahme nicht bekommen, sofern das für sie gut begründet und nachvollziehbar ist.
Sie wollen auch klare Arbeitszeitregelungen. Überstunden und Einspringen, das muss sehr gut begründet sein und ausgeglichen werden. Denn für Generation Y ist Work-Life-Balance eine Selbstverständlichkeit. Es gibt den klaren Vorrang der Arbeitswelt über das Private nicht mehr. In der Galaxie der Möglichkeiten geht es darum, das ganze Leben möglichst angenehm zu gestalten. Beruf und Arbeitszeit sind lediglich ein Teil davon.
Abgeschossen in die Galaxie der Möglichkeiten ist es schwer abzuschätzen, ob man wirklich am besten Ort gelandet ist. Generation Y wünscht sich von den Älteren und Erfahreneren, dass sie ihnen vermitteln: Hier ist es schön, schau mal, was wir hier bewerkstelligen, wir sind die beste Abteilung, guck mal, was wir für tolle Ergebnisse haben, hier bist du richtig. Um auch dem Stress standzuhalten, dass immer irgendwo eine Nachricht reinkommt von Gleichaltrigen, die in einem sozialen Netzwerk posten: «Mein Beruf ist besser, ich bekomme 150 Euro mehr», «ich bekomme Weiterbildungen bezahlt», «Bei mir nimmt sich die Chefin Zeit für mich» … Die permanente Flut von Vergleichsmöglichkeiten erzeugt bei den Y-lern die Unsicherheit, vielleicht nicht am richtigen Ort in der Galaxie zu sein. Wenn da eine Führung ruhig sagt: «Hier ist der beste Ort, hier bist du gut, hier erreichen wir sinnvolle Ergebnisse», dann sind die Y-ler glücklich. Sie wünschen sich Orientierung und geben ganz viel Motivation und Herzblut, wenn sie das Gefühl haben, ich bin willkommen und weiß, wofür ich da bin.

Generation Y – vernetzt und anschlussfähig. Ob auf der Suche nach der coolsten Party oder nach dem idealen Job – Generation Y ist vernetzt, sucht online und tauscht sich aus.
Das ist unsere Generation Y, immer vernetzt, niemals allein und dann hoch motiviert und durchaus leistungsorientiert.
Generation Z
Es besteht unter Expertinnen und Experten zurzeit noch keine Einigkeit, ob es Generation Z schon gibt oder ob man die gegenwärtige Jugend noch den späten Jahrgängen der Generation Y zuordnen kann. Der bekannte Jugendforscher Klaus Hurrelmann reserviert die Geburtsjahrgänge bis 2000 noch für die vorhergehende Generation Y, während andere über Generation Z schon ab den Jahrgängen nach 1995 sprechen.3
Natürlich gibt es Bücher über Generation Z und wir haben kürzlich sogar schon einen Vortrag über eine angeblich übernächste Generation im Netz gefunden, die Generation A bzw. Alpha.4 Oft bekommt man jedoch den Eindruck, dass die Inhalte nicht wirklich neu sind, sondern dass es sich nur um alten Wein in neuen Schläuchen handelt. Die Frage bleibt, ob die gegenwärtige Jugend den späten Jahrgängen von Generation Y ähnelt und die gesellschaftlichen Erfahrungen, die sie prägen, sich intensiviert, aber nicht wirklich qualitativ verändert haben. Also ein bisschen mehr IT, mehr künstliche Intelligenz, ein anderer Grad an Vernetzung, aber nichts komplett Neues. So hatten die älteren Jahrgänge von Generation Y als Jugendliche den PC zuhause als Computer-Tower unterm Schreibtisch stehen und vielleicht gab es nur einen in der Familie. Heute tragen alle Studierenden ihre persönlichen Laptops oder Tablets in die Vorlesungen und machen ihre Mitschriften elektronisch. Der PISA-Sieger Finnland will die Handschrift abschaffen. Auch das eigene Handy hat man heute selbstverständlich früher, nämlich schon als Kind, und man hat es auch deutlich häufiger in der Hand. Vielleicht sind es die gleichen Herausforderungen, nur ein bisschen intensiver.
Wenn wir streng beim Generationenbegriff bleiben, müsste sich die Gesellschaft rund um das Jahr 2000 so stark geändert haben, dass die kommende Jugend wirklich eine neue Qualität an Herausforderungen vorfindet und also auch gezwungen ist, neu darauf zu antworten. Die Antworten wären dann die typischen Einstellungen, Verhaltensweisen und Werte dieser Generation.
In manchen Ländern Europas ist das längst und sehr eindeutig der Fall. In Griechenland zum Beispiel hat die Finanzkrise so starke Auswirkungen, dass die Arbeitslosigkeit dramatisch ansteigt. Im wirtschaftlich härtesten Jahr 2013 steigt dort die Jugendarbeitslosigkeit auf fast 50 Prozent an, fünf Jahre später liegt sie immer noch bei knapp 40 Prozent. Das ist eine Herausforderung, die Antworten in den verschiedensten Lebensbereichen erfordert. Wie zum Beispiel soll man ein Selbstwertgefühl und Stolz auf das Geleistete entwickeln, wenn es keine Aussicht auf einen Beruf gibt? Wie den Mut fassen, eine Familie zu gründen, ohne Aussicht auf ein gesichertes Einkommen? Worüber im Smalltalk sprechen beim Kennenlernen, wenn Arbeit und Ausbildung keine Themen mehr sind? Welche Träume und Lebenspläne verfolgen, wenn die Existenzsicherung so schwierig ist? Griechenland und wahrscheinlich genauso Spanien und Italien haben längst eine neue Generation ausbilden müssen. Eine Generation, die auf diese neuen Herausforderungen eine Antwort findet. In Griechenland, so ist uns erzählt worden, wollte die Jugend früher von den Inseln weg und so schnell wie möglich in die Hauptstadt ziehen. Athen war interessant, lebendig, zukunftsweisend. Es gab eine große Landflucht. Heute sieht man dagegen die Tendenz, dass die Jugend Athen und seine Arbeitslosigkeit verlässt, die kleinen Inseln aufsucht und die alten Olivenplantagen wieder kultiviert. Sie baut dort aber etwas anderes auf als den traditionellen Familienbetrieb und versucht, im Direktvertrieb ihren Weg zu finden.
Im deutschsprachigen Raum spielt die Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich dazu keine Rolle. Die alten Muster funktionieren noch. Arbeit und Beruf sind nach wie vor wichtig für Selbstwert und Zukunftspläne und mit einer guten Ausbildung hat man nach wie vor gute Berufsaussichten. Auch der beratende und coachende Erziehungsstil, wie er schon bei den späten Jahrgängen der Generation Y zu finden ist, ist geblieben und hat sich eher weiter durchgesetzt. Neu könnte sein, dass Generation Z deutlich häufiger schon im Kleinkindalter in Kindertagesstätten betreut wird und durchaus auch ganztags. Damit sinkt der Einfluss der Eltern als Bezugspersonen und die Bedeutung der gleichaltrigen Freunde, der Peergroup, steigt schon sehr früh. Das verstärkt sicherlich das Gefühl der Gleichrangigkeit anstelle von Hierarchie und Autorität. Die kleinen Freundinnen und Freunde sind dann neben Eltern und Erziehern diejenigen, von denen ich etwas lerne und die mich in einer Clique führen. Der Kumpel als Vorbild, nicht der Lehrer und Vorgesetzte. Aber auch hier ist die Frage, haben wir wirklich eine neue Qualität oder nur eine Intensivierung des beratenden, coachenden Erziehungsstils?
Was wären neue Herausforderungen und Erfahrungen, die so anders sind, dass wir im Mannheim’schen Sinne eine neue Generation ausmachen könnten?
Die statistische Grundlage ist dürftig, allein schon deshalb, weil die neue Generation erst im Kommen ist, also meistenteils noch zur Schule geht oder sich in der Ausbildung befindet. Sie hat den Schritt in die Arbeitswelt noch nicht oder erst vor kurzem getan, und darum weiß man noch nicht so genau, wie diese Generation die Welt wahrnimmt.
Wir möchten hier dennoch einen Ausblick geben und erste Hypothesen wagen. Wenn es Generation Z gibt, was sieht und erlebt sie Neues? Worauf muss sie eine Antwort finden? Wir wollen es in einem Bild formulieren. Generation Z ist eingesaugt ins Schwarze Loch der Social Media.
Herausforderungen
Das große Neue ist das Smartphone. Nicht das Handy, das kam bei Generation Y dazu. Sondern die Verbreitung des internetfähigen Smartphones und WLAN sowie die damit verbundenen Social Media mit Angeboten wie Google, Youtube (2006), Facebook (2004), Instagram, Twitter, WhatsApp und anderen. Mit dem Smartphone und dem Ausbau der Netze ist die Normalität entstanden, permanent und überall im Internet zu sein. Generation Z wächst damit auf. Daraus ergeben sich besonders in drei Bereichen neue Herausforderungen.
1.Hohe Erwartungen
2.Im Rampenlicht wie Prominente
3.Aufmerksamkeit: Ständige Ablenkung
Hohe Erwartungen. Durch den permanenten Zugang zum Internet ist die Jugend einer fortwährenden Reizüberflutung ausgesetzt. Nehmen wir Youtube als Beispiel. Was ins Netz gestellt wird, sind nur die lustigsten, süßesten oder spektakulärsten Momente. Aus den unzähligen Filmchen, die so gerne geschaut werden, wurden vorher alle Passagen herausgeschnitten, in denen nicht viel passiert. Es ist eine Aneinanderreihung von intensiven und besonderen Situationen. Die Jugendlichen sehen also permanent und ausschließlich Highlights.
Das schraubt die Erwartungen enorm in die Höhe. Was bedeutet das aber für das eigene Leben, was heißt es für die Erfahrungen, die die Jugendlichen konkret machen? Gegenüber all dem, was man im Netz sieht, erscheinen die eigenen Erlebnisse vielleicht ganz grau und langweilig. So entstehen große Unsicherheiten. Soll ich mich trauen, snowboarden oder mountainbiken zu gehen, wenn die Sprünge und auch die Stürze auf Youtube so unerreichbar spektakulär sind? Was hat mein kleiner Sprung noch für einen Sinn, für eine Bedeutung? Soll ich ihn überhaupt noch wagen? Oder ist er nicht von vornherein dazu verurteilt, lächerlich zu wirken?
Diese Unsicherheiten bei einzelnen Aktivitäten summieren sich auf, senken das Wohlbefinden, die Zufriedenheit und führen zu Fragen wie: Was ist überhaupt ein schönes Leben? Welche Erfahrungen möchte ich denn machen? Nur die Highlights? Ist das menschenmöglich? Ist das für mich möglich? Schaffe ich das? Der permanente Vergleich mit den Highlights der anderen kann furchtbar am eigenen Selbstwertgefühl nagen. Es sind genau diese überhöhten Erwartungen, die zur neuen Herausforderung werden.
Ähnlich ist es mit dem – insbesondere für die Jugendlichen – so wichtigen Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wie können sie ihre Erfahrungen wertschätzen? Wie können sie dieses gute Gefühl der Selbstwirksamkeit erleben: «Ja, ich habe etwas hinbekommen, ich habe etwas geschafft und kann stolz darauf sein», wenn immer die Frage im Raum steht, ob das, was ich da geschafft habe, gut genug ist und nicht schon längst von jemandem im Netz weit übertroffen wurde? Die Jugendlichen geraten in einen Rating-Modus – in permanentes Vergleichen. Dabei entsteht die Gefahr, dass das eigene Leben zum Kinosessel wird, an dem das Leben der anderen mit tollen Bildern vorbeizieht. Genau dieses Lebensgefühl reflektieren die Z-ler in ihrer Slam-Poetry und stellen die Sehnsucht dagegen, sich selbst zu spüren, sich zu trauen und irgendetwas Eigenes zu machen. Leben, statt abwarten und vorbeiziehen lassen, in der Erwartung, es könnte etwas noch Tolleres kommen.
Es sind ja nicht nur die Erwartungen der Eltern, die man mit einem eigenen Wertesystem kritisch hinterfragen könnte. Es ist die Flut der Filme, Berichte und Erfahrungen von Gleichaltrigen – gut ausgewählt, geschnitten und vertont – dieses Meer an Highlights, das die eigenen Erwartungen so hoch schraubt. Auf diese Herausforderung der unendlich hohen Erwartungen und des permanenten Vergleichens müssen die Jugendlichen eine Antwort finden.
Im Rampenlicht wie Prominente. Je größer die Reizüberflutung, desto knapper wird die Ressource «Aufmerksamkeit». Da stellt sich die Frage, wie man es überhaupt noch schafft, wahrgenommen zu werden. Wie früher bemühen sich die Jugendlichen um Selbstdarstellung. Sie wollen ausprobieren, wie sie auf die Welt wirken, und zeigen, wer sie sind und werden wollen. Auf jeden Fall wollen sie zeigen, dass sie keine Kinder mehr sind. Was sie aber genau sind und werden wollen, ist ja eine Urfrage und Entwicklungsaufgabe auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Selbstdarstellung ist also vollkommen normal und ein wichtiger Teil dieser Entwicklungsaufgabe.
Generation Z sieht sich vor der Doppelaufgabe einer guten Selbstdarstellung in der realen Welt und im Netz. Das sind zwei ganz verschiedene Aufgaben, denn wir kennen die Ansprüche, die aus dem Internet resultieren: Nur die Highlights haben eine Chance, die Aufmerksamkeit der anderen zu bekommen. Der Druck zur Selbstoptimierung ist enorm und die Selbstdarstellung professionalisiert sich. Sie wird für manche sogar zur neuen Möglichkeit, als Influencer den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn sie aufgrund einer großen Fangemeinde, ihrer Follower, Werbeaufträge bekommen. Schöne Fotos in den Social Media zu posten, ist das eine. Das andere ist der Druck: lieber gar kein Bild als ein schlechtes Bild, das ist für alle sichtbar peinlich. Andererseits ist Fotografieren eine kreative Beschäftigung. Es macht sicherlich Spaß, die schönsten Fotos zu machen und Clips zu drehen bei bestem Licht, bestens gestylt, in bester Pose – das Wissen dazu kann man sich ja wiederum im Internet aneignen.
Die Selbstdarstellung im Netz hat natürlich auch Auswirkungen auf die reale Welt. Beide sind in Echtzeit miteinander verbunden. Der Druck zur Selbstoptimierung erschwert Begegnungen und das soziale Miteinander in der realen Welt. Er führt zu Unsicherheiten und löst Ängste wie die folgenden aus: Schaffe ich es überhaupt, heute auf der Party so gut auszusehen wie auf meinen eigenen Bildern bei Facebook oder Instagram? Das gilt für beide Geschlechter. Es geht wie früher darum, immer eine gute Figur zu machen und es geht darüber hinaus neu darum, immer filmreif zu sein – nicht für ein fernes Hollywood, sondern für das alltägliche Internet. Was kann ich überhaupt noch sagen, wenn die Gefahr besteht, dass mein Spruch eben nicht so cool und lustig ist wie die Aneinanderreihung der coolen und witzigen Sprüche, die wir vom Internet gewohnt sind? Und wie kann ich vor dem Hintergrund eines fast perfekt optimierten Profils das teilen, was in mir vorgeht? Wo ist Platz für meine Ängste, Wünsche und Träume, für meine schönen und vor allem die schweren Gefühle? Wie kann ich diese Gefühle ehrlich mit jemandem teilen, bevor sie optimal formuliert und hübsch genug verpackt sind fürs Internet?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.