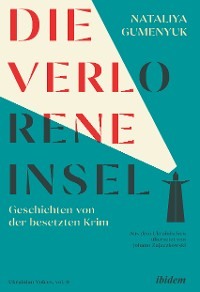Kitabı oku: «Die verlorene Insel», sayfa 4
10 Mittlerweile aufgelöste, auf Janukowytsch eingeschworene paramilitärische Spezialeinheit der ukrainischen Sicherheitskräfte; maßgeblich verantwortlich für die Mehrzahl der zivilen Todesopfer auf dem Maidan (Anm. d. Übers.).
11 Populäre Bezeichnung in der Ukraine für die mehr als 100 Todesopfer der Proteste auf dem Maidan (Anm. d. Übers.).
12 Ich bemerke, dass auf der Krim wie auch in russischen Fernsehsendern das Wort „Banderiwtsi“ wie „Benderiwtsi“ ausgesprochen wird. Es geht hier schon lange nicht mehr um Bandera – der Wortschatz der Propaganda ist ein Thema für sich (Anm. d. Autorin). „Banderiwtsi“ ist eine abwertende Bezeichnung für Ukrainer im Allgemeinen oder Menschen aus der Westukraine im Speziellen und spielt auf den ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera (1909-1959) an (Anm. d. Übers.).
13 Sergej Aksjonow, ehemaliger Abgeordneter des Parlaments der Autonomen Republik Krim und Vorsitzender der prorussischen Partei „Russische Einheit“, gilt als einer der Drahtzieher hinter dem völkerrechtswidrigen Referendum über die Abspaltung der Krim von der Ukraine (Anm. d. Übers.).
14 Oleksandr Turtschynow. Nach der Flucht von Wiktor Janukowytsch vom 23. Februar bis zu zur Amtseinsetzung von Petro Poroschenko am 7. Juni 2014 Übergangspräsident der Ukraine (Anm. d. Autorin).
15 Dmitrij Jarosch. 2014 der Anführer der nationalistischen Bewegung „Rechter Sektor“ (Anm. d. Autorin).
16 „Moskaly“ im ukr. Original. Abwertende Bezeichnung für Menschen aus Russland (Anm. d. Übers.).
17 Seit 2015 Eurasische Wirtschaftsunion. Mitgliedstaaten: Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Weißrussland (Anm. d. Übers.).
18 Am 22. März 2014 verteidigte die 204. Brigade der taktischen Luftwaffe unter dem Kommando von Juli Mamtschur in Eigenregie den Stützpunkt A-4515, der schlussendlich durch russische Besatzungstruppen und unbekannte bewaffnete Einheiten eingenommen wurde. Nach der Stürmung wurde Mamtschur von russischen Militärangehörigen verschleppt. Anschließend wird Mamtschur berichten, dass er drei Tage in Isolationshaft festhalten wurde. Russische Soldaten hätten versucht, ihn zum Übertritt in die russische Armee zu bewegen. Am 26. März 2014 verließ Mamtschur gemeinsam mit fünf weiteren gefangenen Offizieren unter der Eskorte russischer Sturmgewehre die Krim. Seine Einheit wurde nach Mykolajiw verlegt. Von 2014 bis 2019 war Mamtschur für die Partei „Block Petro Poroschenko“ Abgeordneter in der Werchowna Rada (Anm. d. Autorin).
19 „Surshyk“ im ukr. Original. Als Surshyk wird eine informelle Mischsprache aus Ukrainisch und Russisch bezeichnet (Anm. d. Übers.).
20 Im Besitz des zum prorussischen Meinungsspektrum zählenden Oligarchen Dmytro Firtasch. Während des Maidan überwiegend regierungs- und kremlfreundliche Berichterstattung (Anm. d. Autorin).
21 Populäre Bezeichnung für das Gesetz „Über die Grundlagen der staatlichen Sprachenpolitik“, die auf die Namen zweier prorussischer Abgeordneter zurückgeht. De jure garantiert das 2012 angenommene Gesetz die Nutzung „regionaler Sprachen“ in der Ukraine. De facto hat das Gesetz Russisch in einigen Regionen zur zweiten Amtssprache gemacht und nach Ansicht von Kritikern die staatliche Unterstützung für die ukrainische Sprache eingeschränkt. Unmittelbar nach dem Maidan stimmte die Werchowna Rada für die Aufhebung des Gesetzes – ein Vorgang, den sich die russische Propaganda zunutze machte (Anm. d. Autorin).
Teil II UNRUHE
April – Mai 2014
Sewastopol – Simferopol - Sudak
In Schokolade getaucht, oder: der See, den es nicht gibt
„In den letzten anderthalb Monaten sind die Preise für Lebensmittel gestiegen“, erklärt ein Gemüseverkäufer auf dem Markt von Sewastopol. Ich filme seine Aussage mit meinem Smartphone. Das bleibt nicht unbemerkt; ein älteres Ehepaar mischt sich in die Unterhaltung ein: „Was behaupten Sie da?! Alles ist günstiger geworden.“ „Aber ich musste doch die Preise erhöhen. Vom Festland werden keine Lebensmittel mehr geliefert“, widerspricht der Händler überrascht. „Ja, aber wenn man die steigenden Renten und Gehälter berücksichtigt, kommt es uns billiger“, beharren die beiden.
Ich kann die Logik nicht ganz nachvollziehen. Die Kunden wollen dem Händler, der die Preise erhöht hat, weismachen, dass seine Waren günstiger geworden sind? Davon abgesehen wurden die Rentenzahlungen für April zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausbezahlt. Im Laufe dieser Reise auf die Krim werde ich Zeugin einer nicht minder bizarren Unterhaltung in Form eines Streits zweier Nachbarn in einem Kurort in der Nähe der Kapsel-Bucht bei Sudak. Auf der Krim kursieren Gerüchte, wonach die Ukraine im Begriff sei, die Wasserversorgung zu unterbrechen: „Aber das wird uns keine Probleme bereiten, denn im Dorf gibt es einen unterirdischen See“, wird der eine Nachbar im Brustton der Überzeugung behaupten. „Aber wir haben keinen unterirdischen See“, wird daraufhin der andere Nachbar entgegen. Dass es dort wirklich keinen unterirdischen See gibt, ist eine unbestreitbare Tatsache. Sudak wird in den Maifeiertagen wie ausgestorben sein, die meisten Hafenrestaurants bleiben geschlossen. Einige werden schlicht behaupten, dass die Saison noch nicht begonnen habe. Andere werden erläutern, dass über die kurzen Feiertage in der Regel Ukrainer angereist seien – für Russen ist es zu weit weg, und der Weg von Rostow am Don über Donezk ist gefährlich. Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Tourismusbranche durch Reisewillige aus Russland wieder erholt hat.
Ende April 2014, anderthalb Monate nach der Annexion, kehre ich auf die Krim zurück. Das russische Militär versteckt sich nicht länger hinter der Mär von den „grünen Männchen“. Die Ukraine blickt gebannt auf den Donbas, wo eine Ortschaft nach der anderen an die Separatisten fällt. Doch ich habe den Menschen, die ich zu Beginn der Annexion getroffen habe, versprochen, zurückzukommen. Ich bin in Verzug, denn ich komme geradewegs aus Donezk und Luhansk. In dieser Region hat der „Antimaidan“ großen Zulauf. Derweil halten die Grenzschutzbeamten an der ukrainisch-russischen Grenze noch die Stellung. Ich war auch in Kramatorsk, wo ein berüchtigter russischer Aufständischer den Platz neben dem Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU in Beschlag genommen hat, während der Flugplatz von ATO-Kämpfern1 und der SBU-Spezialeinheit Alpha gehalten wird.
Die Krim ist nicht länger das Epizentrum des Geschehens. Hier ist schon alles gelaufen. Wie zu erwarten, ersticken die Krimbewohner an dem bürokratischen Dickicht, das seit der Annexion von ihren Leben Besitz ergreift. Meldebescheinigung, Registrierung, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Russische Nummernschilder sind noch nicht verpflichtend, russische Pässe werden derzeit nur für Beamte ausgestellt. Alles ist unklar: Nach welchem Lehrplan die Abschlussprüfungen stattfinden, welche Zertifikate zur Hochschulzulassung benötigt werden, nach welchen Zuständigkeitsbereichen und Verfahrensabläufen sich die Krankenhäuser richten müssen. Der Zug Kyjiw – Sewastopol verkehrt nach wie vor; die ukrainischen Mobilfunkanbieter sind noch immer an das Netz angeschlossen; die Hrywnja wird weiterhin als Währung akzeptiert; dagegen haben die meisten Banken ihren Betrieb bereits eingestellt: „Aus technischen Gründen nicht möglich“, lese ich auf den Bankautomaten der Privatbank – der bis zur Annexion wichtigsten Bank auf der Krim –, deren Konten gesperrt worden sind. Dadurch haben viele Menschen keinen Zugriff auf ihre Gehälter und Vorschüsse. Viele Banken waren anderthalb Monate geschlossen und haben dann schrittweise wieder geöffnet. Sobald eine Bank

wieder öffnet, bildet sich sofort eine lange Warteschlange. Eine Person wird mir erzählen, dass sie den 4.625-ten Platz auf der Warteliste habe. Täglich müsse man seinen Anspruch auf den Platz in der Warteschlange behaupten, andernfalls verfalle er. Jeder Tag bietet genügend Anlässe zur Sorge und reichlich Gründe, sich den Kopf zu zerbrechen. Da bleibt keine Zeit für Politik – von Geopolitik ganz zu schweigen! Buchstäblich jede Person hat eine dringende persönliche Angelegenheit zu regeln.
Bei dieser Reise geht es mir nicht darum, einzig und allein über den mutigen Widerstand und die Unterdrückung zu berichten. Im Frühjahr 2014 haben wir Journalisten noch geglaubt, dass unsere Arbeit irgendwas bewirken kann. Wenn wir nur die Probleme zur Sprache bringen, können diese gelöst werden – oder man kann zumindest eine Verfügung oder Anordnung erlassen; eine Richtschnur für das Leben der ukrainischen Bürger unter Besatzung. Zu diesem Zeitpunkt schien es noch, als würden Probleme nur deshalb nicht gelöst, weil sie schlicht nicht bekannt sind.
Wir begleiten Iryna in der Marschrutka, einem Kleinbus im öffentlichen Nahverkehr, zu einer Verwaltungsbehörde in einer der Plattenbausiedlungen von Sewastopol. Die Frau lebt schon seit sechs Jahren auf der Krim, allerdings ohne Aufenthaltsgenehmigung. Sie hat hier standesamtlich geheiratet und weiß nicht, ob sie das Recht hat, mit ihrem ukrainischen Pass auf der Krim zu bleiben und einen russischen Pass zu beantragen. Am Vortag hat Iryna an einer Kundgebung der „Sewastopoler ohne Aufenthaltsgenehmigung“ teilgenommen. Die Anwesenden verlangten von den Besatzungsbehörden mehr Klarheit in dieser Sache. Für Iryna lautet die drängendste Frage, ob ihre Tochter ohne notariell beglaubigte Erlaubnis ihres Ex-Mannes (zu dem Iryna kein gutes Verhältnis hat) zu ihren Eltern in die Oblast Sumy ausreisen kann. Diese hatten ihre Enkeltochter eine Zeitlang in ihrer Obhut. Dies wird nun nicht mehr ohne weiteres möglich sein; die Russen haben zwischen der Krim und der Ukraine eine neue Staatsgrenze eingerichtet.
Die Abiturientin und angehende Studienanfängerin Wika macht sich ebenfalls Sorgen, ob sie ohne ihre Eltern in die Oblast Mykolajiw fahren kann, um dort die einheitliche ukrainische Abschlussprüfung abzulegen. Gleiches gilt für die Aufnahmeprüfungen in Kyjiw. Falls sie als Minderjährige eine Ausreisebewilligung benötigt – nach welchem Recht werden diese erteilt? Hinzu kommt, dass die Notarkammern nicht mehr arbeiten beziehungsweise noch nicht wieder ihre Arbeit aufgenommen haben.
„Ich habe keine Ahnung, wie ich verhindern kann, dass sie mich aus dem Zug werfen. Und mit der ganzen Familie zu fahren ist zu teuer. Selbst wenn meine Eltern mich nach Kyjiw bringen, können sie sich einen längeren Aufenthalt dort nicht leisten. Es gibt insgesamt drei Aufnahmeprüfungen, zwischen denen vier bis fünf Tage liegen. Ich könnte auch alleine bei Verwandten unterkommen, dann müssten Mama und Papa sich ein Zimmer in einem Hotel mieten. Aber die haben hier schon genug Probleme mit Eigentum und Immobilien.“
Wika wird die Schule bald beenden. Sie ist schon einmal nach Mykolajiw gefahren, um sich dort für die Abschlussprüfung anzumelden. Sie war auch beim Tag der offenen Tür in einer der Hochschulen in Kyjiw. Gerüchte über organisierte Reisen für Schüler von der Krim zu den Abschlussprüfungen auf dem Festland haben sich nicht bewahrheitet. Jede Familie muss jetzt selbst entscheiden, was zu tun ist. Wika möchte sich für den Studiengang Softwareentwicklung an der Fakultät für Informatik und Informationstechnologie bewerben: „Es werden keine Zugtickets mehr im Voraus verkauft, daher habe ich keine Ahnung, wie ich nach Kyjiw kommen soll. Das letzte Mal wurde der Zug für drei Stunden in Dschankoj aufgehalten.“ Wika rief in der Hauptstadt an, doch sie konnte nicht in Erfahrung bringen, ob es möglich sei, die Unterlagen per Post an die Hochschule zu senden. Einige Klassenkameraden versuchten es auf diesem Weg, aber die Unterlagen für die Anmeldung zur einheitlichen Abschlussprüfung steckten für zwei, drei Wochen in Simferopol fest und kamen schließlich zu spät an. Die Hälfte von Wikas Klassenkameraden will an ukrainischen Hochschulen studieren – vorwiegend jene, deren Eltern vom ukrainischen Festland stammen, auf der Krim gedient haben und nun nach Hause zurückgekehrt sind. Und auch wenn die Militärangehörigen fortgezogen sind – ihre Kinder sind geblieben, um hier die Schule zu beenden. Krimbewohner, die es ablehnen, die Halbinsel zu verlassen, haben Angst, ihre Kinder alleine auf das Festland zu schicken.
Im Park treffen wir einen pensionierten Oberst der ukrainischen Marine. Er muss vorsichtig sein, da er während der Annexion seinen Kameraden geholfen hat. Nach anderthalb Monaten haften die Erinnerungen zwar noch frisch im Gedächtnis, aber die Erregungskurve hat sich gelegt. Den Oberst treiben jetzt stärker die Ereignisse im Donbas um – und die Frage, was man von den Erfahrungen auf der Krim lernen könne: „Die Situation in den Oblasten Donezk und Luhansk ähnelt in vielen Aspekten unserer eigenen. Auch in Sewastopol wurden Forderungen nach der Wahl eines Volksbürgermeisters laut. In der Zwischenzeit wurde die ukrainische Flagge durch die russische ersetzt. Die Strafverfolgungsbehörden und die Armee sind demoralisiert. Diesen Umstand macht sich das russische Militär zunutze und entsendet Selbstverteidigungseinheiten.“
Mein Gesprächspartner ist in mehreren proukrainischen Organisationen aktiv. Die jüngeren Mitglieder sahen sich gezwungen, die Krim zu verlassen: „Vizeadmiral Sergej Menjajlo, den sie aus Moskau entsandt haben, um als Gouverneur von Sewastopol zu dienen, hat gesagt, man müsse den ukrainischen Geist auf der Krim ausrotten. Das Denkmal für den Hetman Sahaidatschnyj2 wurde bereits gestürzt, eine Steintafel zum Gedenken an den zehnten Jahrestag der ukrainischen Marine hat man entfernt, obwohl selbst in den Internetforen aus Sewastopol zu lesen ist, dass es angesichts steigender Preise wichtigere Dinge gebe.“
Akribisch führt er eine Fülle an Details und Fakten an, so als würde er ein Referat halten: „Auch die Umweltaktivisten halten sich bedeckt. Stattdessen kommen russische Geschäftsmänner hierher und kaufen Immobilien auf, solange hier noch Unklarheit herrscht. Übrigens wollen viele Leute nur der Immobilien wegen einen russischen Pass. Das ist die Krim! Die Menschen haben ihr ganzes Leben lang geschuftet, um sich eine Wohnung leisten zu können. Die Rentner setzen ihre Hoffnung auf russische Rentenzahlungen, dabei war das Business früher eng mit dem ukrainischen Festland verflochten. Die Reisebüros sind noch nicht umgezogen. Viele von ihnen haben in den vergangenen Jahren mit ausländischen Touristen ein gutes Geschäft gemacht. Doch jetzt kommen keine Kreuzfahrtschiffe mehr hierher.“
Mein Gesprächspartner hat einen Verzichtsantrag gegen einen russischen Pass eingereicht und stattdessen eine Aufenthaltserlaubnis beantragt. Hierfür wurden den Menschen rund drei Monate eingeräumt. Seine Wartenummer liegt irgendwo im vierstelligen Bereich. Er sagt, dass sich vor dem Einwohnermeldeamt eine lange Warteschlange gebildet hätte. Nicht alle hätten es geschafft, den Antrag rechtzeitig auszufüllen und einzureichen. Nun zerbricht er sich den Kopf darüber, wie er unter der Besatzung leben und seine Interessen auch mit einem ukrainischen Pass wahren kann: „Die Ukraine muss sich ihre Staatlichkeit bewahren, damit sie nicht dasselbe Schicksal ereilt wie uns auf der Krim. Die Leute müssen begreifen, dass sie nicht irgendwelche Bürokraten beschützen, sondern eine Lebensart, ebenso wie die Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Es ist besser, in einer Demokratie zu leben, in einer freien Gesellschaft, in der offen diskutiert werden kann und die Machthaber sich vor den Bürgern der Ukraine verantworten müssen, dann herrschen Ruhe und Frieden auf unseren Straßen. Der Maidan hat uns die Möglichkeit dazu gegeben, aber Putin hat den Umstand ausgenutzt, dass das Janukowytsch-Regime gestürzt wurde und die Bürger sich nicht schnell genug organisieren und den Staat verteidigen konnten. Wir erleben einen historischen Augenblick: die ukrainischen Bürger bilden das Fundament der Gegenwehr – der Staat, das sind sie selbst.“
In Sewastopol komme ich bei Switlana, der Lehrerin für ukrainische Sprache und Literatur, unter. Ihr Mann leitet noch immer einen Marinechor – allerdings spielt das gesamte Ensemble nun unter russischer Flagge. Er prahle damit, wie schnell die Gruppe ihr Repertoire angepasst, russische Lieder einstudiert und russische Kostüme – samt Hoftracht und den Kokoschniki, der traditionellen, haubenförmigen Kopfbedeckung russischer Frauen – aufgetrieben habe. Die Frau teilt die Ansichten ihres Mannes nicht und missbilligt sein Handeln. Die Beziehung ist äußerst angespannt. Aber sie haben eine Tochter und ein gemeinsames Haus.
Mit großem Eifer hilft mir Switlana bei der Suche nach Gesprächspartnern mit unterschiedlichen Problemen und Ansichten. Ich habe den Eindruck, dass meine Anwesenheit sie zumindest ein wenig vom Familienzwist ablenkt. Sie ruft Freunde und Bekannte an und lädt sie zu sich nach Hause ein – tagsüber, während ihr Mann auf Arbeit ist.
Zu einigen Gesprächspartnern muss ich in andere Randgebiete der Stadt fahren. Man spürt sofort, dass die rechtlichen Streitereien durch die prekäre finanzielle Situation zu großen Problemen angewachsen sind. Alle sind auf ihre Gehälter angewiesen, keiner kann es sich leisten, seine Wohnung zu verlassen. Jede Kopeke wird umgedreht. Staatsangestellte werden in Rubel entlohnt, aber die Geschäfte akzeptieren nur Hrywnja. Obwohl die Kurse schlecht stehen, bilden die Leute lange Warteschlangen vor den 
Wechselstuben. Eine Fahrt mit der Marschrutka kostet zweieinhalb Hrywnja respektive zehn Rubel – dabei sollten es laut Wechselkurs 7,75 Rubel sein. Die Preise werden einfach aufgerundet.
Switlana hat offensichtlich viele Lehrer mit demselben fachlichen Hintergrund in ihrem Bekanntenkreis. Ihre Arbeitskollegin heißt ebenfalls Switlana und unterrichtet Ukrainisch an einer der angesehensten Schulen Sewastopols. Sie lebt seit 36 Jahren hier. Der Ehemann ihrer ältesten Tochter dient in der ukrainischen Armee. Das Schuljahr ließ man sie ohne besondere Einschränkungen zu Ende bringen, doch die Prüfungen wurden abgesagt.
„Vor dem ‚Referendum‘ wurde in sämtlichen Schulen Sewastopols ein dringendes Elterntreffen einberufen und angekündigt, dass es nach der Abstimmung drei Amtssprachen auf der Krim geben werde: Russisch, Ukrainisch und Tatarisch. Russisch und Ukrainisch würden gleichberechtigt in den Schulen unterrichtet, keine Sprache würde dominieren, und sämtliche Lehrkräfte für Ukrainisch würden ihre Stellen behalten. Doch schon zwei Wochen später wurde die Anzahl der für den Ukrainischunterricht vorgesehenen Stunden drastisch reduziert. Ursprünglich waren es vier Unterrichtsstunden, jetzt ist es noch eine. Das bedeutet, dass zwei Drittel der Pädagogen nicht mehr benötigt werden“, erläutert die Lehrerin. Derzeit erwartet die Schule eine Delegation aus Moskau, die die Computer- und Russischkenntnisse sowie die jeweiligen Fachkenntnisse prüfen wird.
„Sie leben und arbeiten hier seit 36 Jahren als Ukrainischlehrerin. Bei einigen Anlässen haben sich die Leute bei mir beschwert, dass sie zur ukrainischen Sprache genötigt worden seien; sie konnten die Rezepte ihrer eigenen Medikamente nicht lesen. Ist sowas vorgekommen? War die Sprache wirklich ein Problem?“
„Es gab und gibt diese Ablehnung der ukrainischen Sprache. Man trifft sie schätzungsweise bei der Hälfte aller Einwohner der Krim an. Am deutlichsten macht sich das bei den Rezepten bemerkbar. Diese werden üblicherweise von betagten Damen und Herren gelesen, die nie Ukrainisch gelernt haben. Es gab viel Gegenwehr. So gut wie jedes Großmütterchen, das irgendwelche Straßenanzeigen studiert hat, wollte von dir wissen, was dort feilgeboten wird. Einige taten dies auf freundliche Art und Weise. Aber die Situation begann sich zu verändern, als das Ansehen der ukrainischen Sprache wuchs. Ich erinnere mich an die problematische Zeit zwischen 1997 und 2000. Damals hatte ich einen Schüler, der den Umschlag seines Schulheftes für die ukrainische Sprache mit ‚Notizheft für Russisch‘ beschriftet hatte. Und als wir ein Diktat übten, übersetzte er den Text beim Schreiben ins Russische. Hinterher erzählte mir die Mutter des Schülers unter Tränen, dass der Vater dem Kind nicht erlaube, Ukrainisch zu lernen, und alle Hefte zerrissen habe. So war die Ausgangslage, aber in den letzten Jahren ist die Freude der Kinder am Lernen gewachsen. Wann immer ich ihnen einen Aufsatz zu lesen gebe, suche ich die mitreißendsten Stellen für sie heraus. Anschließend kommen die Eltern und wollen wissen, wie ich das anstelle. Die Kinder stürmen nach Hause und wollen sofort wissen, wie es weitergeht. Wir haben auch innovative Lehrmethoden eingeführt. Darüber hinaus haben wir in den höheren Klassen die Anzahl der Stunden für den Grammatikunterricht verdoppelt, da diese in beiden Sprachen gleich ist. Wir haben sehr kollegial mit russischen Philologen zusammengearbeitet. Unser Schulleiter etwa, ein Russischlehrer, hat versucht, die Lehrpläne anzugleichen – so wird ein Thema bei uns auf Ukrainisch und auf Russisch behandelt.“
Aus Switlanas Abschlussklasse haben neun Schüler ein Studium in Kyjiw aufgenommen, zwei in Kharkiw, und eine in Odessa. Eine ehemalige Schulkameradin, die gebürtig aus Sewastopol stammt, ging als Freiwillige auf den Maidan. Switlana weiß lediglich von zwei Schülern, die eine russische Hochschule besuchen möchten. Ihnen wurde versprochen, dass sie dies problemlos tun könnten, aber es stellte sich heraus, dass sie Aufnahmeprüfungen bestehen müssen. Eine andere ehemalige Schülerin, die bereits studiert, hat erzählt, dass man ihnen vor dem Referendum einen kostenlosen Zugang zu den Universitäten und Hochschulinstituten auf der Krim versprochen habe. Darauf hätten viele gesetzt. Aber die Hoffnungen seien enttäuscht worden.
Weder Verbitterung noch Überraschung sprechen aus Switlanas Stimme. Switlana wusste, dass es so kommt. Sie kritisiert das gesellschaftliche Klima: „Früher habe ich mich mit den Kollegen im Bus entspannt auf Ukrainisch unterhalten – jetzt stoßen die Ukraine und alles Ukrainische ringsum auf Ablehnung. Es ist, als würden sie künstlich Bedingungen dafür schaffen, dass die Menschen die Ukrainer hassen können.“ Dass die Ukraine einigen Einwohnern Sewastopols Fremd ist, erklärt sie damit, dass viele russischstämmige Militärangehörige, die aus Russland versetzt werden, sich in der Heldenstadt aufhalten: „Sie haben in uns keine ukrainischen Frauen, Mütter und Schwestern gesehen, die geweint haben, als sie die ukrainischen Stützpunkte eroberten. Stattdessen haben sie gefeiert. Meine Tochter hat alle ihre Freunde verloren, denn als sie ihnen ihr Leid klagte, entgegneten sie ihr: ‚Bist du blöd? Dein Mann soll in eine russische Einheit wechseln und fertig!‘“
Julia ist ebenfalls Ukrainischlehrerin. Sie wurde in Sewastopol geboren. Im Gegensatz zu der älteren und umsichtigen Switlana gesteht sie bekümmert ein, dass sie Angst habe, Ukrainisch zu sprechen: „Wie sich herausgestellt hat, sind die Ukrainer für die Menschen auf der Krim nichts weiter als Faschisten und glühende Bandera-Anhänger. Und deshalb können sie nicht freundlich und klug sein – ebenso wenig wie die ukrainische Sprache. In den späten Neunzigern und frühen nuller Jahren hatte ich ebenfalls Angst, Ukrainisch auf der Straße zu sprechen, aber bald darauf spielte es schon keine Rolle mehr. So viele Urlauber aus der Ukraine kamen hierher! Jedes Kind hatte einen anderen Zugang zur Sprache: die einen gewissenhaft, andere weniger. Doch sie alle begegneten der Sprache mit Respekt. Es fällt schwer, hier zu leben, wenn du dich nicht zuhause fühlst. Ich fühle mich wie eine überflüssige Person. Ich habe auf die russische Staatsbürgerschaft verzichtet und muss nun um eine Aufenthaltserlaubnis für den Ort betteln, an dem ich mein ganzes Leben verbracht habe, an dem ich in den Kindergarten und in die Schule gegangen bin und wo ich jeden Pflasterstein kenne. Und ich muss darum bitten, dass ich hier leben darf? Und bin von ihrer Gnade abhängig? Alle meine Freunde leben hier. Es ist eine Sache, freiwillig zu gehen. Doch es ist etwas anderes, die eigene Wohnung verlassen zu müssen. Dabei geht´s mir ja nicht mal um die Wohnung! Mein ganzes Leben spielt sich hier ab! Ich müsste meine Seele zurücklassen! Meine Mutter und mein Bruder liegen hier begraben.“
„Julia, wenn Sie die ukrainische Sprache nicht unterrichten können, was können Sie tun? Was bleibt Ihnen übrig?“
„Im Grunde gar nichts.“
„Und was bieten die Ihnen stattdessen an?“
„Nichts. Was sollen die mir schon groß anbieten!?“
„Schokolade! Alles wird in Schokolade getaucht sein. Ein neues Leben auf einem unbeschriebenen Blatt. Kein Flickwerk – ein Neubeginn“, rezitiert eine weitere Freundin von Switlana, Olena, mit erhabener Stimme. Switlana liegt viel daran, dass ich mit diesen „ganz normalen Leuten“, die sich über die Annexion freuen, ins Gespräch komme, um zu begreifen, in welchem sozialen Umfeld sich ihr Leben jetzt abspielt.
Olena ist passionierte Christin und sehr besorgt, dass sich westliche Werte auch auf der Krim ausbreiten werden. Sie versucht uns davon zu überzeugen, dass sie gesehen haben will, wie die gleich neben ihrer Wohnung gelegene Industrieanlage Parus3 wieder in Betrieb genommen wird: „Die Werft von Sewastopol4 nimmt die Arbeit ebenfalls wieder auf. Das bedeutet Arbeitsplätze! Bei der Arbeitsbehörde wurde mir gesagt: holt eure Ingenieursdiplome hervor, alle Fachgebiete werden benötigt. Es soll eine staatliche Anordnung für die Fachausbildung in verschiedenen technischen Berufen geben. Für die jungen Leute ist das ein Geschenk des Himmels. Die Rentner freuen sich sowieso schon – ihre Rente ist um 25 Prozent gestiegen. In den Krankenhäusern, besonders den onkologischen Zentren, werden neue Gerätschaften herangeschafft. In den Lokalnachrichten haben sie gezeigt, wie der Transporter entladen wurde.“
Von Zeit zu Zeit unterbreche ich Olena, um herauszufinden, ob sie alles, was sie erzählt, mit eigenen Augen gesehen, in den Medien gehört oder gerüchtehalber aufgeschnappt hat.
„Die Menschen sind auferstanden. Das Volk hing am Kreuz, es war gekreuzigt, und nun ist es auferstanden! In den Seelen aller leuchtet der Satz: ‚Wir sind auferstanden!‘ Es ist einfach beschämend, dass wir die vergangenen 23 Jahre eine so kümmerliche Existenz gefristet haben – und selbst das hatten wir nur den Besuchern aus Russland zu verdanken. Auch jetzt wird es keine Probleme mit russischen Touristen geben. Das sind die Russen der Krim schuldig, sie müssen jetzt hierherkommen. Auch die Großbetriebe werden es gut haben: Man hat uns versprochen, dass die gesamte Krim und Sewastopol fünf Jahre lang keine Steuern zahlen müssen, mit Ausnahme der Privatunternehmer. Immerhin haben sie schon so viel durchgemacht – bei Gott, das wünsche ich niemandem.“

Vor allem jedoch hofft Olena, dass in den Schulen Unterricht für religiös-traditionelle Werte eingeführt wird: „Den Taxifahrern werden Verkehrsregeln beigebracht, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie über eine rote Ampel fahren. Der Jugend dagegen sind die Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst – etwa, wenn sie eine Abtreibung vornehmen lassen. Abtreibung ist nämlich Mord. Man muss die orthodoxe Kirche unterstützen.“
„Man erzählt sich, dass hier bald eine Vergnügungsmeile entstehen soll“ – darüber wird wirklich viel geredet –, „mit Spielkasinos aller Art. Sind Sie als Gläubige alarmiert?“
„Ich habe davon gehört. Damit können wir uns nicht gerade rühmen. Aber alles hängt davon ab, wie man es aufzieht. Selbst wenn man alle Triebe unterdrückt, sind sie immer noch im Unterbewusstsein präsent. Daher ist es besser, den Tatsachen ins Auge zu blicken, sie zu legalisieren, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen und damit Profit zu machen.“
Gegenüber mir, einer Person aus Kyjiw, betont Olena mit Nachdruck, dass es der Maidan war, der das politische Bewusstsein der Krimbewohner geschärft habe: „Wir haben den Maidan gesehen, wir haben gelernt und begriffen, dass wir die Machthaber kontrollieren müssen. Die ‚Sewastopoler ohne Aufenthaltsgenehmigung‘ etwa sind mit der Forderung auf die Straße gegangen, dass man sie anhören und ihnen russische Pässe aushändigen möge. Ich denke, dass die Abgeordneten dies berücksichtigen und ein entsprechendes Gesetz verabschieden werden.“
„Und früher haben Sie keinen Unterschied gemacht zwischen Russen und Ukrainern?“
„Das spielt auch jetzt keine Rolle. Jetzt sind alle glücklich. Man möchte einen Ukrainer liebkosen – sogar einen Schwarzen, ganz gleich. Wir sind einfach glücklich. Wir hätten uns nicht träumen lassen, dass wir wieder zu Russland zurückkehren. Sollen doch die Preise steigen für Waren und Dienstleistungen, die früher aus der Ukraine kamen. Das ist eine Übergangsphase. Die Rente soll verdoppelt werden. Mein Vater hat seine Rente schon in russische Rubel umgetauscht. Gott hat uns geholfen. Nach 23 Jahren sind unsere Gebete erhört worden. Wir hingen am Kreuz – und nun sind wir auferstanden!“
Olha Wasyliwna stammt gebürtig von der Krim und lebt und arbeitet schon lange in Moskau. Nun ist sie in aller Eile auf die Krim zurückgekehrt, um ihre Tochter zu retten. Oksana Hrytsenkowa hat sieben Jahre lang eine Drogenersatztherapie gemacht. Dabei wird Rauschgiftabhängigen unter ärztlicher Aufsicht der Ersatzstoff Methadon verabreicht. Nun soll das Substitutionszentrum, dessen Patientin Oksana war, geschlossen werden. Im Gegensatz zur Ukraine und den EU-Staaten ist diese Form der Therapie in Russland verboten. Und obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO die Drogenersatztherapie als „eines der wirksamsten Verfahren gegen Opioid-Abhängigkeit“ einstuft, beharrt Wiktor Iwanow, Direktor der (2016 aufgelösten) russischen Bundesbehörde zur Betäubungsmittelkontrolle darauf, dass diese Therapie keinen „etablierten klinischen Standards“ entspreche.
Bis zum Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges waren in den landesweit insgesamt 170 Einrichtungen rund 8.700 Patienten in Behandlung. Dies war ein großer Triumph für den gesamten postsowjetischen Raum – und das Programm auf der Krim eines der erfolgreichsten in der Ukraine. Auf der Krim waren bis zur Annexion 800 Patienten in Behandlung – darunter 200, die positiv auf HIV getestet wurden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.