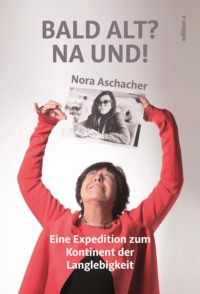Kitabı oku: «Bald alt? Na und!», sayfa 3
Arbeitszeit ist Lebenszeit
An der Arbeitswelt zeigt sich die Ambivalenz der Gesellschaft gegenüber uns Älteren besonders deutlich. Wir über 50-Jährige gelten als zu teuer und nicht lernfähig.
Zugegeben, es gibt vereinzelte Betriebe, deren Leitung erkannt hat, dass es wirtschaftlich ganz einfach dumm ist, die Erfahrung von älteren Führungskräften und Fachleuten zu verlieren. Sie bieten pensionierten Mitarbeitern eine zweite Karriere als Senior-Experten gegen ein Beratungshonorar an. Aber warum nur so wenige?
Ja, Organisationen wie ASEP, Austrian Senior Expert Pool, wurden gegründet, damit Ältere Wissen und Erfahrungen an jüngere UnternehmerInnen weitergeben, diese beraten und coachen im Sinne von Generativität, das heißt an die kommenden Generationen denken und etwas „zurückzahlen.“ Aber warum bilden sich Initiativen dieser Art nur für Projekte in Industrie, Wirtschaft und öffentlichem Dienst?
Warum gibt es ein Johann-Gottfried-Herder-Programm nur für emeritierte WissenschafterInnen, die bei einer Gastprofessur im Ausland sogar Partnerin oder Partner mitnehmen können, und nicht etwas Ähnliches für andere Berufsgruppen? Zugegeben, es existieren vereinzelte Unternehmen mit Weiterbildungsund Gesundheitsprogrammen für ältere Arbeitnehmer, weil man Expertenwissen nicht vorzeitig – durch Frühpension oder innere Kündigung – verlieren möchte. Aber warum nur so wenige?
Zugegeben, es finden sich Personalfachleute und Führungskräfte, die bewusst auf die Erfahrung und das Können von uns Älteren setzen und nicht weiterhin an tranigen Vorurteilen festhalten wie abnehmende Belastbarkeit im Alter, höhere Krankheitsanfälligkeit, Skepsis vor Neuem. Aber warum nur so wenige?
Ja es gibt sogar Betriebe, die vorwiegend Ältere beschäftigen. Viele sind es nicht. Als Paradefall gilt die bekannte Firma „Vita Needle“ in Boston, USA. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 70,80,90 Jahre alt, denn es gehört zur Firmenpolitik, die Präzisionsnadeln für Industrie und medizinische Anwendungen von Älteren fertigen und verpacken zu lassen.
Die Zusammenarbeit begann in den späten Achtzigern, als das Familienunternehmen Schwierigkeiten hatte, Arbeitnehmer zu finden, also probierte es die Firmenleitung mit Älteren. Diese suchten einen Nebenverdienst oder wollten der häuslichen Langeweile entkommen. Inzwischen läuft die Zusammenarbeit zur beiderseitigen vollsten Zufriedenheit. Die Vita Needle-Mitarbeiter kommen gerne, sind hoch motiviert, haben freie Wahl bei Arbeitszeit und Arbeitsstunden, und Chef Frederik Hartmann erfreut sich an einem Umsatzplus von hundert Prozent in fünf Jahren.
Auch „Veterankraft“ hat seit seiner Gründung 2010 seine Umsätze angeblich verzehnfacht. Das schwedische Unternehmen vermittelt Gelegenheitsjobs für Pensionistinnen und Pensionisten, die sich eine freiwillige Rückkehr aus der Pension in eine Arbeit wünschen, nicht nur weil die Pension zu niedrig ist, sondern weil die Leute „irgendetwas tun wollen und Lust auf Abwechslung haben“ wird Firmengründer Tomas Eriksson im Oktober 2013 in der Berliner Zeitung zitiert: „Das sind Leute, die ein langes Berufsleben hinter sich haben, und dann kommen sie nach Hause, und niemand ruft sie mehr an.“ Der Wunsch, etwas zu tun, tritt bei den meisten drei bis vier Jahre nach der Pensionierung auf, hat man bei Veterankraft beobachtet.
Dies soll kein Plädoyer sein, so lange arbeiten zu müssen bis wir halbtot vom Bürosessel, der Werkbank oder vom Montageband fallen, aber eine Anregung, unsere Vorstellungen vom Leben und der Arbeit grundsätzlich zu überdenken. Dazu gehört die Dualität Arbeit und Freizeit. Arbeit ist grundsätzlich Hölle, Freizeit ist grundsätzlich Paradies. Das Leben besteht daraus, ab Montag zu warten, dass das Wochenende kommt, das Jahr über auf den Urlaub zu hoffen und die Zeit der Pensionierung herbeizuflehen. Keine Frage, dass es genügend langweilige, anstrengende, uninteressante und noch dazu schlecht bezahlte Jobs gibt, die nicht viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten bieten, als auf ein Leben nach der Arbeit zu warten. Großer Zeitdruck, Überbeanspruchung, schwere Lasten, Lärm, Staub, Hitze, Kälte, Unfallgefahren, das alles sind Faktoren am Arbeitsplatz, die krank machen und verständlicherweise dazu beitragen, dass der Job als Last und die Freizeit als Lust empfunden wird. Aber müssen wir darin Orientierungspunkte für die Zukunft sehen? Ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe, die Mitarbeiter nicht wie Zitronen auspressen, wurden bereits konzipiert und vereinzelt realisiert. Internationale Studien belegen, dass 60 Prozent der Befragten angeben, sie würden in der Firmenhierarchie eine Stufe hinuntersteigen, um etwas Sinnvolles zu machen. Status, Ansehen, Karriere sind nicht mehr die Lockmittel, jetzt muss die Work-Life-Balance passen und der Job soll mit den Fähigkeiten und Interessen übereinstimmen.
Gut so, aber reicht diese Einstellung für die Zukunft? Ist nicht zusätzlich ein genereller Aufstand gegen die verordnete Zeitdisziplin angesagt? Sollten wir nicht endlich das herkömmliche 3-Phasen-Modell Ausbildung-Arbeit-Ruhestand grundsätzlich hinterfragen, das in seiner Rigidität überholt ist? Die nachfolgenden Generationen werden es uns danken, wenn ihre Arbeitsbiographien nicht mehr so eintönig verlaufen wie die von uns jetzigen Älteren. Warum nicht mehr Zwischenräume, die wir zum Lernen, zum Nachdenken, zum Erholen nutzen, um danach wieder in denselben oder einen anderen Job hineinzugehen, allerdings mit jederzeit möglichem Einblick in unser Pensionskonto? Was die nach uns Kommenden brauchen, sind mehr Sabbaticals, mehr Experimente mit Zeitausgleich und Zeitguthaben, Modelle von Bildungsurlauben und sonstigen Auszeiten, die auch für jene realisierbar sind, die ihre Sozialversicherungsbeiträge nicht ein Jahr lang vom Sparkonto abbuchen können. Wir brauchen mehr Freiräume, ohne dass deswegen das System der sozialen Sicherheit, die große Errungenschaft des Sozialstaates, in Frage gestellt wird. Es muss doch möglich sein, dass jemand, der länger arbeiten will und kann, auch nach dem gesetzlich verordneten Pensionsalter in seinem oder einem anderen Job aktiv bleibt. Genauso muss es möglich sein, dass Menschen mit einem harten, körperlich fordernden Job einige Zeit früher gehen, ohne mit finanziellem Verlust bestraft zu werden. Warum entwerfen wir nicht Modelle eines flexiblen Pensionsantrittsalters, nicht in Form einer Jahreszahl, sondern in Form von Zeitspannen und Zeitwertkonten? Warum nicht den Renteneintritt als schrittweisen Prozess gestalten? Worauf warten wir?
Vor Kurzem traf ich einen alten Freund wieder, und im Verlauf unseres Gespräches sagte Rudolf, 76, den bemerkenswerten Satz: „Für mich ist Arbeitszeit Lebenszeit, ist Teil meines Seins als Künstler, als Mensch.“ Rudolf, der, wie es im Ausstellungskatalog heißt „sein ganzes Leben der Kunst gewidmet hat“, denkt nicht ans Aufhören, im Gegenteil, die Arbeit an seinen Materialbildern, an Siebdruck, Malerei und Objekt-Kunst wird für ihn immer intensiver und befriedigender.
Arbeitszeit ist Lebenszeit, und Lebenszeit ist Arbeitszeit im Sinne einer frei gewählten, selbstbestimmten, sinnstiftenden Tätigkeit – wäre das nicht eine wunderbare Vision für die kommenden Generationen?
Wohnen wie im Paradies
Kulturwandel ist angesagt, nicht nur in der Arbeit, sondern auch beim Wohnen. Wir Oldies, vor allem diejenigen unter uns, die alleinstehend sind, erproben gerade Alternativen des Wohnens, abseits des Daseins im Eigenappartement oder der Anmeldung im Pensionistenheim. Wir schließen uns zu Senioren-WGs zusammen, testen betreute Wohngemeinschaften sowie das Leben in Mehrgenerationenhäusern und beleben die Idee der Beginenhöfe wieder, wie in Bielefeld, wo Frauen zwischen 40 und 80 in ihren eigenen Wohnungen aber unter einem Dach leben. Die Beginen waren unabhängige, selbstständige Frauen im Mittelalter, die weder heiraten noch in ein Kloster eintreten wollten, sich aber karitativ engagierten.
Das französische Wohnprojekt „La Maison des Babayaga“ setzt ebenfalls auf die Selbstbestimmung älterer Frauen. Baba bedeutet in den meisten slawischen Sprachen alte Frau. Die Baba-Jaga ist angesiedelt zwischen Hexe, Muttergöttin, Heilerin mit Zauberkräften, Waldfrau. Das Altersheim „La Maison des Babayaga“ ist ein politisches Projekt, das auf vier Prinzipien beruht: Solidarität, Selbstverwaltung, Bügerinnenschaft, Ökologie. Die Idee dazu hatte Thérèse Clerc, eine der bekanntesten Feministinnen Frankreichs. 1995 entstand die „realistische Utopie“, ein Haus mit 25 Wohnungen für freie, engagierte, unabhängige alternde Frauen zu errichten, die Thérèse Clerc mit ein paar Freundinnen weiterentwickelte. Eine Art Gegenmodell zu herkömmlichen Pensionistenheimen, die von der Mehrheit der älteren Menschen in Frankreich abgelehnt werden. Im Alter von 65 leben 77 Prozent aller Frauen alleine, während 75 Prozent der gleichaltrigen Männer eine Partnerschaft haben. 2007 sollte in der Rue de la Convention in Montreuil, Seine-Saint Denis, der erste Spatenstich passieren, aber dann wurden versprochene Gelder zurückgezogen, weil dieses Haus „nur“ für Frauen konzipiert war, obwohl das Erdgeschoß Männern und Frauen für Kunst, Versammlungen, Diskussionen, Empfänge, Feste offen steht. Es ist sogar eine Universität für Ältere angedacht. „La Maison des Babayaga“ befindet sich nicht in abgeschiedener Naturlandschaft, sondern im Stadtzentrum, umgeben von U-Bahn, Geschäften, Kinos. Es wurde 2013 eröffnet.
„Es war ein langer, schwieriger Weg“, konstatiert Thérèse Clerc. Inzwischen sind andere französische Städte an dem Projekt interessiert, denn immerhin ist bereits heute ein Viertel der französischen Bevölkerung, ca. 17 Millionen, über 60, und bis 2050 werden die Über-60-Jährigen ein Drittel ausmachen.
„Paradies für Großeltern“ wird „Trabensol“ bei Madrid, Spanien, genannt, das im Sommer 2014 seinen ersten Geburtstag feierte. Es begann 2002. Eine Gruppe sozial aktiver Menschen erkannte, dass sie älter wurden und für diesen Lebensabschnitt einen Plan entwickeln sollten. Nach langen Diskussionen stand fest, sie bilden eine Kooperative und bauen ein Gemeindezentrum für ältere Menschen, das von diesen selbst verwaltet wird. Als erster Schritt wurde der passende Ort gesucht. Das war zur Zeit des Immobilienbooms in Spanien mit den hochgeputschten Grundstückspreisen nicht leicht. Dann stieß die Gruppe auf den Bürgermeister von Torremocha Jarama, einer kleinen Stadt nördlich von Madrid mit über 40 Handwerksunternehmen. Am Fuße des Berges entstanden Wohnungen für 54 Bewohnerinnen und Bewohner, Gemeinschaftsräume für Reiki, Akupunktur, Musik, Malerei, Videobearbeitung, ein „religiöser“ Raum für alle, um zu beten, zu meditieren oder Yoga zu praktizieren, ein 10.000 Quadratmeter großer Garten und ruhige Innenhöfe. Als Energiequelle wird in Trabensol Geothermie verwendet. Die Philosophie von Trabensol, eine Abkürzung von Arbeitersolidaritätsvereinigung, beruht auf der Ansicht, dass reiche, warme, positive Beziehungen das Leben ausmachen. Die Grundprinzipien heißen Solidarität, gegenseitige Hilfe, Koexistenz, Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit, befriedigendes Leben, spätere Pflege.
Trabensol, Babayaga oder das Wohnprojekt „OLGA“ – Oldies Leben Gemeinsam Aktiv – in Nürnberg, sind interessante, visionär angelegte Ideen für neue Wohnformen im Alter. Aber oft führen auch kleine Schritte zu großen Veränderungen.
Was tun, wenn die Wohnung, das Haus zu groß geworden ist? Zum Beispiel in eine kleinere Gemeindewohnung übersiedeln, wie es die „Aktion 65Plus“ der Gemeinde Wien ermöglicht. Oder wir versuchen intergenerationelles Zusammenleben wie Linxin und Colette. Colette ist 91 und verfügt über eine geräumige Wohnung im Quartier Latin in Paris, in der sie alleine lebt. Linxin ist 24, kommt aus China und studiert in Paris. Als Student eine preiswerte Wohnung zu finden, ist in Paris genauso schwer wie in anderen teuren europäischen Städten. Warum also nicht junge Menschen, die ein Zimmer suchen, und ältere Menschen, die mehr Zimmer haben als sie bewohnen können, zusammenbringen? „Le Logement intergénérationnel“ ist eine von mehreren französischen Organisationen, die sich auf die Vermittlung jung/ alt spezialisiert haben. In der Schweiz und in deutschen Städten gibt es bereits ähnliche Zweck-WGs. Die Studenten wohnen bei Senioren und helfen dafür im Haushalt. Pro Quadratmeter Wohnung ist eine Stunde Hilfe im Monat vorgesehen, dazu kommt noch eine Beteiligung an Heizung, Strom, Wasser.
Oder warum nicht das Modell Zeitvorsorge ausprobieren, damit Ältere, die der Unterstützung bedürfen, weiterhin zu Hause leben können. Diejenigen unter uns, die noch gut beisammen sind, also „die Zeitvorsorgenden“, unterstützen die Hilfsbedürftigen unter uns im Alltag und erhalten dafür Zeiteinheiten auf einem individuellen Konto gutgeschrieben. Diese abgearbeiteten Zeiteinheiten können sie später, bei eigenem Bedarf, gegen entsprechende Leistungen neuer Zeitvorsorgender eintauschen. Das Stadtparlament von St. Gallen, Schweiz, hat der Umsetzung des Zeitvorsorgemodells zugestimmt, die Stiftung Zeitvorsorge soll die jeweiligen Zeitguthaben koordinieren. Ähnliches probiert ein Verein in Oberösterreich auf der Basis des Tauschhandels in den Bereichen Nachbarschaftshilfe, Zeitvorsorge, Wirtschaftsnetz. Wer anderen eine Stunde hilft, also eine Stunde arbeitet, erhält eine Gutschrift von einer Stunde auf seinem Zeitkonto und kann damit wieder eine Stunde Hilfe beziehungsweise Arbeitsleistung beziehen. Vielleicht ist die Kritik nicht unberechtigt, dass in diesem Fall auch Zeit eine Art Währung ist und dass möglicherweise Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe zurückgehen. Andererseits sollten wir Modellen wie diesen zunächst einmal Chancen zum Ausprobieren geben und überlegen, wie sich die Vorteile neuer Ideen mit dem erwiesenen Nutzen von alten Konzepten zu einem sinnvollen Ganzen kombinieren lassen.
Einmischen, Mitreden, Mitgestalten
Kulturwandel ist angesagt, beim Denken und beim Handeln. Gelassenheit liegt im Trend. Das ist gut so, aber ein bisschen Würze in Form von Radikalität kann nicht schaden. Jetzt im Alter können wir endlich denken, sagen und tun, was wir immer schon wollten, bisher aber aus verschiedensten Gründen und Zwängen zurückhalten mussten, heißt es. Ja das stimmt. Wir können sagen, was wir wollen, ohne dass wir im Zeugnis eine schlechte Note bekommen, in der Job-Hierarchie eine Stufe hinunterfallen, die Pension verlieren. Die Frage ist nur, wer hört uns zu? Hört uns überhaupt jemand zu, so wir nicht Margarete Mitscherlich, Andreas Kruse, Jean Améry, Simone de Beauvoir, Reimer Gronemeyer, Bernd Marin heißen?
Radikal zu denken, Visionen zu entwickeln, Ideale verwirklichen zu wollen, das sind Eigenschaften, die die Gesellschaft nicht für uns, sondern für eine andere Altersgruppe vorgesehen hat – die Jungen. An uns wird geschätzt, dass wir ruhig, bescheiden, zufrieden sind. Der gute Oldie sieht mehr Positives als Negatives, strahlt Gelassenheit aus, zieht Ruhe und ein bequemes Leben vor, ist emotional stabil, das heißt, regt sich nicht auf, ist kein Wutbürger. Wirklich? Ist die Gelassenheit eines Goldfisches im Glas bewundernswert oder schlicht und einfach die Anpassung an einen nicht von ihm bestimmten Lebensraum. Vielleicht träumt das Zuchttier von einem verwilderten Leben im Brackwasser. Einige von uns geben sich nicht mit der Ruhe im Glas zufrieden. Stéphane Frédéric Hessel war 93, als sein Essay „Empört euch“ publiziert wurde, in dem er unter anderem zum politischen Widerstand gegen die Finanzkrise aufruft. Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter Jean Ziegler, 70, empört sich seit Jahren über den weltweiten Hunger als Massaker und Massenmord und fordert einen Aufstand des Gewissens, denn das eigene Glück ist nur dann möglich, wenn rundum Gerechtigkeit und Solidarität herrschen. Die Welt nicht hinzunehmen wie sie ist, sich nicht dem destruktiven Gehorsam zu unterwerfen, der zu Untertanengeist, Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit führt, dafür plädiert der 92-jährige Psychologe Arno Gruen in „Wider den Gehorsam“. Alice Schwarzer vertritt als 70-Jährige immer noch vehement feministische Positionen und initiiert eine Kampagne gegen Prostitution. Todesdrohungen und Mordanschläge haben Bischof Erwin Kräutler, 75, bis heute nicht davon abhalten können, sich gegen Großstaudammprojekte und für die Menschen im Amazonasgebiet einzusetzen.
„Verfolgen wir mit Radikalität als alte Menschen nicht auch das Ziel, wenn nicht jetzt, wann sonst wollten wir die Welt verändern?“, fragte die Grande Dame der Psychoanalyse Margarete Mitscherlich, und die deutsche Politikerin Rita Süssmuth wird im Deutschlandfunk vom 30. 11. 2012 mit dem Satz zitiert: „Mein Denken ist heute sehr viel radikaler als mit 30 Jahren. Nicht nur die Jungen haben Ideale und Visionen – wir Älteren denken tiefer darüber nach, was wir verändern möchten, und bleiben an den Zielen dran. Visionen und Ideale verschwinden nicht mit dem Älterwerden, im Gegenteil.“
So ist es. Daher protestierten Rentner in Dublin gegen brutale Sparmaßnahmen der Regierung, standen Weißhaarige in Chile an der Seite jugendlicher Demonstranten für gebührenfreie Schulen und Universitäten, machten Ältere mit bei der Occupy-Bewegung, wandten sich sogenannte Straßenoldies in Spanien gegen Banken und Regierung, formierte sich beim Bahnprojekt Stuttgart 21 ein „Block der Grauhaarigen“.
In Japan demonstrierten ältere Menschen nach Fukushima für ein Ende der Atomkraft, in Argentinien haben die „Großmütter der Plaza de Mayo“, entstanden zur Zeit der Diktatur, die Suche nach den damals verschwundenen und geraubten Enkelkindern bis heute nicht aufgegeben, und in den USA wurde eine 84-jährige Nonne verurteilt, weil sie in Tennessee in die mangelhaft geschützte Atomanlage eindrang und eine Friedensfahne schwenkte. Also Schluss mit der Gelassenheit, der Konzentration ausschließlich auf die Interessen des eigenen Bauches. Schluss damit, die Zeit im Alter mit Trivialitäten und Spielereien zu verplempern. Betty Friedan, berühmte amerikanische Altersforscherin, plädiert für aktives Handeln im Sinne eines Vermächtnisses für die Enkel. Wir mögen die im Laufe des Lebens erworbene Weisheit und Generativität und das Wissen um die Entstehung des Sozialstaates einsetzen, um bei der Lösung der Probleme mitzuhelfen, vor der die Gesellschaft heute steht.
Mitreden und Mitgestalten anstelle von Zuhören und Konsumieren. Würden viele von uns gerne, aber wo bitte wären die Foren, abgesehen von Demonstrationen und der Mitgliedschaft in politischen Parteien? Im Supermarkt, in der Straßenbahn, im Park beim Spielen mit den Enkelkindern? Na ihr könnt doch bürgerschaftliches Engagement zeigen, wird uns gerne empfohlen. Ja, könnten wir, und viele von uns übernehmen Ehrenämter, Freiwilligendienste, zivilgesellschaftliches Engagement oder wie auch immer sich unbezahlte Tätigkeiten nennen, wobei Untersu chungen festgestellt haben, dass das ehrenamtliche Engagement bei den über 60- bis 65-Jährigen eher rückläufig ist. Hat vielleicht schon mal jemand nach den Gründen unserer Zurückhaltung gefragt, abgesehen davon, dass wir keine Zeit haben, weil wir uns bei der Betreuung unserer Enkelkinder oder unserer kranken Lebenspartner engagieren, weil speziell wir Frauen uns ein Leben lang um andere gekümmert haben und wir endlich mal eine Auszeit brauchen oder weil die Angebote, um es höflich auszudrücken, interessanter sein könnten. So wenig wie ich als älterer Demenzkranker von Menschen wie Silvio Berlusconi betreut werden möchte, ebenso wenig Lust habe ich, mit noch Älteren als ich Karten zu spielen, weil mich Kartenspiele grundsätzlich langweilen. Es scheint mir nicht extrem erfüllend, den Kirchenraum zu kehren, Altstoffe zu sammeln, ich will keine Folder an Kooperationsstellen verteilen, Besucherinnen begrüßen und Infoblätter ausgeben. Mein Glücksgefühl beim Adventkranzbasteln für den Weihnachtsmarkt oder Brötchenstreichen für das Sportfest hält sich in Grenzen. Büroarbeit war schon in jüngeren Jahren ein No-Go, und eine Datenbank pflegen, selbst wenn es zum Wohle der Kinder auf der ganzen Welt geschieht, wird von mir auch nicht als Highlight empfunden, für das ich Stunden meiner Lebenszeit hingeben würde. Ich möchte nicht als „kostengünstiges Dienstleistungs- und Wertschöpfungspotenzial“ wahrgenommen werden. Zum einen weil ich mehr kann, als angeboten wird, und zum anderen, weil einige dieser Angebote bezahlt werden sollten, damit junge Leute zu einem Nebenverdienst kommen. Ich will keine Löcher stopfen und Risse kitten, die durch falsche politische Entscheidungen entstanden sind, weil sich der Staat aus der sozialen Verantwortung zurückgezogen hat.
Bei einem Besuch der Wiener Freiwilligenmesse 2014 im Museum für Angewandte Kunst stellte ich fest, der Andrang war enorm und viele Ehrenamtliche sind voll zufrieden mit dem, was sie tun. Allerdings gab es von keiner Organisation eine befriedigende Antwort auf meine Frage, ob es denn speziell konzipierte Projekte für Menschen 60plus gebe, bei denen wir Älteren einerseits unsere Erfahrungen einsetzen und andererseits etwas dazulernen könnten. Aufgefallen ist mir, dass nahezu jede Organisation Menschen sucht, die Kindern, mit oder ohne Migrationshintergrund, Nachhilfe geben. Da frage ich mich doch, gibt es keine allgemeine Schulpflicht mehr und wenn doch, was machen die in den Klassenzimmern? Andererseits weiß ich natürlich, dass zum Beispiel Lernpatenschaften, die Betreuung von Flüchtlingen, das Dasein eines Sport- oder Kulturbuddys befriedigend und sinnvoll sein können.
Trotzdem bleibt ein ABER: eine freiwillige, unbezahlte Tätigkeit, die zwar die Sozial- und Kulturbudgets des Staates entlastet, aber das Können und Wissen von uns Älteren nicht wirklich einfordert, muss nicht automatisch als Bereicherung empfunden werden. Im Gegenteil. Es wäre also hoch an der Zeit, die Rahmenbedingungen für Ehrenamt und Engagement neu zu definieren, denn eine Gesellschaft des langen Lebens braucht utopische Bilder eines solidarischen, nachhaltigen Zusammenlebens. Für mich wird sich das Reformprogramm wohl nicht mehr ausgehen, hält man sich die Trägheit der Institutionen vor Augen, aber dann hoffentlich für die nächste Generation der Alten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.