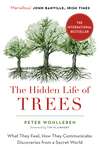Kitabı oku: «Übungen im Fremdsein», sayfa 3
Faszinierende Dekoration
In der Form des Pastiches kehrt der Verne’sche Standpunkt häufig in der Popkultur wieder, zum Beispiel in den Indiana-Jones-Filmen. Hier ist die Welt nur ein exotisches Bühnenbild für die Heldentaten des Protagonisten, deren Struktur an ein Computerspiel denken lassen. Und wie faszinierend die Kultur auch wäre, auf die der Held träfe – er wird sich nicht ändern, wird bis zum Schluss derjenige bleiben, der er im Moment seiner Ankunft war. Eingeschlossen in der dichten Kapsel der westlichen Identität, zeigt er sich wie imprägniert gegen alles Fremde, auch wenn er als Archäologe agiert, der in dieser Hinsicht aufgeschlossen sein sollte. Fixiert auf sein Ziel (den Schatz zu finden, das Geheimnis zu lüften), knüpft er keine engeren Beziehungen zu den Eingeborenen, nimmt keinen kulturellen Dialog auf. In der festen Überzeugung, dass die Menschen ihn verstehen müssten, spricht er Englisch oder Französisch mit ihnen. Er hält an seinen Standards fest, lässt sich auf keine engeren Verhandlungen ein, behandelt alles und jeden von oben herab, seiner zivilisatorischen (und damit seiner menschlichen) Überlegenheit sicher. Wir haben die legendäre Szene vor Augen, in der Indiana Jones von einem Ismailiten zu einem Duell herausgefordert wird. Wir befinden uns auf einem Basar, inmitten der Menge, die beiseitetritt, um den Kämpfenden Platz zu machen. Als der traditionell gekleidete Krieger seinen Säbel wirbeln lässt, um seine Fertigkeiten zu zeigen, zückt Indiana Jones, der es eilig hat, seine Pistole und erschießt ihn. Ende des Duells.
Überrumpelt von dieser Wendung, muss der Zuschauer lachen, auch wenn ihn die eigene Reaktion überrascht. Die Nonchalance, ja Dreistigkeit des Indiana Jones wirkt imponierend, zugleich spricht sie jedem Reflex politischer Korrektheit Hohn.
Im Grunde nimmt der Reisende des Westens die Welt als nicht wirklich wahr. Gleich einem ewig eilenden Schatten bewegt er sich durch die Länder und Kulturen, die er besucht. Nichts berührt er, in nichts ist er einbezogen, er bleibt verkapselt in seinem Überlegenheitsgefühl.
Die unschuldige exotische Welt, in die der westliche Reisende vom Schlage eines Indiana Jones gelangt, geht zumeist am Ende der Geschichte auf dramatische Weise unter. Der Untergang vollzieht sich mit einem Donnerschlag – als sollte diese Welt, wenn das Ziel erreicht, das Geheimnis aufgedeckt ist, ihre Existenzberechtigung verlieren. Der Zuschauer muss einstürzende Pyramiden sehen, zusammenfallende unterirdische Verliese, Vulkanausbrüche und ähnliche apokalyptische Bilder. Hier gilt die alte römische Formel: veni, vidi, vici. Was gesehen und erfahren (benutzt) wurde, ist abgehakt, mit anderen Worten: bezwungen. Und hört damit auf zu existieren.
Exotisch, aber in Maßen
Das Paradigma des Reisenden im 19. Jahrhundert erfuhr seine industrialisierte Vermassung durch den modernen Tourismus. Erbe des Phileas Fogg und des Indiana Jones ist heute der Tourist, der im Reisebus in zwölf Tagen Mexiko durchquert auf einer Tour, die natürlich in Cancún enden muss, dem scheußlichsten Ort, den ich je gesehen habe – monströse Hotelanlagen und abgeteilte Strandabschnitte. Oder er erholt sich all-inclusive in türkischen Seebädern und gibt sich alle Mühe, nicht daran zu denken, dass ein paar Hundert Meter weiter die Leichen von Flüchtlingen an den Strand gespült werden.
Der blasse und vom langen Sitzen steif gewordene Reisende knipst verwackelte Bilder durch die Scheibe des Busses, und die Beine kann er erst dort wieder ausstrecken, wohin ihn der Wille und der Geschäftssinn des Reiseleiters bringen. Während des kurzen Aufenthalts sieht er dann mit eigenen Augen, was die Reiseführer empfehlen, und befriedigt vermerkt er in Gedanken, dass dies alles tatsächlich existiert. An den Abenden bekommt der Tourist ein exotisches real life geboten, das alles andere als real ist und mit life eigentlich gar nichts zu tun hat.
Der Tourist möchte es exotisch, aber in Maßen. Er möchte, dass es echt wirkt, aber bitte nicht um den Preis der Dusche am Morgen. Er möchte ein bisschen Nervenkitzel, aber nicht so, dass es ihn beunruhigen müsste. Er möchte Kontakt mit den Einheimischen, solange er oberflächlich bleibt und unverbindlich. Einmal hörte ich ein Gespräch meiner Landsleute im mittleren Alter, sie wollten gemeinsam nach Kuba reisen und bestärkten einander darin, die Reise zu unternehmen, solange Fidel noch lebe. Solange dort noch Armut herrsche. Denn später wäre es dann »wie überall«. Der Geschäftssinn hat auch im Tourismus die Grenzen der Ethik verschoben.
Verschiedene Welten
Eine Reise ist immer auch eine Eroberung. Wenn wir uns auf den Weg machen, begleitet uns unser Ozean an Bedeutungen, Begriffen, Klischees, mentalen Gepflogenheiten. Seine Wellen überspülen, was wir außerhalb unseres Selbst vorfinden. Was wir bereits wissen, bereits begriffen haben, ergießt sich auf diese andere Welt. Derlei Eroberungen werden möglich dank der Reiseführer, die immer besser wissen, welche Orte wir besuchen, was wir besichtigen sollten. Willkürlich stecken sie die Grenzen unserer Wahrnehmung ab, denn was im Reiseführer nicht vermerkt ist, existiert auch nicht. So absolvieren wir festgelegte Touren, auf denen wir fieberhaft suchen, was wir sehen müssen. Und sehen dann auch nichts anderes.
Reiseführer sind nach wie vor ein Thema für eine eigene Monographie. Ihnen ist zu entnehmen, wie wir uns das Fremde anzueignen versuchen, indem wir es in unseren Erkenntnisradius integrieren. Allem Anschein zum Trotz richten sie sich nicht an die Allgemeinheit, sondern immer an eine bestimmte Zielgruppe mit spezifischen Eigenschaften, und diesen Aspekt ebenso wie die politischen Implikationen sollten wir nie aus den Augen verlieren. Eben hier sollten wir ansetzen nachzudenken, was wir denn eigentlich betrachten.
Ich habe einmal zwei Reiseführer durch eine bestimmte Region Polens durchgesehen – einer verfasst von Katholiken, der andere von Juden. Sie waren völlig voneinander verschieden. Reisende der beiden Gruppen würden wahrscheinlich wie Schatten aneinander vorübergleiten, womöglich, ohne einander zu bemerken. Die Routen hätten keine Schnittpunkte, weil die Reiseführer so gänzlich verschiedene Erfahrungen, so gänzlich verschiedene Blicke auf die Vergangenheit vermitteln. Ja, wir dürfen sagen, dass die Reisetagebücher dieser beiden Gruppen – so sie denn welche führen würden – von zwei verschiedenen Welten sprechen müssten.
Existiert denn überhaupt die eine Welt, unus mundus, die die Philosophen sich zurechtgeträumt hatten? Ein großes, neutrales Universum, in dem wir die Möglichkeit haben, einander zu begegnen und im anderen den Nächsten zu erkennen. Oder leben wir, die wir uns in der einen räumlichen Sphäre befinden, in Wahrheit in den jeweils eigenen Phantasmen?
Kilometer um Kilometer
Vor Kurzem erzählte mir ein Siebzigjähriger, wie Reisen in der Zeit der Blumenkinder ausgesehen hatten. Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts kaufte sich der rebellisch farbenfrohe Mensch des Westens einen billigen Gebrauchtwagen, am besten einen Bulli, und machte sich auf den Weg nach Indien. Dafür brauchte man damals entschieden mehr Zeit, als wir im 21. Jahrhundert bereit wären, für einen solchen Ortswechsel aufzubringen. Indem wir heute an Bord einer Boeing gehen, vollziehen wir eine Art Zaubertrick. Ein großes »Klick« – und in wenigen Stunden steigen wir in einer völlig anderen Wirklichkeit aus. Jene Reisenden damals haben die Welt Kilometer um Kilometer durchmessen, und Tag um Tag veränderten sich der Geschmack des Wassers, des Essens, die Temperatur, das Klima. Der Körper hatte die Möglichkeit, sich den Veränderungen anzupassen. Unterwegs erlebten die Menschen allerlei Abenteuer, zumal man gerade entlang dieser Route günstig gutes Gras und gutes Hasch kaufen konnte.
Eine Reise war damals (und sie wäre es wohl besser auch geblieben) eine Übung im Fremdsein. Marco Polo empfand es, als er an den Hof des Herrschers von China gelangte, und ebenso spürte es jener bunt gekleidete Hippie, der in der Dämmerung, sagen wir, durch das rajasthanische Jodhpur streifte und die Erfahrung machte, wie seine Existenz in einen ebenso seltsamen wie atemberaubenden Schwebezustand geriet. Nichts von alledem versteht er, hier gehört er nicht dazu, niemanden kümmert sein Dasein.
Käme uns heute die verrückte Idee in den Sinn, eine ähnliche Reise zu unternehmen – wie viele Krisenzonen, wie viele Kriegsgebiete müssten wir durchqueren? Ein Blick auf die Landkarte würde genügen – und sofort müsste uns die Frage bedrängen, ob das überhaupt möglich sei.
Eine irreale Show
Dass jene sichere Welt ihr Ende fand, lag nicht nur an den Kriegen und Konflikten. Es hatte auch damit zu tun, dass bestimmte, potenziell attraktive Gegenden der Erde einander auf eigentümliche Weise ähnlich wurden – hinsichtlich der Kleidung, des Essens, in der Allgegenwart des Plastiks, durch die lokalen Souvenirs chinesischer Produktion. Den Touristen blieben bestimmte Bereiche vorbehalten, vergleichbar den Wirtschaftszonen oder den Vergnügungsparks für Kinder – selbstverständlich mit einem riesigen Parkplatz für die Reisebusse. An anderen Orten, an denen große Summen in den Tourismus investiert werden, sitzen die Urlauber am Strand unter der diskreten Bewachung uniformierter Wachschutzkommandos, die mit scharfen Waffen ausgerüstet sind. Von der vorgesehenen Besichtigungsroute abzuweichen, wird nicht nur zunehmend schwierig, es ist auch kostspielig. Ein Vergnügen für die Reichen. Weniger wohlhabende Touristen bekommen einen sicheren Durchschnittsstandard, das übliche Fast Food, das überall gleich schmeckt und so gut wie nichts vermittelt – im Grunde leere Kalorien.
So ist die Rückkehr von einer weiteren exotischen Reise oft genug mit einer Enttäuschung verbunden, die man sich möglichst zu verbergen bemüht – da haben wir allerlei Souvenirs und irgendwelchen glitzernden Plunder zusammengekauft (zu Hause weiß man dann nicht, was anfangen mit dem Zeug), alle Sehenswürdigkeiten besichtigt, die der Reiseführer empfiehlt, haben einheimische alkoholische Getränke probiert und lokale Gerichte (viele gibt es in einer eigenen Touristenversion), haben folkloristische Tänze gesehen. Doch wenn wir wieder zu Hause sind und mit den Koffern im Flur stehen, beschleicht uns das Gefühl, an einer irrealen Show teilgenommen zu haben. Als hätten wir durch eine Scheibe ein Eis essen wollen.
Eine Frage der Freiheit
Eine Reise zu unternehmen, war in unserer westlichen Kultur ein Akt der Freiheit. Phileas Fogg ist ein freier Mensch. Als freier Mensch geht er eine Wette ein, stellt sich einer Herausforderung und entscheidet damit über sein Leben. Reisen wurde zu einem Symbol der Freiheit, und vermutlich ist es auch deshalb für uns so attraktiv. Vielleicht verstehen wir, die wir von Natur aus Nomaden sind und nur angehalten haben auf unserem Weg, auf eben diese atavistische Weise die Freiheit – in Bewegung sein, die Orte wechseln, irgendwohin ziehen …
Wenn der Entschluss, sein Land zu verlassen – und sich auf den Weg zu machen –, eine Frage der freien Entscheidung ist, vergleichbar der Redefreiheit, wie könnten wir sie dann, wenn wir selbst darüber verfügen, anderen verbieten wollen? Für manche Menschen stellt die Emigration die einzige Alternative dar angesichts des Freiheitsverlusts und wird damit Teil des unantastbaren Rechts des Menschen auf eine freie Entscheidung. Wer soll bestimmen dürfen, wo jemandes Platz sei? In Zeiten, in denen Tausende Menschen in unseren Ländern Schutz suchen, bitten Herr al-Halabi und Frau Marrousch nicht um unsere Hilfe. Sie wollen nicht wie Flüchtlinge behandelt werden, sondern wie freie Menschen, denen es zusteht zu entscheiden. Paradox ist es, dass es den Ortswechsel erleichtern würde, wenn sie sich als Ware deklarieren, einen Lieferschein ausfüllen und sich selbst per Flugzeug expedieren würden. Sie hätten es leichter, Grenzen zu überwinden, hätten es leichter zu reisen.
Fremde Freiheit ist immer heikel. Die sich der Freiheit erfreuen dürfen, wollen sie anderen häufig nicht gönnen.
Warum kann ich in das Land Frau Marrouschs, das Land Herrn al-Halabis fahren und dort so lange bleiben, wie ich möchte – wahrscheinlich könnte ich mich dort sogar niederlassen –, Frau Marrousch aber und Herr al-Halabi dürfen dies in meinem Land nicht? Warum wollen meine Landsleute, die seinerzeit in Libyen und Syrien Geld verdient haben beim Bau von Brücken und Fabriken, um im Leben vorwärtszukommen, heute den Libyern und Syrern keine Chance in Polen geben – selbst dann nicht, wenn deren Leben auf dem Spiel steht?
Habe ich noch das Recht zu reisen? Wenn Menschen an Grenzen festgehalten und in Flüchtlingslager gesteckt werden, wird Reisen zunehmend zum ethischen Problem.
Ehrlich gesagt, ich habe die Lust am Reisen verloren. Und das nicht aus Angst vor Anschlägen oder Kriegen. Die Lust am Reisen ist mir vergangen, weil es mich beschämt, über eine Freiheit zu verfügen, die andere nicht haben.
Ich möchte keine Touristin mehr sein in den Ländern des armen globalen Südens. Hilflos das Elend der Menschen und das Leiden der Tiere zu sehen, ist mir unerträglich.
Die Lust am Reisen ist mir vergangen, seit ich im Südchinesischen Meer schwimmende Inseln aus Plastik gesehen habe. Wollte man sich am Strand hinsetzen, musste man sich den Platz zuerst freiräumen.
Ich möchte nicht mehr mit dem Flugzeug reisen, seit Flugzeuge als Taxis zwischen den Citys dienen, die bei einem Flug so viel Treibstoff verbrennen wie zig Reisebusse auf der gleichen Strecke.
Die Lust am Reisen ist mir vergangen, seit es auf Facebook Blogs gibt, auf denen heutige Reisende ihre Fotos posten und in allen Einzelheiten darüber informieren, was sie an jedem Tag ihrer exotischen Reise unternommen haben. Und wer möchte, kann mit ihnen so einfach in Kontakt treten, als wären sie zu Hause. Ich habe den Eindruck, sie wären nie wirklich aufgebrochen.
Bücher vom Zuschnitt »Ich erzähle euch, wo ich war« und Festivals, die dem Reisen gewidmet sind, reizen mich nicht mehr. Auch der Reisende als Flaneur, der ohne Eile unterwegs ist, mit leicht schleppendem Schritt, als Verkörperung des reinen Schauens gleichsam, über die Straßen der Welt streift, um sein unersättliches, ewig nach Erfahrungen gierendes Ego zu zelebrieren, bereitet mir keine Freude mehr.
Die Lust am Reisen ist mir vergangen, seit Dschihadisten Buddha-Statuen gesprengt und Palmyra zerstört haben. Vielleicht ist es besser, diese Orte virtuell zu besuchen, denn im Internet existieren sie noch, dort sind sie sicher.
Ich verspüre nicht mehr das Bedürfnis, fremde Städte zu besuchen, seit man in jeder Straße der Welt die gleichen in China produzierten Souvenirs findet.
Ich werde in fremden Städten keine Museen mehr besuchen, solange ich nicht in den Museen meiner eigenen Stadt gewesen bin.
Kann man noch ein unschuldiger Reisender sein in einer Welt der Konflikte, der explodierenden Bomben, der entführten Flugzeuge und der ständigen Angst vor Anschlägen? Kann man Urlaubsfreude empfinden an einem Strand, den die Einheimischen nicht betreten dürfen? Kann man sich im Flugzeug bequem zurücklehnen, wenn in der Gegenrichtung Menschen unterwegs sind, die sich in Containern drängen?
Was würden Phileas Fogg und Indiana Jones dazu sagen?
Vielleicht sollten wir jetzt einfach einmal zu Hause bleiben, um andere Reisende zu begrüßen.
Deutsch von Lothar Quinkenstein
Die Masken der Tiere
Das Leiden eines Menschen ist für mich leichter zu ertragen als das Leiden eines Tieres. Der Mensch hat einen eigenen, ausgearbeiteten und allseits propagierten ontologischen Status, was ihn zu einer privilegierten Gattung macht. Er hat Kultur und Religion, die ihm im Leiden beistehen sollen. Er hat seine Rationalisierungen und Sublimierungen. Er hat seinen Gott, der ihn am Ende erlöst. Das menschliche Leiden hat einen Sinn. Für das Tier gibt es weder Trost noch Linderung, denn auf das Tier wartet keine Erlösung. Für das Tier gibt es auch keinen Sinn. Sein Körper gehört ihm nicht. Es hat keine Seele. Das Leiden des Tieres ist ein absolutes, totales.
Wenn wir versuchen, uns diese Tatsache mit unserer menschlichen Fähigkeit zu Reflexion und Mitgefühl zu vergegenwärtigen, dann offenbart sich uns das ganze Grauen des tierischen Leidens und mit ihm das entsetzliche, kaum erträgliche Grauen der Welt.
Im vorsokratischen antiken Griechenland galt ein Trilog. Er bestand aus drei einfachen Geboten, die Pythagoras und dessen Schüler formuliert hatten: Ehre die Eltern, bringe den Göttern Fruchtopfer dar, verschone die Tiere. Diese Gebote verweisen denkbar lakonisch auf die drei wichtigsten Sphären des menschlichen Lebens: erstens die grundlegenden sozialen Bindungen, zweitens den weitgefassten Bereich der Religion und drittens den würdigen Umgang mit Tieren. Sie geben kein konkretes Verhalten vor, doch sie weisen die Richtung. Sie sind mehr Ge- als Verbote und lassen Raum für Interpretationen. Ihre Nichterfüllung weckt Schuldgefühle, Scham, moralisches Unbehagen. Man muss sie nicht konkretisieren.
Während aber die beiden ersten Gebote uns auf umfassend kodifizierte Systeme verweisen – das soziale und das religiöse –, und sich auf klar ausformulierte, allgemein transparente Normen und Rituale stützen, ist das Verhältnis des Menschen zu den Tieren nicht auf vergleichbare Weise reguliert (abgesehen vielleicht von den im Alten Testament enthaltenen Speisevorschriften) und bleibt deshalb dem menschlichen Gewissen überlassen. Somit wird es zu einer ethischen Frage, das heißt, wir können abwägen, was zu tun und was zu unterlassen ist.
Wie die Gabe der Vernunft uns besser macht
Die Pythagoräer hielten Tiere für vernunftbegabte Wesen, der anarchistische Diogenes behauptete sogar, sie seien dem Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen. Doch das war nicht die allgemeine Auffassung.
Die jüdisch-christliche Tradition sagt eindeutig: Die Erde mit ihren Pflanzen- und Tierarten wurde geschaffen, um der menschlichen Gattung zu dienen. Gleich zu Beginn des Buches Genesis heißt es, Gott gebe dem Menschen die Herrschaft über alle Geschöpfe der Erde, denn der Mensch stehe im Mittelpunkt der Schöpfung, und Zweck der Natur sei es, ihm zu Diensten zu sein.
Einen ähnlichen Gedanken entwickelten die antiken griechischen Philosophen. Aristoteles fand eine überzeugende Begründung für den hierarchischen Aufbau des Hauses der Schöpfung – der Mensch sei als einziges Wesen mit Intellekt bedacht worden, und die Macht der Vernunft sei von allen menschlichen Eigenschaften die wichtigste und bedeutendste. Alle Wesen, die über einen geringeren Verstand verfügten, stünden in der Hierarchie naturgemäß niedriger (mit derselben Logik rechtfertigte Aristoteles den Sklavenhandel – er behauptete, bestimmte Menschen seien Sklaven »von Natur aus«).
Ihre endgültige Gestalt erhielt die Idee bei Augustinus, der es für falsch hielt, das biblische Gebot »Du sollst nicht töten« auch auf nicht vernunftbegabte Geschöpfe zu beziehen.
Wann immer man etwas Definitives über das frühe Christentum sagen möchte, sollte man bedenken, wie viele unterschiedliche Visionen, Ideen und Interpretationen ihm zugrunde lagen. Sicher ist aber, dass sein Verhältnis zu den Tieren voreingenommen und feindselig war. Thomas von Aquin, der aus der frühchristlichen Vielstimmigkeit eine kohärente und ausgeklügelte Philosophie formte, schloss an die Ideen des Augustinus an und ging zugleich darüber hinaus. Er meinte, die Tiere seien nicht nur nicht vernunftbegabt, sondern es fehle ihnen auch die unsterbliche Seele, weshalb ihr Tod – im weitesten Sinne – völlig bedeutungslos sei. Wir hätten keine direkten moralischen Verpflichtungen gegenüber den Tieren, weil nur eine Person (das heißt ein vernunftbegabtes und zur Selbstbeherrschung fähiges Wesen) Subjekt von Pflichten und Rechten sein könne.
Dies war zweifellos ein radikaler Standpunkt, der später die Massentierhaltung zur Fleischproduktion begünstigen sollte. Man kann auch sagen, dass der Aquinate die Menschen für lange Zeit von der Verantwortung für das Töten von Tieren lossprach. Wir haben immer noch das klare »Du sollst nicht töten« in Erinnerung, das aber durch Interpreten wie Thomas von Aquin so durch Voraussetzungen und Ausnahmen verwässert wurde, dass der ursprüngliche Sinn des Gebots völlig verloren ging. In den meisten antiken Kulturen war der Verzehr von anderem als Opferfleisch tabu. Um ein Tier zu essen, musste man es erst als Opfer darbringen; diese Geste befreite den Tötenden von der Schuld, einem anderen Wesen das Leben genommen zu haben.
Bei Descartes erscheint zum ersten Mal die schreckliche Vision des Tiers als Maschine, die nach recht einfachen mechanischen Regeln funktioniere. Der Mensch zeichne sich durch die Vernunft und eine unsterbliche Seele aus, die Tiere indes ähnelten eher Automaten als lebendigen Wesen, womit nicht mehr nur das Töten und der Verzehr von Tieren ethisch unbedenklich erschienen, sondern auch Praktiken wie die Vivisektion.
Kant schrieb am Ende des 18. Jahrhunderts, wir hätten den Tieren gegenüber keine unmittelbaren Pflichten, weil sie keine selbstbewussten Wesen seien. Sie seien lediglich Mittel zum Zweck. Der Zweck wiederum sei der Mensch.
Auch die katholische Kirche bestritt konsequent jede moralische Verpflichtung des Menschen gegenüber den Tieren. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts verweigerte Papst Pius IX. die Zustimmung zur Gründung einer Gesellschaft zur Verhütung von Tierquälerei. Im gegenwärtigen Katechismus der Katholischen Kirche heißt es, der Mensch schulde den Tieren Wohlwollen und dürfe sie nicht unnötig leiden lassen, aber auch: »Tiere, Pflanzen und leblose Wesen sind von Natur aus zum gemeinsamen Wohl der Menschheit von gestern, heute und morgen bestimmt.«
In der Biologie hingegen gilt nach wie vor der Lehrsatz, den Conwy Lloyd Morgan, ein Pionier der experimentellen Tierpsychologie, gegen Ende des 19. Jahrhunderts formulierte: »In keinem Fall sollten wir eine Handlung als das Ergebnis der Ausübung eines höheren geistigen Vermögens interpretieren, wenn sie auch als das Ergebnis eines in der geistigen Skala niedrigerstehenden geistigen Vermögens interpretiert werden kann.« Will sagen: Wir sollten das Verhalten von Tieren besser mit Reflexen und Instinkten erklären, statt ihnen höheres Denken und Fühlen zuzuschreiben.
Der Gerechtigkeit halber muss jedoch an die großen Denker erinnert werden, die einen anderen Standpunkt vertraten. Der heilige Johannes Chrysostomos lehrte – gleichsam im Vorgriff auf Darwins Theorie –, die Herkunft der Tiere sei dieselbe wie unsere, wir schuldeten ihnen deshalb Güte und Sanftheit. Der heilige Franziskus von Assisi predigte die Liebe zur Natur, doch vor allem forderte er, wir sollten die Tiere als unsere Brüder und Schwestern betrachten. Der große Montaigne, der seiner Zeit in jeder Hinsicht voraus war, hielt es für ein Zeichen mangelnder Vorstellungskraft und für ein Vorurteil eines beschränkten Geistes, sich über den Rest der Schöpfung zu stellen. Den größten Dienst erwies den Tieren aber Jeremy Bentham, ein Philosoph des 18. Jahrhunderts und Vorläufer der modernen Tierethik. Er formulierte als Erster, was vielen heutigen Menschen offensichtlich erscheint: Zweifellos seien die Menschen in vielerlei Hinsicht vollkommener als die Tiere, auch aufgrund ihres Verstandes oder des Grades ihres Selbstbewusstseins. Für die moralische Betrachtung seien diese Unterschiede freilich irrelevant. Im Jahr 1780 schrieb er: »Die Frage ist nicht: können sie [die Tiere] verständig denken? Oder können sie sprechen? Sondern: können sie leiden?«[1]