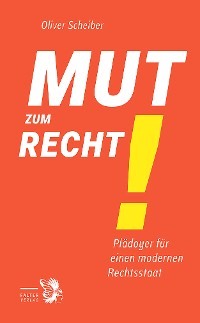Kitabı oku: «Mut zum Recht!», sayfa 2
1. Recht und Gerechtigkeit in Literatur und Kunst
Nähern wir uns dem Thema von Recht und Gerechtigkeit über einen Seiteneingang: die Kunst. Kann sie uns helfen, unser Rechtssystem besser zu verstehen und zu entwickeln? Die Kunst hat der Justiz einiges zu bieten. Die Justiz kann sich Kunst zum Beispiel zunutze machen, indem sie sie direkt in das Modell ihrer Aus- und Fortbildung integriert.
Literatur und Recht sind seit jeher in vielfältiger Weise miteinander verknüpft. Neben der Liebe und dem Tod gehören Recht und Gerechtigkeit zu den wesentlichen Fragen des Lebens, mit denen sich die Literatur seit der Antike beschäftigt und die sie zu ihren großen Themen gemacht hat. Somit kommt auch der Person des Richters als literarischer Figur eine gewisse Bedeutung zu. Wir können hier ruhig die männliche Form verwenden, da Richterinnen erst im 20. Jahrhundert auftreten und in der Literatur kaum präsent sind. Der Richter ist, ähnlich dem Priester, in allen Gesellschaftsformen seit der Antike weitgehend unverändert eine die Gesellschaft tragende Figur. Die Verbindung zwischen Recht und Literatur wird dadurch verstärkt, dass viele große Schriftsteller ausgebildete Juristen waren und sind.
Man denke nur an Goethe, Kleist, Grillparzer, Storm, Kafka oder Tucholsky. Die Tradition des schreibenden Richters wird heute etwa von Janko Ferk oder Bernhard Schlink fortgeführt. Nicht selten steht, wie etwa bei Thomas Bernhard, die Beschäftigung mit der Gerichtsreportage am Beginn einer Schriftstellerkarriere oder wird, wie bei Karl Kraus, zu einer zentralen schriftstellerischen Betätigung.
Zu dieser Verbindung von Literatur und Recht trägt auch die Nähe jeder Gerichtsverhandlung zum Schauspiel bei. Theater und Gerichtssaal sind weitgehend austauschbare Spielstätten. So wie das Theater ist die Gerichtsverhandlung mit Ritualen und Symbolen aufgeladen. Die eigentümliche Sprache, die Talare der Richterinnen und Richter, die Roben der Verteidigerinnen und Verteidiger, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die feierliche Verkündung des Urteils – das alles sind Elemente des öffentlichen Regelungs- und Reinigungsprozesses, wie ihn vor allem die Strafverhandlung darstellt.
Die Sprache ist das Hauptinstrument der Dichterinnen und Dichter und eines der wichtigsten, wenn nicht das elementare Mittel der Rechtsberufe – eine weitere Verbindung von Recht und Literatur. Wenige Berufe sind so auf die Sprache und auf Ausdrucksfähigkeit angewiesen wie das Richteramt, produziert doch jedes einzelne Rechtsprechungsorgan jährlich hunderte bis tausende Seiten zum Teil doch recht individueller Texte. In Zivilsachen tätige Bezirksrichterinnen und -richter haben in Österreich rund hundert Urteile pro Jahr auszufertigen, die im Schnitt zwischen zehn und fünfzehn Seiten lang sind.
Die vielfältigen Verflechtungen von Recht und Literatur wurden von der Wissenschaft interessanterweise erst in neuerer Zeit systematisch bearbeitet, und zwar in der sogenannten Law and Literature-Bewegung, die in den 1980er-Jahren in den USA entstanden ist. Diese Bewegung hat heute im amerikanischen rechtswissenschaftlichen Diskurs einen fixen Platz. Law and Literature beschäftigt sich unter anderem mit der Analyse von literarischen Werken, dem Einsatz von Literatur in der juristischen Ausbildung und der Anwendung literaturwissenschaftlicher Methoden sowie der Rolle des Narrativen im Rechtsdiskurs.
Die Funktion der Richterinnen und Richter, die die Streitigkeiten der Bürgerinnen und Bürger beilegen und den Rechtsfrieden herstellen sollen, finden wir in allen Gesellschaften und Epochen. Aufgaben und Grenzen der richterlichen Tätigkeit werden in Rechtswissenschaft und Philosophie, je nach eigenem weltanschaulichem Standpunkt, mit gewissen Abweichungen beschrieben – so spielt es etwa eine Rolle, ob jemand dem Naturrecht oder dem Rechtspositivismus anhängt. Ungeachtet der verschiedenen Definitionen des Berufsbilds ist die Rolle der Richterinnen und Richter für jede Gesellschaft zentral. Die Entwicklung der Rechtsprechung in Arbeits- und Sozialrechtssachen, in Asyl- und Mietangelegenheiten, die Entscheidung, ob Straftätern Bewährungshilfe gewährt oder eine Therapie bewilligt wird, der Umgang mit den Opfern von Straftaten – all dies sind gesellschaftlich relevante Fragen und Beiträge zur Entwicklung jeder Gemeinschaft. Das Rechtsprechen wird hier zu einer in höchstem Maße politischen, wenn auch im zu wünschenden Regelfall nicht parteipolitischen Aufgabe. Und die Bedeutung der Gerichte wächst, zumal die Politik immer öfter heikle Fragen offenlässt. An die Stelle des unentschlossenen Gesetzgebers treten die (Verfassungs-)Gerichte. Die Vorstellung von Montesquieu, Richter sollten nur willenlose Wesen sein, nicht mehr als der „Mund des Gesetzes“, ist damit heute nicht haltbar.
Richterinnen und Richter sind aber auch selbst unmittelbare Zeuginnen und Zeugen gesellschaftlicher Entwicklungen: Zum einen schlägt sich etwa eine Verarmung oder zunehmende Verschuldung bestimmter Personengruppen sehr rasch in steigender Kriminalität oder in einer Zunahme der Zahl der Exekutionsverfahren nieder. Zum anderen legen die Personen, die vor Gericht aussagen, in der Regel ihren Alltag und ihr Denken sehr bereitwillig offen. Wenige Berufe gewinnen daher einen so umfassenden Eindruck von den Lebensverhältnissen der Menschen wie Richterinnen und Richter. Ihre Berichte – wie das „Tagebuch“ des Richters Dante Troisi („Diario di un giudice“, 1955) – sind deshalb spannende zeitgeschichtliche Dokumente.
Vor allem die Fragen nach Gerechtigkeit und Wahrheit sind es wohl, die das Richteramt für die Literatur so spannend machen. Es herrscht Unsicherheit über die Existenz von Wahrheit und Willensfreiheit. Die unterschiedlichen Auffassungen darüber, was wahr und was gerecht denn bedeuten, zeigen: Wer Recht spricht, begibt sich auf gefährliches Terrain.
Um Ordnung und Rechtssicherheit zu gewährleisten, verleiht der Staat dem Richterspruch Autorität. Urteile, und seien sie auch noch so irrig, werden mit staatlicher Hilfe durchgesetzt. Philosophische Rechtfertigungen für richterliche Entscheidungen bleiben ungewiss. Vielleicht ist es heute zweckmäßiger, mit Begriffen wie Wahrheit und Gerechtigkeit sparsam umzugehen und besser von Spielregeln zu sprechen, die sich in den Gesetzen ausdrücken und allen bekannt sein sollten.
Eine weitere zentrale Fragestellung der richterlichen Berufsausübung ist die Willensfreiheit des Menschen. Das gesamte Strafrecht, letztlich aber auch das Zivilrecht, baut auf der Grundthese auf, dass sich der Mensch aufgrund seiner Willensfreiheit für oder gegen bestimmte Taten und Handlungsweisen entscheiden kann. Im Strafverfahren wird bestraft, wer Schuld hat. Die zentrale Frage, ob der Mensch in seinen Handlungen determiniert oder nicht determiniert ist, ob man also jemandem die Entscheidung für das Unrecht zum Vorwurf machen kann oder ob jeder in seinen Entscheidungen vorherbestimmt ist, ist in der Philosophie strittig und wird sich wohl nie lösen lassen. Die richterliche Tätigkeit leidet daher in diesem Punkt in gewisser Weise immer an einem Legitimitätsproblem, das nur durch pragmatische Erklärungskrücken gelindert werden kann. Selbst neueste Erkenntnisse der Hirnforschung helfen in der Frage der Willensfreiheit nicht weiter. So meint der langjährige Präsident des Wiener Jugendgerichtshofs, Udo Jesionek, tatsächlich fühle sich der Mensch in seinen Handlungen frei, weshalb die Menschen Strafen für Unrecht auch als gerecht akzeptieren würden. Dieser Ansatz findet Unterstützung in der Tatsache, dass nur ein geringer Prozentsatz von Verurteilungen im Strafverfahren bekämpft wird.
Bei Richterfiguren in der Literatur denkt man zuerst an Werke wie Kafkas „Prozess“, die Ringparabel in Lessings „Nathan der Weise“ oder an den „Zerbrochnen Krug“ von Kleist. Richter begegnen uns in der Literatur von den griechischen Dramen der Antike und alten religiösen Schriften (der Richter Salomon im Alten Testament oder Pontius Pilatus) bis zur Kriminalliteratur der Gegenwart. Allerdings treten Richterfiguren nur eher selten in literarischen Werken hervor oder tragen gar die Handlung. Häufiger sind es Fragen von Recht und Gerechtigkeit, von – nicht nur bei Dostojewskij – Schuld und Sühne, die im Mittelpunkt stehen, und weniger die Figur eines konkreten Richters. Nur in Ausnahmefällen wie dem „Zerbrochnen Krug“ können wir also einem Richter in der Literatur bei der Arbeit zusehen. Wo das der Fall ist, konzentriert sich das Interesse der Kunst auf den Strafrichter. Nicht anders ist es bei der Prozessberichterstattung in den Medien. Auch hier gilt fast die gesamte Aufmerksamkeit den Strafverhandlungen, die jedoch nur einen vergleichsweise geringen Anteil an allen Rechtsprechungstätigkeiten ausmachen. Aber das Strafrecht ist eben näher an den Grundfragen des Lebens und an den entscheidenden philosophischen Fragen. Dies mag seinen Reiz ausmachen.
Manche Probleme, wie die Ausübung besonderer Formen der Gerichtsbarkeit, etwa der sogenannten Besatzungs- oder Siegerjustiz, die sich im letzten Jahrhundert zu einer internationalen Gerichtsbarkeit entwickelt hat, ziehen sich durch die Epochen, von der Beschreibung der Gerichtsverhandlung des Pontius Pilatus im Neuen Testament bis zu Peter Handkes „Rund um das Große Tribunal“.
Nach Richterinnen suchen wir in der Literatur vergeblich. Zwar beträgt der Frauenanteil in der österreichischen Richterschaft heute mehr als fünfzig Prozent. Aber historisch waren Frauen die längste Zeit nicht nur vom Richteramt, sondern von den rechtswissenschaftlichen Studien überhaupt ausgeschlossen. Es ist heute schwer vorstellbar, dass erst im Jahr 1887 mit Emily Kempin-Spyri die erste Juristin in Europa, an der Universität Zürich, promovierte. Es dauerte bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass Frauen in Österreich in die Rechtsprechung gelangten. Erst 2007 erhielt Österreichs Oberster Gerichtshof zum ersten Mal eine Präsidentin.
Welches Bild der Richter finden wir in der Literatur gezeichnet? Die positiven und negativen Darstellungen halten sich, und zwar in allen literaturgeschichtlichen Epochen, die Waage. Die Beschreibungen der Richter schwanken zwischen den beiden folgenden Extremen:
„Darum nimmt man auch beim Streite seine Zuflucht zum Richter. Zu ihm zu gehen bedeutet zur Gerechtigkeit zu gehen. Denn der Richter soll so etwas wie eine beseelte Gerechtigkeit sein, und man sucht einen maßvollen Richter, und einige nennen sie ‚Mittelsmänner‘ …“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik) „Immer war der Richter ein Lump, jetzt soll der Lump ein Richter sein.“ (Brecht, Der kaukasische Kreidekreis)
Wir stoßen auf das Phänomen, dass der Beruf des Richters bzw. der Richterin bei Umfragen in der breiten Bevölkerung nach wie vor hohes Ansehen genießt. Gleichzeitig gibt es gerade in der deutschsprachigen Literatur eine Tradition harter Kritik an der Justiz und ihrem Umgang mit den vor dem Richtertisch stehenden Menschen. Diese Kritik stützt sich mitunter auf – wie im Falle von Karl Kraus – sehr intensive Prozessbeobachtung. Sie setzt frühzeitig ein, etwa mit dem in Vergessenheit geratenen Franz Xaver Huber im 18. Jahrhundert. Gut hundert Jahre später, knapp nach 1900, treffen wir auf die harsche, satirische Justizkritik von Karl Kraus, die sich allerdings nicht nur gegen die Prozessführung der Richter, sondern gleichermaßen gegen den Gesetzgeber mit dessen „grauenvollen Strafgeboten“ richtet. Das liest sich etwa folgendermaßen:
„Johann Feigl, Hofrat und Vizepräsident des Wiener Landesgerichts, hat als Vorsitzender einer Schwurgerichtsverhandlung am 10. März 1904 einen dreiundzwanzigjährigen Burschen, der in Not und Trunkenheit eine Frau auf der Ringstraße attackiert und ihr die Handtasche zu entreißen versucht hatte, zu lebenslänglichem schweren Kerker verurteilt.“
Um nichts weniger hart fällt die Kritik Kurt Tucholskys an der deutschen Justiz aus:
„Eine der unangenehmsten Peinlichkeiten in deutschen Gerichtssälen ist die Überheblichkeit der Vorsitzenden im Ton den Angeklagten gegenüber. Diese Sechser-Ironie, verübt an Wehrlosen, diese banalen Belehrungen, diese Flut von provozierenden, beleidigenden und höhnischen Trivialitäten ist unerträglich.“
Nicht selten knüpft die Literatur an die politischen Vorgänge an, an Justizsysteme, die sich von den Machthabern instrumentalisieren lassen. Werke von Leonardo Sciascia, „Der Zusammenhang“, und Anatole France, „Crainquebille“, sind Beispiele dafür. Das Thema „Justiz und Nationalsozialismus“ hat in der deutschsprachigen Literatur unter anderem Thomas Bernhard in seinem Stück „Vor dem Ruhestand“ aufgegriffen. Bernhard nahm für dieses Stück Anleihen beim Fall des deutschen Ministerpräsidenten Hans Filbinger und führte das Thema Justiz, Politik und Nationalsozialismus in den Dramoletten „Der deutsche Mittagstisch“ (1978), „Freispruch“ (1981) und „Eis“ (1981) weiter.
Der Gerichtssaal, selbst in seiner modernen architektonischen Ausgestaltung, ist ein dramaturgischer Ort. Die Rituale des Strafprozesses mit der Verlesung der Anklage, dem Abfragen der Personalien, der Frage nach dem Schuldbekenntnis und den Plädoyers schaffen eine eigene Welt, in der sich die Eingeweihten sicher bewegen und einfache Bürgerinnen und Bürger sich von Beginn an auf einer schiefen Ebene wähnen.
Wie immer man dieses Szenario bewertet, eine gewisse Faszination ist mit den Themen Strafprozess, Schuld, Sühne, Wiedergutmachung, Strafe und Ausgleich durchaus gegeben. Das Kino hat mit dem Gerichtsfilm früh ein eigenes Genre geschaffen. Sidney Lumets „Zwölf Geschworenen“ und Billy Wilders „Zeugin der Anklage“ mit Marlene Dietrich sind zwei bekannte Beispiele dafür, beide 1957 entstanden. Heute findet die Beschäftigung mit dem Gerichtssaal, unserer Zeit entsprechend, vor allem im Fernsehen statt. Richterpersönlichkeit und Strafprozess werden mal mit mehr Esprit, etwa in amerikanischen Fernsehserien wie „Ally McBeal“ oder „Boston legal“, mal weniger geistreich, wie in den vor Jahren gehypten Gerichtsshows der deutschen Privatfernsehsender, abgehandelt. Als Verbindung zur Welt des Theaters finden wir in Letzteren regelmäßig den Überraschungszeugen als Deus ex Machina, der das Blatt wendet.
Freilich, die Rituale und die Sprache des Gerichtssaals sind heute zu hinterfragen. Die Kommunikation des Gerichts ist traditionell von jener des Alltags entfernt, eine Notwendigkeit dafür nicht immer erkennbar. Die Wahrheitsfindung als hochgehaltener Zweck des Gerichtsverfahrens lässt sich in natürlicher Umgebung wohl leichter herstellen als im Rahmen überholter Riten. Diese Erkenntnis setzt sich allmählich durch, jahrhundertealte Gepflogenheiten des Gerichtslebens fallen daher. Mussten früher alle Zeugen und Parteien vor der Richterbank stehen, selbst bei stundenlangen Befragungen, so verfügen sie seit rund zwanzig Jahren über einen Sitzplatz hinter einem kleinen Tischchen. Die Beeidigung wird nach und nach aus den Prozessordnungen gestrichen, die Erhöhung der Richterbänke wird reduziert oder fällt in modernen Gerichtsbauten ganz weg. Die Architektur ebnet den Weg zur gleichberechtigten Kommunikation.
Anders als beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo das Gericht die Parteien agieren lässt und Distanz die höchste Tugend der Richterinnen und Richter ist, stehen Österreich und Deutschland mit ihren Strafprozessen nach wie vor in der Tradition des Inquisitionsverfahrens, mit einer starken Rolle der Richterinnen und Richter, die die Strafverhandlung über die Maßen zu dominieren scheinen. Dialoge und fruchtbringende Gesprächssituationen sind die Ausnahme. Dieses Festhalten an einem überholten Verfahrenskonzept mag die traditionell heftige Richterschelte in der deutschsprachigen Literatur erklären.
Die Gegenwartsliteratur scheint den Gerichtssaal etwas aus den Augen verloren zu haben. Das mag man bedauern, denn die literarische Beschreibung und Intervention dokumentiert nicht nur den Justizalltag einer bestimmten Zeit, sie kann auch Fehlentwicklungen aufzeigen und korrigieren helfen. Zolas Beschäftigung mit der Affäre Dreyfus oder Anatole France’ Erzählung „Crainquebille“ sind gute Beispiele dafür. Aus der jüngeren Justizgeschichte böten etwa die Polizei- und Justizverfahren der Operation Spring (1999/2000) ausreichend Stoff, fragwürdige gesellschaftliche und justizielle Entwicklungen zu bearbeiten. Im Jahr 1999 wurden in einem anlaufenden Wahlkampf in Wien mehr als hundert afrikanische Flüchtlinge festgenommen und in der Folge zu exemplarischen Gefängnisstrafen wegen Drogenhandels verurteilt. Die Verfahren wurden vielfach kritisiert, der schwerwiegendste Vorwurf war jener des rassistischen Behördenvorgehens. Noch immer harrt dieser Fragenkomplex einer bereinigenden Aufarbeitung.
Das spätere Tierschützerverfahren (die Ermittlungen begannen 2007, die letzten Freisprüche wurden 2014 rechtskräftig) und der Wiener Prozess gegen den Demonstranten Josef S. im Jahr 2014 werden wohl in Zukunft in einem Atemzug mit der Operation Spring genannt werden. Die sogenannte BVT-Affäre (2018) um die Hausdurchsuchung in einer Spezialbehörde ist demokratiepolitisch der wahrscheinlich dramatischste Sachverhalt. Alle diese Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von polizeilicher Seite mit Vehemenz vorangetrieben und im Falle der Operation Spring sowie des Tierschützerverfahrens auch noch im Stadium des Gerichtsverfahrens polizeilich dominiert wurden – unter Ausnutzung aller dramaturgischen Effekte, die der Verhandlungssaal zulässt. Das beginnt bei einem Spalier von Sicherheitsbeamten, durch den sich Besucherinnen und Besucher der Verhandlungen den Weg bahnen mussten, und endet bei Polizeischülern, die einen guten Teil der Zuhörerplätze im Verhandlungssaal füllten, sodass interessierten Bürgerinnen und Bürgern nur wenige Restplätze zur Verfügung standen. Die Verbindung von Gerichtssaal und Bühne wurde noch augenfälliger, als eine Polizeibeamtin hinter einem Vorhang aussagte, sodass nur ihr Schattenbild zu sehen war.
Während die überhöhte Rolle der Richterinnen und Richter im Gerichtssaal zunehmend in der Kritik steht und auf den Boden heutiger Realität geholt wird, nutzen umgekehrt die anderen Verfahrensbeteiligten den Verhandlungssaal immer mehr als Bühne. Der gesellschaftliche Trend zur permanenten Inszenierung des Banalen, zur täglichen Ausrufung des Spektakels macht vor den Toren der Gerichte nicht halt. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte trachten danach, sich als coole, moderne Ermittler im Sinne amerikanischer Fernsehserien in Szene zu setzen. Angeklagte versuchen, ihre Aussichten vor Gericht durch dramaturgische Effekte zu verbessern, und werden dabei von ihren Verteidigern tatkräftig unterstützt. Wir sehen Beschuldigte, die auf der Anklagebank wochenlang ihr krankes Bein hochlagern, Verdächtige, die ungeachtet ihres beträchtlichen Vermögens mit dem kleinsten am Markt befindlichen Wagen zur Vernehmung vorfahren, andere Angeklagte, die, bevor sie sich in der Gefängniszelle das Leben nehmen, ihre nationalsozialistischen Parolen ein letztes Mal im Gerichtssaal herausbrüllen. Auch den Angeklagten schadet letztlich die Überinszenierung. Die Öffentlichkeit liebt das Spektakel, doch übertriebene Selbstdarstellung ruft Missgunst auf den Plan und provoziert einen tiefen Fall.
Viele Rituale und Symbole des Gerichtssaals haben ihre Berechtigung, auch in der aufgeklärten Moderne. Die Robe macht Richterinnen und Richter als Vertreter der Staatsmacht, die ihre Gesetze umsetzt, erkennbar. Der Mensch tritt hinter der Rolle zurück. Die Überinszenierung freilich schadet auch im Fall des Gerichts. Es beschädigt das Ansehen des Staates, wenn sich Justizorgane überhöhen. In gewisser Weise jedoch werden die Verfahrensbeteiligten, die vor Gericht ihre Position durchbringen möchten und lange Aufgestautes erstmals vor einer staatlichen Autorität darlegen können, den Verhandlungssaal immer als Bühne, ja als ihre Bühne verstehen. Der Gerichtssaal wird seinen Charakter als dramatischen und dramaturgischen Ort so bald nicht verlieren.
Vom französischen Literaturnobelpreisträger Anatole France, insbesondere von seiner kurzen Erzählung „Crainquebille“, lässt sich zu Rechtsfragen viel gewinnen. „Crainquebille“ ist in seiner Schlichtheit wohl eine der großartigsten Parabeln zu Gerechtigkeit und Justiz. Der berühmte Rechtswissenschaftler Gustav Radbruch hat sich nicht von ungefähr in einem bekannten Zitat auf Anatole France bezogen: „Die großen Zweifler an der Wissenschaft und dem Werte des Rechts, ein Tolstoi, ein Daumier, ein Anatole France, sind für den werdenden Juristen unschätzbare Mahner zur Selbstbesinnung. Denn ein guter Jurist kann nur der werden, der mit schlechtem Gewissen Jurist ist.“
Anatole France (1844–1924) war zu seiner Zeit einer der führenden französischen Schriftsteller und Intellektuellen und erhielt 1921 als vierter französischer Autor den Literaturnobelpreis. Er wuchs als Sohn eines Buchhändlers in Paris auf. Im Alter von 37 Jahren gelang ihm mit dem Roman „Die Schuld des Professors Bonnard“ („Le Crime de Sylvestre Bonnard“) der Durchbruch als Schriftsteller. Politisch stand France in dieser Zeit noch den Konservativen nahe. Die Bedeutung, die Anatole France zu seinen Lebzeiten hatte, lässt sich heute nur mehr erahnen. Die Auswertung der Ausleihungen der Bibliotheken zeigt, dass France damals auch im deutschsprachigen Raum zu den meistgelesenen Autoren zählte. Zu seinem achtzigsten Geburtstag, 1924, wurde Anatole France mit Ehrungen überhäuft. Kurz darauf verstarb er. Er erhielt ein Staatsbegräbnis, an dem der Präsident der Republik und sämtliche Minister sowie zahlreiche Arbeiterführer teilnahmen. Einen Eindruck von der Einschätzung der Zeitgenossen vermittelt der Nachruf, der am 13. Oktober 1924 in der österreichischen Arbeiter-Zeitung erschien: „Eine Leuchte ist erloschen, deren Schein über den Erdkreis strahlte, eine Stimme verstummte, deren Klang die ganze zivilisierte Welt lauschte, ein Geist gebrochen, der ein Menschenalter hindurch unter den klarsten Geistern Europas glänzte.“ Vom „bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart“ spricht der Nachruf der Neuen Freien Presse.
1901 unter dem Titel „L’Affaire Crainquebille“ erschienen, erzählt die Novelle die Geschichte von Jérome Crainquebille, einem einfachen, wenig gebildeten Mann von etwas über sechzig Jahren. Sein ganzes Leben war er fahrender Gemüsehändler. Um fünf Uhr früh ersteigert er Gemüse auf dem Großmarkt, um dann den ganzen Tag seinen Gemüsewagen durch die Rue Montmartre zu ziehen.
Das Unglück des Gemüsehändlers beginnt, als er eines Tages auf eine Kundin wartet, die, um den Einkauf zu bezahlen, Geld aus ihrem Laden holt. Durch das längere Anhalten mit seinem Wagen verursacht Crainquebille in den Augen eines Polizisten („Der Polizist mit der Nummer 64“) einen kleinen Stau in der Rue Montmartre. Auf dessen Aufforderung hin weiterzugehen, erwidert Crainquebille, er müsse doch auf sein Geld warten. Der Polizist bildet sich fälschlicherweise ein, Crainquebille habe eine Beleidigung („Mort aux vaches! – „Tod den Bullen!“) geäußert und verhaftet den Gemüsehändler.
Crainquebille verbringt eine Nacht auf der Wache und wird dann ins Gerichtsgefängnis überstellt. Ihm wird ein Verteidiger beigestellt, die Gerichtsverhandlung findet bald statt. Obwohl ein angesehener Arzt als Zeuge für Crainquebille aussagt und dessen Unschuld deutlich wird, gibt der Polizist in der Verhandlung völlig unglaubhaft an, auch der Arzt habe ihn beleidigt. Der Richter folgt allein der Aussage des Polizeibeamten und verurteilt den Gemüsehändler zu zwei Wochen Haft und einer Geldstrafe.
Nach der Verbüßung der Haft zeigt sich, dass durch Mundpropaganda die Tatsache von Crainquebilles Gefängnisaufenthalt in der Rue Montmartre verbreitet worden ist. Die Kunden bleiben aus. Crainquebille beginnt zu trinken, lässt sich auf Streitigkeiten mit Kunden ein und verliert seine wirtschaftliche Existenz. Er übernachtete bis dahin in einem Verschlag; nicht einmal in diesem kann er jetzt mehr bleiben. Aus seinen ohnedies elenden Verhältnissen stürzt er weiter ab. Crainquebille verfällt auf die Idee, nun tatsächlich einen Polizisten zu beleidigen, um wenigstens in den Genuss der Grundversorgung eines Gefängnisses zu kommen. Aber auch hier scheitert Crainquebille. Der Polizist, an den er diesmal gerät, sieht von einer Anzeigeerstattung ab. Der Schluss der Erzählung ist trist, der Weg in den Selbstmord wird angedeutet: „Crainquebille senkte den Kopf und schritt mit hängenden Armen durch den Regen in die Dunkelheit.“
1903 gab France eine Version der Erzählung als Theaterstück heraus. Darin gestaltete er den Schluss positiver. An die Stelle des angedeuteten Suizids tritt die Einladung eines Waisenjungen, der Crainquebille ein Abendessen anbietet. Das Stück erlebte bereits am 24. November 1903 im Theater in der Josefstadt seine österreichische Uraufführung und wurde dort in der Folge weitere achtzehn Mal gezeigt.
1922/23 entstand nach dieser Erzählung ein Stummfilm nach einem Drehbuch und unter der Regie von Jacques Feyder. Maurice de Féraudy spielte die Hauptrolle. Das Ende des Films folgt der Theaterfassung: ein kleiner Junge tritt auf, der von allen „die Maus“ genannt wird. Ihm gelingt es, den alten Crainquebille vom Sprung in die Seine abzuhalten und wieder fröhlich zu stimmen. Die Authentizität des Maurice de Féraudy in der Rolle des Jérôme Crainquebille prägte eine ganze Generation französischer Schauspieler. Der Film gilt als eines der wichtigsten Werke der französischen Stummfilmära. Kopien verstreuten sich in alle Welt. Erst im 21. Jahrhundert konnte aus mehreren Fragmenten eine restaurierte Fassung mit einer Länge von 73 Minuten hergestellt werden. Sie wurde am 2. Juli 2005 im Pariser Jardin du Luxembourg im Rahmen des Sommerkinos uraufgeführt, begleitet von einem Orchester unter der Leitung von Antonio Coppola.
„Crainquebille“ zeigt eine Klassenjustiz, die völlig bedenkenlos im Sinne der Mächtigen agiert. Die Erzählung erschien, als die Dreyfus-Affäre auf ihren Höhepunkt zusteuerte, und ist zweifellos in deren Kontext zu sehen. Die Kritik am Justizsystem hat darüber hinaus aber allgemeine Gültigkeit, zeigt sie doch die Hilflosigkeit des einfachen, mittellosen und ungebildeten Menschen im Gerichtssaal, vor dessen Ritualen und der dort herrschenden abgehobenen Sprache. Interessant ist, dass Karl Kraus etwa zur selben Zeit seine Prozessbeobachtungen unter dem Titel „Sittlichkeit und Kriminalität“ veröffentlichte.
France’ Erzählung ist formal äußerst kompakt und kurzweilig. Die Sprache ist einfach, voll Ironie, Witz, Spott und Sarkasmus. Während der Autor mit diesen Mitteln Missstände anprangert, lässt er den einfachen, unter die Räder der Gesellschaft gekommenen Personen, wie hier dem Gemüsehändler Crainquebille, Wärme und Empathie zukommen. Der Autor ergreift die Partei der wirtschaftlich Schwachen, die unter den damaligen Verhältnissen kaum Möglichkeiten hatten, sich aus ihrem Elend zu befreien. Diese auch in den anderen Werken von France dominierende Grundhaltung machte ihn nach Émile Zolas Tod (1902) zur führenden Persönlichkeit unter jenen französischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die für eine gerechtere Gesellschaftsordnung ein- und gegen soziale Missstände auftraten.
Die Erzählung, der schon zitierte Schlusssatz der Urfassung macht es deutlich, enthält wenig Hoffnung. Der Romanist Thomas Baldischwieler bringt es im Nachwort der Reclam-Ausgabe auf den Punkt, wenn er davon spricht, dass die Geschichte um Crainquebille deprimierender als die Dreyfus-Affäre, trotz aller Anklänge an diese, sei, da Crainquebille nicht einmal begreife, dass er Opfer eines Justizirrtums geworden ist.
Crainquebille ist sich im Zuge seiner Auseinandersetzung mit dem Polizisten noch sicher, diesen nicht beleidigt zu haben. Beeindruckt von der Zeremonie der Verhandlung und der Ausstattung des Gerichtssaals, stellt sich bei ihm jedoch ein Schuldbewusstsein ein, das der Autor mit der Erbsünde vergleicht. Die Verurteilung wird für Crainquebille zu einem „hehren Mysterium“, zu einer „zugleich dunklen und einleuchtenden, herrlichen und schrecklichen Offenbarung“.
Der Justiz gelingt es, den unschuldigen Crainquebille allein schon mit ihrem Zeremoniell und ihren Ritualen zu erschlagen:
„Er war sich selbst nicht darüber klar, dass sich die Richter geirrt hatten. Das Gericht hatte seine geheimen Schwächen unter der Erhabenheit der Formen vor ihm verborgen. Er vermochte nicht zu glauben, dass er Recht haben sollte gegenüber Männern in der Robe, deren Rechtsgründe er nicht verstanden hatte: Unmöglich konnte er davon ausgehen, dass etwas an dieser schönen Zeremonie nicht in Ordnung sein mochte. Denn da er weder in die Messe ging noch im Élyséepalast verkehrte, hatte er im Leben noch nichts so Schönes gesehen wie diese Verhandlung vor der Strafkammer.“
Dieser kurze fünfte Abschnitt der Erzählung mit dem Titel „Von Crainquebilles Unterwerfung unter die Gesetze der Republik“ schließt an den ersten Abschnitt an, der nicht ohne Sarkasmus mit „Von der Erhabenheit der Gesetze“ bezeichnet wird. Hier, am Beginn der Erzählung, hebt der Autor das Einschüchternde an der Erscheinung von Gerichtssaal und Richtern hervor: die Verdienstorden, die der Richter in der Verhandlung trägt, die Büste der Republik und das Kreuz an der Rückwand des Verhandlungssaales. Crainquebille empfindet im Verhandlungssaal „den gehörigen Schrecken“, er ist, von Ehrerbietung durchdrungen, von Furcht und Schrecken überwältigt, bereit, die Entscheidung über seine Schuld ganz den Richtern anheimzustellen. Vor seinem Gewissen empfand er sich nicht als Verbrecher. Doch er spürte, wie wenig das Gewissen eines Gemüsehändlers im Angesicht der Symbole des Gesetzes und der Bevollmächtigten der rächenden Gesellschaft bedeutete: „In dieser Umgebung verschlossen ihm Ehrfurcht und Angst den Mund.“ In der Verfilmung der Erzählung wird die Übermacht des Gerichts mit – für die damalige Zeit beachtlichen – Trickeffekten versinnbildlicht, indem die Richter und der Polizeibeamte im Gerichtssaal zu Riesen werden.