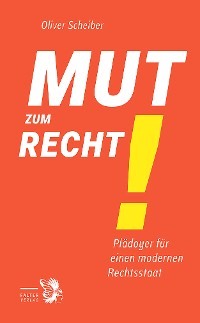Kitabı oku: «Mut zum Recht!», sayfa 4
THESE 1 
DIE KUNST LIEFERT DER JUSTIZ WICHTIGE IMPULSE
Die Kunst beschäftigt sich seit jeher mit den zentralen Fragen des Lebens. Viele Künstlerinnen und Künstler bearbeiten außerdem aktuelle Geschehnisse und Trends der Zeit. Die Justiz, die täglich ins Leben vieler Menschen eingreift und mit den Nöten der Menschen laufend konfrontiert ist, profitiert von einem Austausch mit der Kunst. Die Kunst spendet Anregungen und liefert vielfach eine Kritik, die sonst im Berufsalltag gegenüber Justizorganen nicht geäußert wird.
Die Justiz sollte die Vernetzung mit der Kunst als Tool für die Aus- und Fortbildung noch stärker nutzen. Die Kunst kann ein zentrales Element bei der Auseinandersetzung mit der richterlichen Tätigkeit sein. Je präsenter die Kunst in Gerichtsgebäuden und in der Aus- und Fortbildung der Richter*innen und Staatsanwält*innen ist, umso nachdenklicher und den Menschen zugewandter ist die Justiz. Als Beispiel dient Nikolaus Habjans Inszenierung „F. Zawrel“, die seit einigen Jahren in der Grundausbildung der Justiz eingesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern und Kunststätten liefert der Justiz Impulse und erweitert den Horizont der Einzelnen und des Systems.
2. Recht und Gerechtigkeit: Mission (im)possible?
Die Erzählung „Crainquebille“ hat uns einen exemplarischen Fall von Klassenjustiz gezeigt. Im folgenden Abschnitt wechseln wir von der Kunst zum Alltag der Gerichte. Wir wollen der Frage nachgehen, was Gerechtigkeit vor Gericht bedeutet und wie nahe die heutige Justiz diesem Anspruch kommt. Ein Blick auf Strukturen, Ressourcenverteilung und innere Kultur der Justiz wird uns zeigen, dass noch immer viel Luft nach oben besteht.
Bürgerinnen und Bürger erwarten von der Justiz Gerechtigkeit. Die öffentliche Diskussion, aber auch die Fachdiskussion, bemisst in der Regel an Urteilen, ob sie Gerechtigkeit herstellen. Es wird also vom Ende her gedacht. Verfahren dauern aber oft jahrelang. Zielführender ist die Betrachtung des Verfahrens als Ganzes; dabei darf nicht vergessen werden, dass es für den Verurteilten einen Unterschied macht, ob er drei oder fünf Jahre in Haft verbringen muss. Bei der Annäherung an Gerechtigkeit erscheint mir der Ansatz der Europäischen Menschenrechtskonvention der richtige: Dieses seit Jahrzehnten anerkannte und maßgebliche internationale Regelwerk stellt den Grundsatz des fairen Verfahrens in den Mittelpunkt. Gerechtigkeit wird in diesem Konzept vor allem durch Verfahrensgerechtigkeit erreicht. Wird ein Gerichtsverfahren fair abgewickelt, stößt es auf breite Akzeptanz bei den Beteiligten und bei der Öffentlichkeit. Das faire Verfahren hat wiederum viele Aspekte: Es geht darum, den Beteiligten ausreichend Recht auf Gehör zuzuteilen; also ihnen zuzuhören. Es geht um qualifizierte Dolmetschende, gut ausgebildete Sachverständige und kompetente Richterinnen und Richter.
Der Begriff der Gerechtigkeit überfordert, soll er mit Inhalten erfüllt werden, Juristinnen und Juristen genauso wie rechtliche Laien. Der unter diesem Stichwort angeführte Wikipedia-Eintrag definiert etwa, dass der Begriff der Gerechtigkeit einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders bezeichne, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gebe. Dieser hohe Anspruch wird wohl in keiner Gesellschaft, in keinem Land der Welt eingelöst. Es wäre vermessen, die vollständige Einlösung dieses Anspruchs von der Justiz zu erwarten. Viele Hindernisse pflastern den Weg zu gerechten Gerichtsentscheidungen: Unterschiede in Bildung, Vermögen oder Artikulationsfähigkeit wirken sich natürlich auf den Zugang zum Recht aus. Um diese Unterschiede auszugleichen, haben wir viele Krücken geschaffen, wie etwa die Verfahrenshilfe oder die Beiziehung von Dolmetschenden. Dennoch ist es eine große Herausforderung, auch für weniger gebildete oder vermögenslose Personen einen gleichen Zugang zu den Gerichten und gleiche Chancen vor Gericht sicherzustellen.
Der Weg zu einem guten, fairen Justizsystem führt über viele Stationen: Es geht um die Beseitigung vieler Hindernisse, um Offenheit, Transparenz und Öffnung zur Gesellschaft. Fehlende Evaluierungen stellen auf diesem Weg eine Schwierigkeit dar. Woran misst man, ob ein Justizsystem gerecht, ob ein Verfahren fair ist? Die Evaluierungssysteme von Europarat und EU, die sogenannten CEPEJ-Berichte bzw. das EU-Justizbarometer, stellen der österreichischen Justiz regelmäßig ausgezeichnete Bewertungen aus. Dabei werden vor allem Parameter wie die Verfahrensdauer und Effizienz gemessen. Die vergleichsweise geringe Quote an Urteilen, die mit Rechtsmitteln bekämpft werden, spricht tatsächlich für ein Funktionieren des Systems. Um die Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern abzutesten, müsste man verstärkt Befragungen einsetzen. Sie könnten Auskunft über die sozialen Kompetenzen der Richter und Richterinnen, der Staatsanwälte und Staatsanwältinnen geben, wenn es um Fragen wie Höflichkeit und Pünktlichkeit geht.
Auch wenn es bei der großen Mehrzahl der vielen Gerichtsverhandlungen, die täglich ablaufen, gelingt, den Menschen mehr oder weniger faire Verfahren mit einem sachgerechten Ergebnis zu bieten, lassen sich natürlich immer wieder einzelne Gerichtsverfahren unschwer als unbillig, ja grob ungerecht erkennen. Wenn wir unser System verbessern wollen, ist es wichtig, uns vor allem solche Verfahren anzusehen, die schiefgelaufen sind, Fehler zu analysieren und die Finger auf offene Wunden zu legen. Denn für die Justiz gilt Ähnliches wie für das Gesundheits- oder Bildungssystem: Österreich liegt gut, aber es bedarf neuer Wege und Strukturen, um auch in Zukunft zu den Besten zu gehören.
Zur zentralen Frage der Fairness des Verfahrens zählen die Beseitigung finanzieller Hürden – die österreichischen Gerichtsgebühren sind unter den höchsten in Europa – ebenso wie eine einfache Sprache und eine hohe Verständlichkeit in schriftlichen Erledigungen, bei Informationsmaterial und im Verhandlungssaal. Auch die Vertretung im Verfahren hat Bedeutung: Sollten nicht alle Verdächtigen im Strafverfahren durchgehend anwaltlich vertreten sein, um gleiche Verteidigungsmöglichkeiten vor Gericht zu garantieren? Wie sichern wir die Position verletzlicher Personengruppen (Alte, Kinder, psychisch Kranke, Fremdsprachige etc.) vor Gericht besser ab als heute? Was spricht gegen die Audio-/Videoaufzeichnung jeder gerichtlichen Vernehmung und Verhandlung als Qualitätssicherungsinstrument? Die Aufzeichnung schützt beide Seiten, Zeuginnen und Zeugen vor Unfreundlichkeiten und die Richterinnen und Richter vor Unterstellungen.
Die Verbindung von Recht und Gerechtigkeit gelingt eher dann, wenn Gleiches gleich behandelt wird und wenn die Verhältnismäßigkeit das staatliche Handeln bestimmt. Das Rechts- und Justizsystem wird umso eher als gerecht empfunden, je weiter es von einer Klassenjustiz entfernt ist. Gibt es sie (noch), die Klassenjustiz? Ja, es gibt diese Zweiklassenjustiz. In derselben Weise, wie es eine Zweiklassenmedizin gibt. Wer mehr Geld hat, wird sich besser verteidigen bzw. vertreten lassen können. Der Arme wird leichter in die Fänge von Polizei und Justiz geraten, da die Ressourcen nach wie vor primär in die Verfolgung von Bagatellkriminalität fließen.
Nehmen wir Fälle, wie sie im Gerichtsalltag vorkommen: In Wien gibt es eine überschaubare, aber doch nicht ganz kleine Gruppe von Menschen, die aus Pakistan und Indien zugewandert sind. Am Arbeitsmarkt sind sie zu einem guten Teil in den Bereichen der Kolportage, der Zustellung und Auslieferung (Pakete, Werbematerial, Essen) und im Rosenverkauf tätig. Diese Tätigkeiten gehören zu jenen mit den niedrigsten Einkommen. Die Austräger von Werbematerial benutzen zum Großteil ihre eigenen alten Mopeds für den Job. Sie sind oft formell selbstständig, obwohl sie de facto in völliger Abhängigkeit ihres Auftragsunternehmens arbeiten. In den letzten Jahren kommt es in Wien vermehrt zu Anzeigen gegen diese pakistanischen und indischen Austräger. Anlässlich des Umschreibens ihrer indischen oder pakistanischen Führerscheine auf österreichische Lenkberechtigungen oder anlässlich von Verkehrskontrollen erstattet die Polizei Anzeige, dass der Führerschein aus dem Heimatland mutmaßlich gefälscht sei. Eine Zusammenarbeit mit den indischen und pakistanischen Behörden wird entweder erst gar nicht versucht oder sie funktioniert nicht, weil die ausländischen Behörden nicht antworten. Ob der indische/pakistanische Führerschein regulär erworben wurde, lässt sich also kaum feststellen. Die Männer (Frauen sind in diesem Segment kaum tätig) werden oft angeklagt und stehen dann vor Gericht. Vor Gericht sagen sie in der Regel aus, den Führerschein auf normalem Weg und ordnungsgemäß in ihrer indischen oder pakistanischen Heimat erworben zu haben. Als sich diese Fälle häuften, habe ich in einer Verhandlung die selbst aus Indien stammende Dolmetscherin dazu befragt, wie sie die Situation einschätzt. Die Dolmetscherin hat mir erklärt, dass das Behördenwesen in Indien dermaßen korrupt sei, dass praktisch niemand auf völlig regulärem Wege den Führerschein erlangt. Vielmehr sei es üblich, dass die Prüfer oder Fahrschulen Bestechungsgelder verlangen und erst dann einen Führerschein aushändigen. Die nötigen Fahrstunden würden oft absolviert, manchmal auch nicht. Aufgrund der Vorgangsweise der Prüfer sei ein Ablegen der Prüfung nach europäischem Muster kaum möglich und der Ausnahmefall. Tatsächlich wird in vielen solchen Fällen aus verschiedensten Gründen keine Strafbarkeit eingetreten sein. Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, warum der Staat so viel an Energie und Ressourcen in die Verfolgung solcher Delikte steckt, deren Unrechtsgehalt und Störwert für die Gesellschaft minimal ist. Denn die betroffenen Personen können Moped fahren und fahren seit Jahren Moped, sie haben in der Regel eine Fahrausbildung in ihrer Heimat gemacht und müssen anlässlich der nötigen Umschreibung ihres Führerscheins in der EU ohnedies die praktische Fahrprüfung nochmals ablegen.
Ein ähnliches Muster zeigen Strafverfahren gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reinigungs- und Schneeräumungsdiensten. Immer mehr Hauseigentümer und Hausverwaltungen räumen den Gehsteig im Winter nicht selbst vom Schnee, sondern beauftragen einen privaten Winterdienst. Oft entsteht eine längere Kette von Subunternehmern. Am Ende steht wieder eine Einzelperson, formell selbstständig, tatsächlich abhängig, die von ihrem Auftraggeber eine so große Zahl an Liegenschaften zugewiesen erhält, dass sie bei einem nächtlichen Wintereinbruch die Schneeräumung in der vorgeschriebenen Zeit unmöglich bewerkstelligen kann – lehnt sie das ab, verliert sie den Job oder den Auftrag. Rutscht dann ein Passant oder eine Passantin auf dem nicht geräumten Gehsteig aus und verletzt sich, kommt es zu einem Strafverfahren – die Staatsanwaltschaften klagen in aller Regel das letzte Kettenglied an. Was zwischen den einzelnen Ebenen genau besprochen und ausgemacht wurde, lässt sich in der Regel kaum feststellen. Außerdem sprechen die Menschen am Ende der Kette oft nicht sehr gut Deutsch. Meist ist es fraglich, ob sie zu ihren Verpflichtungen und Aufgaben beziehungsweise über gesetzliche Bestimmungen, deren Verletzung man ihnen am Ende vorwirft, überhaupt in einer ordentlichen Form belehrt worden sind.
Ähnliches kann man im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen am Bau beobachten. Immer wieder sterben in Wien Personen, die bei Gerüstarbeiten oder Dacharbeiten nicht vorschriftsmäßig gesichert sind und abstürzen. Geht es um die strafrechtliche Klärung der Verantwortung, wird die Verantwortung innerhalb der Großunternehmen hin und her geschoben, ebenso zwischen General- und Subunternehmen. Strafrechtlich angeklagt werden oft wieder Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der untersten Ebene, die auf derselben oder gerade eine halbe Stufe über den Verunfallten eingeordnet sind.
Nehmen wir als letztes Beispiel, weil es besonders anschaulich ist, Strafsachen nach dem Lebensmittelgesetz. Werden verdorbene Lebensmittel verkauft, ist das unter gewissen Bedingungen strafbar. Viele Jahre lang wurden diese Strafbestimmungen von den Staatsanwaltschaften so gehandhabt, dass, wenn etwa in einem großen Supermarkt verdorbenes Obst oder verdorbene Süßspeisen verkauft wurde, nicht etwa Filialleiter bzw. Filialleiterin oder Regionalverantwortliche belangt werden, sondern die jeweiligen Verkäuferinnen und Verkäufer oder Regalbetreuer im Supermarkt. Freilich hatten diese Personen in der Regel keine Kompetenz, die Entfernung der Ware aus den Regalen zu bewirken.
Die Strafjustiz greift also gern auf die Kleinen zurück. Warum aber ist das so? Muss es so sein? Rechtlich ganz sicher nicht. Dem europäischen Trend entsprechend erhielt Österreich bereits 2005 ein Unternehmensstrafrecht. Nicht nur natürliche Personen können seither strafrechtlich angeklagt werden, sondern eben auch Unternehmen. Stürzt ein Bauarbeiter ungesichert vom Dach, müssen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht lange ermitteln, wie die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb des Bauunternehmens verteilt waren. Das Unternehmen hat sich jedenfalls strafbar gemacht und kann nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz angeklagt werden. Dieses Gesetz wird allerdings sehr selten angewandt. Dabei hätte seine regelmäßige Anwendung viele positive Effekte – man erhielte statistisch eine bessere Übersicht, wie oft einzelne Unternehmen das Strafrecht verletzen. Wird die Strafkarte eines Unternehmens länger, läge es nahe, ihm die Gewerbeberechtigung zu entziehen und es von öffentlichen Aufträgen auszuschließen. Das Verfolgen kleiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet auch, dass sich an den Strukturen, die zu Unfällen und Gesetzesverstößen führen, nichts ändert. Es werden Menschen bestraft, die keinen oder wenig Einfluss auf die Abläufe haben; Unternehmen können sich in der Gewissheit wiegen, dass Schlampereien für sie keine Folgen haben. Auf einer Großbaustelle kann aufgrund struktureller Nachlässigkeiten, zu geringer Sicherheitsvorkehrungen, zu großem Zeitdruck einiges an Unfällen passieren. Mehrere kleine Abschnittsverantwortliche erhalten vielleicht Vorstrafen, während Unternehmen und ihre Vorstände unbehelligt bleiben.
Oder ein anderes Beispiel zum Thema Klassenjustiz: Angeklagt war ein Mann wegen Sachbeschädigung. Er soll bei einem parkenden Auto die Luft aus den Autoreifen gelassen haben, sodass schließlich die Felgen kaputt gingen. Die Hauptverhandlung ergab dann ein etwas umfassenderes Bild des Hintergrundes. Der Autobesitzer, ein Jurist, wurde im Verfahren als Opfer geführt. Der etwa fünfundvierzig bis fünfzig Jahre alte Mann hatte, wie er selbst sagte, seinen Wagen vorschriftswidrig auf einem Behindertenparkplatz geparkt, um seine junge Freundin zu besuchen. In der Verhandlung beklagte der Jurist die Parkplatzmisere. Das Parkpickerl sei ein echtes Ärgernis. Um in verschiedenen Bezirken Wiens billiger parken zu können, habe er mittlerweile seine diversen Autos auf verschiedene Freundinnen angemeldet. Da damals vor dem Haus seiner Freundin kein Parkplatz frei gewesen sei, habe er das Fahrzeug eben auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Er sei ohnedies bald zurückgekommen.
Der Angeklagte, der die Luft aus den Reifen gelassen haben soll, hätte wohl über ein gutes Motiv verfügt: Es handelte sich um den Sohn jenes Behinderten, für den der Parkplatz extra ausgeschildert war. Der Mann bestritt allerdings die Tat. Es stand Aussage gegen Aussage: Der Angeklagte behauptete, er habe ein Zischen bei den Reifen gehört und habe sich das näher angesehen. Tatsächlich sei Luft aus den Reifen entwichen, er selbst habe die Reifenventile aber nicht geöffnet, dies ginge bei diesem Fahrzeugmodell gar nicht ohne ein Spezialwerkzeug. Der Jurist sei aber zu ihm gekommen, habe sich sehr aggressiv verhalten, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und dabei auch verletzt. Tatsächlich wies der Mann auch recht erhebliche Kratzspuren im Hals- und Schulterbereich auf, die von der Polizei mit Fotos dokumentiert worden waren. Der Autobesitzer dagegen behauptete, er habe den Mann dabei erwischt, wie dieser gebückt bei den Reifen stand. Ganz offensichtlich habe der Angeklagte die Reifenventile geöffnet.
Allerdings gestand auch der Jurist zu, dass man die Reifenventile nur mit Spezialwerkzeug öffnen konnte. Während die Polizei noch Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den einen Mann und wegen Körperverletzung gegen den zweiten Beteiligten, den Juristen, erhoben hatte, stellte die Staatsanwaltschaft das Körperverletzungsverfahren gegen den Juristen ein. Gegen den bereits vorbestraften zweiten Beteiligten wurde jedoch Anklage wegen Sachbeschädigung erhoben. Das Strafgericht hatte in diesem Fall also nur mehr ganz isoliert die Frage der Sachbeschädigung zu beurteilen. Und doch geraten Opfer- und Täterrolle durcheinander, stellt sich die Frage, wer nun primär Geschädigter ist, wenn die als Opfer geführte Person selbst mehrere Gesetzesverstöße zugibt und als selbstverständlich und ohne jedes Unrechtsbewusstsein referiert, dass er Autos auf mehrere Freundinnen anmeldet, um Parkpickerl für mehrere Wiener Gemeindebezirke zu bekommen und bei Parkplatzmangel einfach Behindertenparkplätze in Anspruch nimmt. Wie ist es zu erklären, dass gleichzeitig die zahlreichen Kratzwunden beim anderen Beteiligten nicht vor Gericht abgehandelt werden?
Die angeführten Beispiele zeigen die Neigung der Strafjustiz, bei der Verfolgung von Delikten auf die zuzugreifen, von denen am wenigsten Widerstand zu erwarten ist. Man belangt jene, die sich nicht gut artikulieren können, weil sie schon die das Verfahren einleitenden Schriftstücke von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht nur unzureichend verstehen, weil sie nicht die finanziellen Mittel für eine anwaltliche Vertretung haben. Und so stecken Polizei und Justiz viel an Ressourcen in die Bekämpfung von Kleinkriminalität und die Verfolgung der untersten Verantwortungsebene, die das Geschehen nicht wesentlich mitbestimmt. Kriminelle Strukturen bleiben so unbehelligt. Für die Gesellschaft weit schädlichere Verhaltensweisen werden strafrechtlich nicht verfolgt, entweder weil die Ressourcen sich in der Bekämpfung der Bagatellkriminalität erschöpfen oder weil der politische Wille für die strafrechtliche Auseinandersetzung mit finanziell und politisch Mächtigeren fehlt. Es ist dies freilich kein neues oder an ein bestimmtes Land gebundenes Phänomen, sondern eine globale, konstante Schwäche des Strafrechts. Und doch finden wir immer wieder Beispiele einer effizienten Strafgerichtsbarkeit, die zeigt, dass es auch anders ginge – man denke nur an die Aufarbeitung der politischen Korruption in Kärnten, an das Strafverfahren gegen die Führung des Fußballklubs Bayern München oder US-amerikanische Strafverfahren im Zusammenhang mit der Manipulation von Autoabgastests.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Justiz das Recht ungeachtet der Person nach der Schwere der Störung anwenden soll, und weiters davon, dass das Strafrecht vor allem zur Ahndung der schweren Verstöße gegen das menschliche Zusammenleben gedacht ist, dann müssen wir uns ansehen, wo vielen Menschen große Schäden drohen oder entstehen. Wir landen schnell bei der Umwelt- und Finanzkriminalität. Die Wiener Soziologin Laura Wiesböck hat zuletzt eindringlich auf die Dimension der Finanzkriminalität aufmerksam gemacht. Der jährliche Schaden für die Republik durch Steuerhinterziehung und Steuerbetrug beträgt rund 2,9 Milliarden Euro, das entspricht rund einem Prozent des BIP. Wiesböck kommt bei einer Schätzung der Schäden durch die Finanz- und Wirtschaftskriminalität auf rund ein Sechstel (15 Prozent) des Bruttoinlandsprodukts, was eine gewaltige Dimension bedeutet.
Umweltkriminalität wiederum ist heute dafür verantwortlich, dass in ganzen Regionen das Trinkwasser vergiftet ist, die Böden landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar sind oder die Lebenserwartung Hunderttausender binnen weniger Jahre markant sinkt. Umweltverbrechen werden weltweit kaum ernsthaft geahndet. Verantwortlich sind meist Konzerne, mit denen sich die staatlichen Strafverfolgungsbehörden nicht anlegen. Stattdessen verweisen die Staatsanwaltschaften in der Regel auf die Schwierigkeit der Strafverfolgung, den nicht belegbaren Kausalzusammenhang, und legen in solchen Fällen an die Beweisbarkeit so strenge Maßstäbe an wie bei keinem Kridadelikt eines Kleinunternehmens und keinem Drogengeschäft von Kleinkriminellen.
Schließlich geht es oft nur um den Einsatz der richtigen Mittel. Telefonüberwachungen sind bei der Bekämpfung des Drogenhandels ein Routineinstrument. Würde man diese Überwachungen und zusätzlich verdeckte Ermittler bei der Umwelt- und Finanzkriminalität ebenso konsequent einsetzen, würde man schnell fündig werden und gute Beweisergebnisse erzielen. Letztlich ist es auch bei der Drogenkriminalität so, dass vor allem wirtschaftlich schwache Drogenabhängige verfolgt werden, die auf der Straße leben und dort ihren Stoff kaufen. Ebenso viele Abhängige und Händler ließen sich in den Clubs und In-Lokalen finden. Nur wird dort nicht mit so vielen verdeckten Fahndern nach ihnen gesucht. Aus zwei Gründen: Zum einen greift die Polizei vor allem auf jene Drogenkonsumentinnen und -konsumenten zu, die in den Augen der Öffentlichkeit und des Boulevards ein Ärgernis sind, also etwa in den U-Bahn-Stationen aufhältige Drogenkranke. Die koksende Rechtsanwaltskonzipientin oder der heroinabhängige Kreativdirektor stört in der Regel die Öffentlichkeit nicht. Zum anderen geht es wieder darum, dass der Junkie von der Straße das einfachere Gegenüber ist, er wird sich selten wehren oder etwas einfordern.
Große Kriminalitätsfelder werden mangels Interesses oder Kompetenzen der Justiz weitgehend schadlos gehalten. Das gilt etwa für die gesamte Bilanz- und Börsenkontrolle. Gesetzesverstöße bleiben ohne ernsthafte Sanktionen und ermöglichen die Anlegertäuschung. Die vor einigen Jahren beschlossene neue sogenannte Bilanzpolizei wird daran wenig ändern: Entdeckte Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften werden nicht zwingend veröffentlicht. Gerade das wäre aber der Sinn der Ermittlungen: Der Schutzzweck des Gesetzes wird völlig dadurch unterlaufen, dass man nur veröffentlichen kann, aber nicht muss. In Deutschland werden alle Verstöße veröffentlicht; Transparenz ist eben auch hier ein Schlüsselelement.
Ein anderer Bereich, in dem Korruption unbehelligt bleibt, ist der Sektor Medizin/Pharmazie. Die Ärzteschaft hat hierzulande geradezu eine Bedienungsanleitung für Korruption zur Hand. Pharmafirmen finanzieren nicht nur Medizinzeitschriften, sondern auch medizinische Kongresse, ärztliche Fortbildungsveranstaltungen und sogenannte Qualitätszirkel. Diese Veranstaltungen finden bevorzugt an attraktiven Reisezielen statt. Reise- und Aufenthaltskosten werden von jenen Pharmaproduzenten bezahlt, die ihre Produkte an die versammelte Ärzteschaft verkaufen wollen. Diese Anfütterung im klassischen Sinn ist noch dazu durch gesetzliche Ausnahmeregelungen im Medizinrecht zulässig. So überträgt das Ärztegesetz der Ärztekammer die Organisation von Fortbildungsveranstaltungen. Die Verordnung der Ärztekammer über ärztliche Fortbildung aus dem Jahr 2010 ermöglicht die Kooperation von ärztlichen Fortbildungsanbietern mit an der Fortbildung interessierten Organisationen, Einrichtungen und Dritten (Sponsoren), welche einen Beitrag zur Entwicklung der medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildung leisten. Im Kommentar zur Verordnung heißt es, der Sponsor, das ist in der Regel eine Pharmafirma, könne das Fortbildungsthema bestimmen. Gleichzeitig verlangt die Verordnung jedoch, Inhalte ärztlicher Fortbildung unabhängig von wirtschaftlichen Interessen Dritter zu halten und die Zusammenarbeit zwischen Sponsor und ärztlichem Fortbildungsanbieter so zu gestalten, dass das Patientenwohl und die Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit nicht gefährdet oder beeinflusst werden – die Quadratur des Kreises. Anschaulich wird die Problematik durch die Zahl der Pharmavertreter: 4000 Pharmareferentinnen und -referenten kümmern sich um 8000 niedergelassene österreichische Ärztinnen und Ärzte. In der Schweiz und in Deutschland wird dieses enorme Korruptionsfeld – der Schaden durch Korruption im Gesundheitswesen wird in Deutschland mit jährlich 18 Milliarden Euro (10 % aller Gesundheitsausgaben) geschätzt – immerhin bereits diskutiert. In Österreich wird das Thema bisher weitgehend totgeschwiegen. 2013 hat die NGO Transparency International das Thema aufgegriffen und von einer „Kuvert- und Zweiklassenmedizin“ in Österreich gesprochen. Die geschilderten Rahmenbedingungen führen außerdem dazu, dass die Pharmafirmen die Forschung auf jene Felder leiten, die medikamentenintensiv sind und die höchsten Umsätze erwarten lassen. Forschungsbereiche, die für die Patientinnen und Patienten wichtiger sind, aber wirtschaftlich weniger attraktiv – weil Prävention oder Operation hier besser wirken – werden vernachlässigt. Dies illustriert, welche gesellschaftlichen Schäden aus korrupten Strukturen entstehen.
Ein staatlich geduldetes Korruptionsszenario liegt auch in der durch die Krankenzusatzversicherungen verursachten Zweiklassenmedizin mit intransparenten Operationswartelisten und übermäßigen Nebentätigkeiten der Primarärztinnen und Primarärzte in Privatspitälern. An öffentlichen Spitälern angestellte Medizinerinnen und Mediziner sind nicht selten an Privatkliniken beteiligt, die Nutzung öffentlicher Gesundheitsdienste für Privatversicherte ist die Folge. Teure Untersuchungen erfolgen über die Infrastruktur des öffentlichen Spitals, hohe Honorare werden in der Privatordination bezahlt.
All dies führt uns zu dem Befund, dass wirtschaftlich und sozial Schwache ungeachtet der Schwere und Dimension ihrer Straftat ein hohes Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung haben. Denn Polizei und Justiz konzentrieren sich auf die Verfolgung sozial und wirtschaftlich schwacher Menschen bzw. jener Kriminalitätsfelder, die für sozial und wirtschaftlich Schwache naheliegend sind. Nur ein System, das den Fokus auf die Verfolgung von Ladendiebstählen oder Drogenkonsumenten legt, kommt auf eine hohe Zahl an Anklagen gegen sozial Schwache. Würde man dagegen Finanz- und Umweltverbrechen zur Priorität der Strafjustiz machen, was ja (ethisch und volkswirtschaftlich), bedenkt man deren gesellschaftliche Folgen und Dimension, sinnvoller wäre, stünde man vor ganz anderen ‒ gebildeten, sozial gut vernetzten und wirtschaftlich starken ‒ Tätergruppen. Das ist ungemütlicher.
Die vorrangig verfolgten sozial Schwachen haben meist ein chronisch schlechtes Gewissen, sie leisten keine Gegenwehr. Wird gegen Mächtige ermittelt, sinkt, verkürzt und plakativ gesagt, die Arbeits- und Lebensqualität der Ermittler. Eine gute Rechtsvertretung schreitet ein, das Gericht steht im Licht medialer Aufmerksamkeit. Jeder Schritt, jede Einvernahme muss von Polizei und Staatsanwaltschaft wesentlich akribischer vorbereitet werden. Aufgrund der guten anwaltlichen Vertretung ist bei der Strafverfolgung der wirtschaftlich potenten Verdächtigen die Erfolgsquote geringer und das Risiko für die Ermittler höher. So bleibt es beim falschen Ressourceneinsatz. Kommt es doch zur Anklage von politisch und wirtschaftlich Mächtigen, dann hatten solche Anklagen in den letzten Jahren vor den Gerichten in der Regel Bestand. Die Gerichte hatten dank ihrer Unabhängigkeit keine Scheu, Mächtige zu verurteilen.
Wir verfolgen also mit dem Strafrecht allzu oft nicht die richtigen Delikte. Nach den rechtstheoretischen Vorstellungen ist das Strafrecht das schärfste Mittel des Staates; es sollte den schwersten Verstößen gegen das gesellschaftliche Zusammenleben vorbehalten sein. Wenn wir kranke Menschen wegen eines kleinen Diebstahls bestrafen, dann findet dieses Handeln nur Legitimität, wenn wir entsprechend scharf gegen die wirklich schweren Verbrechen vorgehen. Dabei versagt der Staat im Großen und Ganzen; Österreich genauso wie die meisten anderen Staaten. Der Grund dafür liegt wohl in der globalen Dominanz der Finanz- und Wirtschaftswelt über die Politik. Die Ressourcen werden also falsch eingesetzt, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte werden falsch ausgebildet, nämlich zur Verfolgung von Kleindieben und Drogenkranken statt zur Verfolgung von Finanz- und Umweltverbrechen. So entsteht eine zynische Klassenjustiz. Dass sich diese sehr wohl aufbrechen ließe, zeigt die Korruptionsbekämpfung in Österreich. Als die Politik vor rund zehn Jahren die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Korruption zum Ziel erklärt und eine Spezialbehörde eingerichtet hat, kamen die Strafverfahren auf diesem Gebiet in Gang. Noch nicht in ausreichender Zahl und auch die Geschwindigkeit lässt zu wünschen übrig, aber immerhin. Man wüsste also, wie es geht, wollte man Finanz- und Umweltverbrechen ernsthaft bekämpfen.
Die eingangs dieses Abschnitts angesprochene Öffnung der Justiz meint auch einen neuen Umgang mit Politik und Medien. Das Verhältnis von Justizressort und Richterschaft zur Politik ist weiterhin von Abgrenzung geprägt. Diese ist notwendig, wenn es um die Abwehr parteipolitischer Einflussnahme geht. Sie ist verfehlt, wenn dadurch der Austausch zwischen Politik und Justiz unterbleibt. Auch Parlamentsabgeordnete können nur dann kompetent über justizpolitische Fragen entscheiden, wenn ihnen gute Informationen zur Verfügung stehen, wenn sie also auch von Justiz und Berufsvertretungen aus erster Hand und regelmäßig über die Herausforderungen, Sorgen und Bedürfnisse der Gerichtsbarkeit informiert werden. Justiz und Politik müssen sich hier auf Augenhöhe begegnen. Politische Arbeit, sei es in der Exekutive oder im Parlament, sollte anerkannt werden. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse als wichtiges politisches Aufklärungselement in der Demokratie verdienen Unterstützung und Respekt der Justiz.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.