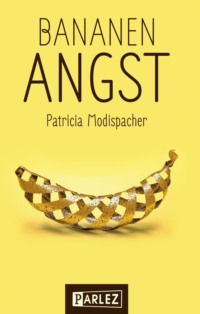Kitabı oku: «Bananenangst», sayfa 3
„Kommst du mit, Scarlett?“
„Was?“
Neben dem Adlerauge, mir schräg gegenüber, aß Penelope ihre Vollkornbrote. Sie war außergewöhnlich schön. Nicht nur hübsch. Nein, schön. Ihr Wesen strahlte eine besondere Wärme aus, die ich in dieser Form bisher noch nicht bei vielen Menschen erleben durfte.
„Mittwochs wird immer in der Kapelle gesungen. Zwei ehrenamtliche Frauen mit Gitarre und Klavier begleiten alle Patienten, die mitsingen wollen. Jeder darf kommen, sich ein Gesangbuch schnappen und mitmachen. Man kann sich sogar Lieder wünschen. Pascal und ich und ein paar andere gehen immer hin. Magst du nachher mitkommen?“ Mein Herz überschlug sich fast bei dem Gedanken, meinen ersten Abend nicht allein verbringen zu müssen, sondern direkt Anschluss an die Gruppe zu erhalten. Die letzten Monate hatte ich mich immer mehr von meinen Freunden distanziert, mich ganz der Beziehung zu meiner Essstörung hingegeben. Die Einsamkeit fraß mich und meinen Appetit auf. Dass ich mich nach menschlicher Nähe sehnte, war mir schon vor einiger Zeit klargeworden. Wie ich das ändern sollte, war mir jedoch schleierhaft. Immerhin war ich vielbeschäftigt. Ich musste lernen, Sport treiben und mein gesundes Essen intensiv planen. Für Freunde hatte ich einfach keine Zeit mehr gehabt.
„Es sind natürlich christliche Lieder. Das gefällt nicht jedem …“
„Das macht nichts, ich liebe es zu singen und komme gerne mit.“
Sie lächelte mir zu, aber ihre Augen blieben glanzlos und ich fragte mich, warum sie hier war. Nicht, warum sie an dem Tisch war, ich wollte über niemanden urteilen. Essstörungen treffen die verschiedensten Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen und wirken sich auf viele Arten aus. Aber meistens hat es etwas mit Selbstverachtung oder Vernachlässigung zu tun. Penelope war aber bildhübsch und was ich bisher von ihrem Lebenslauf erfahren hatte - Studentin der Physik, Hund, Freund, Ehrenamt - schien sie sehr erfolgreich und intelligent zu sein. Warum war sie nicht glücklich? Warum war sie nicht zufrieden mit sich, so schön und klug, wie sie war?
„Die Uhr“, sagte Herr Specht, die heutige Essbegleitung. Tatsächlich hatten wir nur noch vier Minuten Zeit. Penelope hatte noch ein halbes Brot, das sie schweigend und mit leerem Blick nun schneller kaute. Ich hatte mein Brot bisher nicht angerührt. Aber ich wollte gesund werden. Deswegen nahm ich das Brot in die Hand. Wie lange war es her, dass ich Brot gegessen habe? Gar nicht so lange. Es war vorgestern gewesen. Eine Viertel-Scheibe. Dazu eine riesige Schüssel Salat. Ich konnte Brot essen. Ich war stark. Von einem Bissen Brot würde ich nicht zunehmen. Und eigentlich wollte ich zunehmen. Mein Kampf mit meinen Gedanken machte mich fertig. Die Uhr zeigte noch 30 Sekunden an. Da musste ich an meine Mutter denken, holte tief Luft, biss ab und kaute. Langsam zermahlten sich die Körner in meinem Mund und das trockene Brot wurde zu Brei. Eigentlich ganz lecker, das Vollkornbrot. Nein! Es darf nicht schmecken! Es schmeckt nicht! Aber irgendwie doch? Ich schluckte und die Zeit war vorbei. Ich habe verloren, denn ich habe nicht die volle Portion geschafft. Aber ich habe auch gewonnen, denn ich habe mich überwunden.
„Bereit für den Blitz?“, fragte Herr Specht und ich bekam den nächsten Schub Aggressionen. Der Blitz war das Schlimmste, was die Menschheit bis dato erfunden hatte. Wahrscheinlich ging es auch um die Kopplung von Gefühlen und Essen und Hass. Oder aber die Krankenpfleger geilten sich an unseren depressiven Gedanken auf. Oder benutzten das erlangte Wissen, um schlechte Bücher über Depressionen zu schreiben. Vielleicht traf alles zu.
„Wer möchte begi-“
„Also ich bin total genervt“, fiel Lisa Herrn Specht ins Wort. „Ewig und drei Tage hier rumzusitzen und denen beim Essen zuzusehen. Was für eine Zeitverschwendung.“
„Frau Holz“, begann Herr Specht in einer Tonlage, die man sonst nur bei Kindern, Tieren oder Geistesgestörten benutzt. Dann fiel mir ein, dass wir alle hier wohl geistesgestört waren. Oh Mann. „Sie wissen, dass sich das Sättigungsgefühl erst nach etwa zwanzig Minuten einstellt. Diese Zeit sollten Sie mindestens für Ihr Essen brauchen. Sie waren heute noch etwas zu schnell.“
„Wenigstens esse ich meine Portion und sitz nicht einfach nur blöd rum und-“
„Frau Holz, Sie kommen nachher noch ins Pflegebüro.“ Sein Tonfall war plötzlich sehr bestimmt und er gab das Wort an Pascal weiter. Auch, wenn er sie unterbrochen hatte, ist mir nicht entgangen, dass Lisa mich meinte. Dass sie mich angegriffen hatte. Dass ich ein Störenfried war. Dass meine Anwesenheit sie belästigte. Warum war ich hier? Warum war ich überhaupt am Leben? Wenn ich doch nur eine Last war?
„Ich habe alles gegessen und bin pappsatt“, lachte Pascal und rieb sich über den Bauch. „Das wird wieder eine schwierige Nacht werden.“
„Wenn Sie Schmerzmittel brauchen, dann-“
„Bisher tut’s auch die Wärmeflasche, danke.“
„Frau Samt?“
„Also, ich habe alles gegessen. In der richtigen Zeit“, sagte Penelope kurz und knapp.
„Und das Sättigungsgefühl?“
Sie lachte unbeholfen, biss sich auf die Unterlippe und nickte. „Is okay.“
„Es wird sich bald einstellen“, meinte Herr Specht und stützte sein Kinn auf den Ellbogen ab. „Sie sind auf einem sehr guten Weg. Denken Sie zurück, wie Sie vor drei Wochen hier ankamen und-“
„Ja, ja. Ich hab doch gesagt, is okay.“ Penelope klang nicht verärgert, aber bestimmt. Sie zog die Hände unter den Tisch und meine Erfahrung sagte mir, dass sie sich gerade entweder kratzte oder kniff.
„Frau Schweighart? Wie geht es Ihnen jetzt nach dem Essen?“
„Nicht gut“, antwortete ich knapp. Noch wusste ich nicht, wie ausführlich ich meinen Selbsthass in diesem Rahmen schildern sollte oder wollte.
„Sie haben nicht die vereinbarte halbe Portion gegessen.“
„Nein.“ Die zwei Butterpackungen neben meinem Teller lachten mich aus. Auch das Vollkornbrot verhöhnte mich. „Aber ich hab mich bemüht.“
„Und darauf kommt es an. Aller Anfang ist schwer. In ein paar Tagen schaffen auch Sie eine volle Portion.“
Wollte ich überhaupt eine volle Portion „schaffen“? Wollte ich mir 20 Gramm Butter reinpfeifen?
Nach dem Blitz standen wir auf und mussten den Tisch abräumen. Lisa stellte nur ihren Teller in die Spüle und verschwand. Ich sah ihr hinterher, Pascal lachte aber nur und rieb mir über den Oberarm.
„Wundere dich nicht, Liebes. Lisa ist etwas speziell.“
„Und lass dich nicht von ihrem bösen Blick oder ihren Kommentaren runterziehen“, ergänzte Penelope. „Oder von der Art, wie sie frisst.“
„Penelope!“
Sie verdrehte die Augen. „Essen. Wie sie isst. Fressen soll man nicht sagen. Hast ja recht, Pascal.“
Etwas unbeholfen versuchte ich, meinen Teil zum Aufräumen beizutragen, stellte die Döschen mit Butter, Käse und Aufstrich in den Kühlschrank. Da spürte ich, wie mich jemand von hinten umarmte.
„Ich bin unglaublich stolz auf dich!“, flüsterte mir Pascal zu. All meine Kraft benötigte ich, um ihn nicht von mir zu stoßen und ihn anzuschreien, was er sich überhaupt erlaubte. Was er sich erlaubte, mich anzufassen und nett zu mir zu sein. Immer, wenn jemand etwas Nettes zu mir sagte, vermutete ich entweder Spott oder zwielichtige Absichten dahinter.
„Stolz? Dass ich einen Biss Brot gegessen habe?“
„Ja! Ich habe gemerkt, wie schwer es für dich war, aber du hast nicht aufgegeben und in der letzten Minute noch gezeigt, was für eine Kämpferin du bist.“
Ich? Eine Kämpferin?
„Wo bleibt ihr denn? Wir kommen schon wieder zu spät!“, rief es aus dem Gang. Penelope sah auf ihr Handy und packte noch schnell die letzten Gläser in die Spülmaschine.
„Kommen schon!“
Im Gang warteten zwei ältere Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine klein, dick und sehr schick angezogen. Die andere groß und mit einem verwahrlosten Äußeren. Neben ihnen stand ein Mann im Anzug. Schnell stellte Pascal mich den Mitpatienten vor und ich hatte Mühe, mir die Namen zu merken. Alle drei wirkten recht nett, wenn auch zurückhaltend. Auf dem Weg zur Kapelle wollte keiner der drei mit mir reden. Dafür hielt Pascal alle bei Laune und erzählte, dass er sich wie ein Masthähnchen fühlte. Während er sprach, rieb er immer wieder seinen Bauch. Tatsächlich war eine deutliche Wölbung zu erkennen, die nicht zu seinem sonst so mageren Körper passte.
„Wie lange bist du nochmal hier?“, fragte ich ihn und hoffte, dass er mir die wiederholte Nachfrage nicht übelnahm. Schließlich hatte er mir das heute Mittag erst erzählt.
„Fünf Wochen. Und ich hoffe, dass ich bald im Aufenthaltsraum essen darf. Meine Bezugspflege meint, dass es nicht mehr lange dauern kann.“
„Das wären aber ausgesprochen gute Nachrichten“, sagte die Kleine. „Wir werden dir einen Platz an unserem Tisch freihalten.“
„Komm lieber an unseren Tisch, bei uns ist es viel lustiger“, sagte die Große und Pascal wurde rot, als sich die Damen um seine Anwesenheit stritten. Es war ein schöner Moment. Ich gönnte ihm die Anerkennung und sah zu Penelope. Ihr Blick war streng nach vorne gerichtet und seltsam leer. Wie mechanisch stellte sie einen Fuß vor den anderen, bewegte eine scheinbar leere Hülle zur Kapelle. Als wir ankamen, sangen sie bereits.
Es waren fünf weitere Patienten in der Kapelle, alte und junge. Die zwei Frauen sangen sehr gut, etwas hoch vielleicht, aber sie waren nett und forderten uns dazu auf, unsere Wünsche zu äußern. Die Große, die Kleine und Mr. Anzug hatten keine Bedenken, sich ständig neue Lieder zu wünschen. Wir sangen ältere, aber auch neuere Lieder. Singend Gott zu preisen, fühlte sich paradox an, denn wenn es einen Gott gäbe, warum hat er zugelassen, dass ich so in die Scheiße rutschen konnte? Nein, mit Gott hatte ich meine Probleme. Mein Vater war ein frommer Kirchgänger und meine Mutter quasi der Antichrist 2.0. Jeder hatte immer versucht, mich auf „den richtigen Weg“ zu bringen. Das hatte nur dafür gesorgt, dass ich immer das Gefühl hatte, in einer Zwischenwelt zu sein und niemals irgendwo richtig anzukommen.
In den kurzen Gesangspausen blätterte Penelope ständig zu einem bestimmten Lied und haderte wohl mit sich, ob sie ihre Bedürfnisse artikulieren sollte. Pascal stand links, ich rechts von ihr. Als die Gitarristin nach dem letzten Liedwunsch für heute fragte, meldete sich Pascal, schielte auf Penelopes Gesangsbuch und wünschte sich das Lied, das Penelope offensichtlich viel bedeutete. Sie lächelte und umarmte Pascal. Dann begann sie aus vollem Herzen zu singen. Zuvor hatte sie zwar auch gesungen, aber eher leise. Ich hatte sie gar nicht gehört. Jetzt stellte ich fest, dass sie die Stimme eines Engels besaß. Sie singen zu hören, ließ mich doch über die Existenz eines Gottes nachdenken. Als ich noch ein Kind war, war ich eher auf der Seite meines Vaters. An Gott zu glauben, war mir damals nicht schwergefallen. Mit zunehmendem Mobbing zweifelte ich aber immer mehr an der Existenz von jemandem, der alle Menschen liebte, egal, was sie sich für Verfehlungen leisteten. Penelopes Augen strahlten und ich beneidete sie dafür, offensichtlich etwas in ihrem Leben zu haben, aus dem sie Hoffnung schöpfen konnte. Es musste schön sein, sich geliebt und sicher zu fühlen. Das Lied war noch nicht vorbei, als ich mein Buch schloss. Auch wenn ich Singen noch so sehr liebte, bei diesem Lied brachte ich keinen Ton über meine Lippen. Die Worte schienen zu echt zu sein, um von jemandem wie mir gesungen zu werden, die nicht an Gott glauben konnte.
„Und, wie hat es dir gefallen?“
Pascal, Penelope, die drei anderen Mitpatienten und ich liefen aus der Kapelle wieder zur psychosomatischen Station.
„Sehr gut. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt.“
„Gerne.“
Es brannte mir auf der Zunge, mich nochmal bei Penelope zu bedanken, ihr zu sagen, wie schön es für mich war, nicht mehr allein sein zu müssen, aber ich traute mich nicht. Deswegen dankte ich ihr schweigend und beschloss, in Zukunft meinen Teil dazu beizutragen, das Lächeln, das sie stets anderen schenkte, auch einmal für sich selbst aufbringen zu können.
Sophia machte spät abends noch etwas Gymnastik. Es war nicht annährend so schweißtreibend wie die HIIT-Einheiten, die ich jeden Morgen absolvierte, aber ihr zuzusehen genügte, um meinen Sportzwang wieder aufleben zu lassen. Ich musste mich bewegen. Jetzt. Ich brauchte das Gefühl meines pulsierenden Herzens, das Pochen in meinem Kopf, den Schweißfilm auf meinem ganzen Körper. Nein. Ich brauchte Ruhe und Entspannung. Mein Körper hatte die letzten Jahre genug Sport gemacht. Eine Auszeit war mehr als angemessen. Weil ich ihr aber nicht zusehen wollte und konnte, ging ich in den Aufenthaltsraum. Dort saß die große, schweigsame Frau von vorhin auf dem Sofa und sah fern. Weil sie ganz allein war, setzte ich mich zu ihr und dachte, ich beginne ein nettes Gespräch. Das ging allerdings recht schnell nach hinten los. Einfühlsamkeit zählte wohl nicht zu ihren Stärken.
„Und dir macht es nichts, dass euch da drüben in der Lehrküche beim Essen zugesehen wird? Ist doch schon krank, oder? Ich habe gehört, die Pfleger passen ganz genau auf, wie viel man nachwürzt.“
Irgendwo zwischen „Natürlich stört es mich. Du hast ja keine Ahnung! Ja, das ist krank. Aber wir sind ja auch krank. Wir brauchen diese Unterstützung“ und „Das alles geht dich gar nichts an!“ war ich gefangen. Ich entschied mich für einen Mittelweg.
„Naja, es ist schon schwer, aber ich bleibe bestimmt nicht lange an dem Tisch.“
„Das glaub ich auch.“ Sie musterte mich und wandte sich wieder an den Fernseher. „So dünn bist du doch gar nicht.“
Autsch.
Hilfe.
Essstörung hallo!
Mein Herz zog sich zusammen, denn sie hatte recht. Was tat ich nur hier? Ich war fett. Es war paradox, dass ich hergekommen war, um zuzunehmen. Nein, das musste nicht sein. Ich brauchte keine Butter. Ich brauchte Sport und Salat. Und noch mehr Sport. Ich brauchte das Magenknurren, um zu spüren, wie stark ich war. Wie konnte ich nur für einen Augenblick denken, ich sei wirklich krank? Wortlos stand ich auf und schlenderte in Richtung Ausgang.
„Ach, Frau Schweighart!“, rief es durch den Flur. Ich ballte meine Fäuste und biss mir auf die Unterlippen, um nicht direkt in Tränen auszubrechen. In diesem Moment konnte ich mit niemandem reden. Ich wollte einfach nur weg, raus hier. Raus aus meinem Körper. Raus aus der Welt. Nicht mehr ich sein. Nicht mehr sein. „Wie schön, dass ich Sie noch erwische!“ Ein strahlend grünes Augenpaar tauchte vor mir auf. Arielles Lächeln wich schnell einem besorgten Blick. „Ist alles in Ordnung, Frau Schweighart?“
„Mhm“, machte ich, nickte und schluckte. „Kann nur nicht einschlafen.“
„Ach, das ist völlig normal!“ Sie winkte ab und lächelte wieder. „Die erste Nacht ist immer die schlimmste. Aber denken Sie daran, wie stolz Sie auf sich sein können!“
„Stolz?“
„Freiwillig in eine Klinik zu gehen, ist ein Zeichen äußerster Disziplin. Es ist die richtige Entscheidung, dass Sie sich um Ihre Gesundheit kümmern wollen. Sie können stolz sein, hier her gekommen zu sein.“
Ich blinzelte gegen meine Tränen. Konnte sie Gedanken lesen? Wie war es möglich, dass sie mich genau in diesem Moment traf und diese Worte zu mir sagte, die den Sturm in mir ein kleines bisschen beruhigen konnten?
„Jedenfalls wollte ich Ihnen noch sagen, dass ich Ihre Bezugspflege bin. Das heißt, ich bin im Besonderen dafür verantwortlich, dass Sie sich hier wohlfühlen. In den ersten Wochen ist es üblich, engen Kontakt zu haben. Ich schlage vor, wir führen gleich morgen unser erstes Gespräch. Wann hätten Sie Zeit?“
Wann hatte ich Zeit? Wollte sie mich verarschen? Wann hatte ich keine Zeit? Ich war in einer Klinik, nicht auf einem wichtigen Kongress einer Aktiengesellschaft.
„Ähm, ja, mir egal.“
„Wann sind denn Ihre Therapien?“
„Äh.“
Sie lachte ein unglaublich wärmendes Lachen und legte den Kopf schief. „Es dauert, bis man einen Überblick über den Therapieplan hat. Sagen wir 20:00 Uhr? Dann haben Sie bestimmt keine Therapie mehr.“
„Okay.“
„Können Sie dann bitte auf das Stationszimmer kommen?“
„Klar.“
„Vielen Dank, Frau Schweighart. Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute, erste Nacht bei uns. Auf eine gute Zusammenarbeit.“
Bevor sie ging, zwinkerte sie mir zu. Verdammt. Sie war so nett. A. Best. Für was wohl das A stand? Na klar, Arielle! In Gedanken lachte ich über meinen eigenen Witz und schlenderte noch ein bisschen durch die leeren Flure, während ich versuchte, meine Gedanken zu sortieren.
Kapitel 3: Sportsucht
Du weißt, dass es schlimm ist, wenn du jeden Tag um halb fünf Uhr aufstehst, um vor der Uni genügend Zeit für deinen Sport zu haben. Eine Stunde etwa. Insgesamt. Mit Auf- und Abwärmen. Ein High Intensity Interval Training. Nachbrenneffekt bis zu 48 Stunden. 60 Sekunden Arbeit. 10 Sekunden Pause. 60 Sekunden Hampelmann. 10 Sekunden Pause. 60 Sekunden Liegestütze. 10 Sekunden wieder aufrappeln. 60 Sekunden High Knees. Verschiedene Übungen. Abwechslung. Spaß. Schmerz. Mindestens 25 Minuten. Am besten nicht unter 30. Gut ist es, wenn es circa 40 Minuten sind. Aber alles über 45 Minuten ist zu stressig. Du musst noch duschen und frühstücken. Müsli. Bestehend aus einem Apfel, in winzig kleine Stücke geschnitten. Dazu Zimt. Senkt den Blutzuckerspiegel. Aufgefüllt wird die Müslischüssel bis kurz zum Rand mit fettarmer Milch. Dann der Griff zur Haferflockenpackung. Die Hände zittern. Du schwitzt. Zaghaft und irgendwie mechanisch findet der Löffel in der Hand seinen Weg in die Packung, löffelt die Flocken auf und wirft sie auf die Milch. Der zweite Löffel folgt zugleich. War viel zu voll gehäuft. Deswegen hängt jetzt alles an dem dritten Löffel. Bloß nicht zu viel Flocken auf die Milch. So ist es gut. Nein. Das ist zu viel. Ein Teil von dir will die Flocken zurück in die Packung löffeln, aber das wäre jetzt zu schwierig. Der Blick auf die Uhr. Du trödelst wieder. Einfach hinsetzen und essen. Milchsuppe. Mit Apfel. Zum Frühstück schaust du die Nachrichten des Vorabends online. Nicht über das Essen nachdenken. Nicht darüber nachdenken, wie sehr sich dein Magen zusammenzieht. Hunger.
Du weißt, dass es schlimm ist, wenn du noch vor dem Frühstück einen halben Liter Wasser getrunken hast. Die Ausrede ist, dass du wegen des Sports durstig warst. Aber so durstig kann man nicht sein. Du weißt das selbst. Du weißt, dass jeder Muskel deines Körpers überstrapaziert ist. Du merkst, dass es wieder zu viel war, wenn jeder Schritt schmerzt und du heulen könntest, wenn du Treppenstufen nach oben steigst. Deine Oberschenkel brennen noch vom letzten Workout, wenn das neue beginnt. Dein Körper hat nie Zeit, sich zu erholen. Du weißt, dass es schlimm ist, wenn du trotzdem nicht aufhören kannst. Wenn du am Abend den Wecker wieder auf halb fünf stellst, deine Müdigkeit dich zermürbt, aber du lieber früher ins Bett gehst, als später aufzustehen. Früh Sport machen, um fleißig in die Uni gehen zu können. Erfolgreich sein. Keine Zeit für Freunde mehr. Keine Zeit mehr für irgendwas, das nicht mit Essen oder Sport zu tun hat.
Du weißt, dass es schlimm ist, wenn du weißt, wie schlimm das alles ist, es aber nicht mehr ändern kannst.
***
In der ersten Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Nicht nur schnarchte Sophia erbarmungslos laut, auch hatte ich die schlimmsten Magenschmerzen meines Lebens. Es fühlte sich an, als ob meine Gebärmutter fünf Kilo Schleimhaut gleichzeitig abtöten und abstoßen würde. Da ich aber seit Monaten nicht mehr menstruiert hatte, war es eher unwahrscheinlich, dass es sich um Regelschmerzen handelte. Genauso fühlte es sich aber an. Unerträglich. Mein gesamter Rumpf war ein schmerzendes Etwas, das mir Tränen in die Augen trieb. Okay. Truth Time: Ich hatte Hunger. Ich hatte die Art von Hunger, die man hat, wenn der Magen beinahe komplett leer ist. Dagegen hatte ich in den letzten Jahren die perfekten Strategien entwickelt. Ich trank sehr viel Wasser und füllte so meinen Magen. Bis zu fünf Litern täglich waren ein Klacks für mich. Natürlich ist dadurch die Niere dezent überfordert, weswegen ich monatelang sehr starke Ödeme an den Beinen hatte und durch die Wassereinlagerungen mehr wog, was meiner Erkrankung gar nicht gefiel. Jetzt sollte ich zunehmen, litt aber schon den ganzen Tag Hunger und bekam das Bedürfnis, mich zu beschweren. Hätte ich heute Abend mehr Salat bekommen, ginge es mir jetzt nicht so elend. Aber nein. Einen Nachschlag an Salat gab es nur, wenn man die Butter aufgegessen hatte. Was für eine verkorkste Welt war das? Ich schloss die Augen, versuchte zu schlafen, aber der Schmerz war so stark, dass ich einfach nicht aufhören konnte zu weinen.
Ein Blick auf mein Handy verriet mir, dass gerade ein Uhr war. Das Stationszimmer war nachts immer mit einer Pflegeperson besetzt. Und weil bisher alle sehr freundlich waren und meinten, dass man stets zur Pflege gehen könne, schlüpfte ich in meine Hausschuhe und stapfte dorthin. Ich musste zweimal klopfen, bis mir jemand ein unfreundliches „Herein“ entgegenrief.
Am Schreibtisch saß ein großgewachsener Mann mit Glatze, schwarzem Schnurrbart und Comic-T-Shirt. An diesem hing das Namensschild: G. Müller. Vor sich auf dem Tisch lag ein Magazin und sein Blick war mehr als genervt. Schluchzend rieb ich meinen Bauch.
„Hallo, e-es ist meine erste Nacht.“ Ich begann zu hyperventilieren. Die Schmerzen brachten mich um.
„Und was ist das Problem?“
„Ich hab so Hunger!“, platzte es aus mir heraus und meine Tränen kannten kein Halten mehr. Jetzt weinte ich nicht nur wegen meinem Magen, sondern auch wegen meiner Willensschwäche. Wie absurd war diese Situation: Eine Anorexie-Patientin kommt in eine Klinik und heult, weil sie Hunger hat?
„Wollen Sie sich setzen?“, fragte Herr Müller widerwillig und ich setzte mich an den Tisch. Seufzend reichte er mir eine Box mit dünnen Papiertaschentüchern, aus der ich mich reichlich bediente.
„Mein Magen tut so weh. Ich kann nicht schlafen. Ich hab so Hunger.“
Meine Essstörung hat sich in den letzten Jahren in dem Maße entwickelt, dass ich zu festen Uhrzeiten kleine Mahlzeiten zu mir genommen hatte. Zwischensnacks waren ausgeschlossen. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, nachts noch etwas zu essen, egal wie stark mein Hunger war. Aber nun wollte ich zunehmen – also ein bisschen. Deswegen war ich in der Klinik.
Mehrmals berichtete ich von meinem Hungergefühl und erwartete, dass mir der Pfleger etwas zu essen holen würde. Einen Apfel oder etwas Salatgurke. Was hätte ich nicht alles für eine Salatgurke gegeben!
„Hatten Sie heute denn Ihre volle Portion zum Abendessen?“
„Was?“
„Ich nehme an, Sie sind wegen einer Anorexie hier?“ Er sah an meinem Körper hinab und ich nickte.
„Haben Sie brav Ihre Butterbrote gegessen?“
Ich schniefte und presste die Lippen aufeinander, während Herr Müller mit den Schultern zuckte.
„Es tut mir leid, aber bevor Sie nicht Ihre vollen Portionen essen, sind Zwischenmahlzeiten nicht vorgesehen.“ Das ist Folter! Ist das rechtens? Ich nahm mir vor, den Kerl zu verklagen. Oder seinen Vorgesetzten oder irgendjemanden, der Schuld an diesem Leiden trug.
Außerdem sah er in keinster Weise so aus, als würde es ihm leidtun. Nachdem ich noch etwas geweint hatte, wurde mir klar, dass er mir nicht weiterhelfen konnte. Beziehungsweise riet er mir, einen Kamillentee zu trinken. Was für ein Superbrain! Als hätte ich das nicht schon getan. Da halfen nur noch Schmerztabletten.
„Diese Schmerzen …“
„Bei Anorexiepatienten verzichten wir innerhalb der ersten Tage auf Schmerzmittel. Die Gründe für Magenschmerzen sind vielseitig. Wir müssen das erst mit Ihrem Therapeuten und Arzt abklären.“
Wäre ich nicht so benommen gewesen, hätte ich gerne den Tisch oder irgendetwas anderes umgeschmissen. Was war das bitte für eine Erpressung? Friss oder stirb!? Friss die Butter oder verrecke an den Schmerzen?
Ohne Medikamente oder etwas zu essen, schlich ich zurück in mein Bett. Herrn Müller würde ich nicht verklagen. Frau Hahn auch nicht. Niemanden. Keiner von ihnen war schuld an meiner derzeitigen Situation. Nur ich allein trug die Verantwortung. Keine Medikamente gegen die Schmerzen, bevor ich nicht die verdammte Butter in mich stopfte? Langsam wurde mir bewusst, wie genial diese Art der Erpressung war.
Sophia durfte bei der Morgengymnastik mitmachen – wie fast alle Patienten. Vor dem Frühstück ging die Truppe los. Erst spazieren und dann dehnen. Ich saß auf der Fensterbank und sah zu, wie sie in Zweier- oder Dreiergruppen über den Klinikpark liefen. Die Sonne war schon aufgegangen und ich wäre unglaublich gern dabei gewesen. Nicht nur, um mich bewegen zu können, sondern auch, um Kontakte zu knüpfen. Ich fühlte mich ausgeschlossen und dieses Gefühl tat mir gar nicht gut. Es nährte meine Selbstzweifel, die mich zum Hungern antrieben. Auf der harten Fensterbank hielt ich es nicht lange aus, viel zu sehr schmerzte mein Po. Wie schön wäre es, sich auf ungepolsterte Dinge setzten zu können, ohne dabei Schmerzen zu leiden. Dass Sitzen wehtun konnte, war mir gar nicht bewusst gewesen, bevor ich so stark abgenommen hatte und wohl kein Sitzfleisch mehr besaß. Wobei. Der Spiegel im Badezimmer reichte nur bis zur Brust. Ich verzehrte mich danach, mich in einem Ganzkörperspiegel zu betrachten. Ich musste sehen, ob ich schon wieder fett geworden war.
Als ich durch die Gänge der psychosomatischen Station lief, roch ich frische Brötchen und mein Magen meldete sich lautstark. Plötzlich spürte ich wieder, was für einen starken Hunger ich hatte und wie sehr mein Bauch verkrampft war. Die Sorgen meines Außenseitertums hatten die Magenschmerzen für kurze Zeit überlagert. Nun aber hätte ich wieder losheulen können. Was tun gegen die Schmerzen? Erst in einer Dreiviertelstunde würde es Frühstück geben. Wie sollte ich das nur überleben? Wie die Schmerzen besiegen? Früher hatte ich immer getrunken, Kaugummi gekaut oder Magentabletten genommen. Und jetzt?
Kurzerhand lief ich in den Aufenthaltsraum, um mir einen Tee zu machen. Sobald ich den Raum betrat, musste ich an gestern Abend denken und daran, wie die Große gemeint hatte, ich sei fett und hätte hier nichts verloren. Nun hatte ich Angst, ihr wieder zu begegnen, doch der Platz auf dem Sofa war leer. Niemand war hier, also brühte ich mir in aller Ruhe einen Tee auf. Die Auswahl an Teesorten war zwar eher spartanisch, aber für ein Krankenhaus wohl ganz okay.
„Na, Häschen, wie war die erste Nacht?“
Erschrocken drehte ich mich um und sah den großen Mann von gestern, der mich so freundlich begrüßt hatte. Wieder trug er ein Handtuch um den Nacken.
„Guten Morgen, ich-“ Ich habe nicht geschlafen. Es geht mir elend. Ich möchte Salat essen. Wo ist mein Salat? „Danke, es ging.“
„Siehst aber aus, als hätte dich jemand durch den Fleischwolf gedrückt.“ Er lachte, wobei sich sein Bauch hob und senkte. Seine Stimme war laut, einnehmend und ich war verunsichert, wie ich ihn einschätzen sollte. War er ein liebevoller Teddybär oder ein gefährlicher Schläger?
„Naja …“
„Schnarcht die Alte? Sophia?“ Er lief zum Fenster und streckte sich. „Kann ich mir denken. Lebenslang Beamtin gewesen, hält sich für was Besseres. Das sind oft die, die keinen Anstand und nichts haben.“
Ich nahm meine Tasse und stellte mich neben ihn ans Fenster. Draußen begann eine Gruppe gerade mit den ersten Stretch-Übungen und der Sturm in mir zog auf.
„Ich heiße Scarlett.“
„Leopold, nenn mich Leo. Freut mich.“
„Mich auch“, antwortete ich und entdeckte einige Narben auf seinem Unterarm.
„Wieso bist du nicht bei dem Morgenspaziergang dabei? Ich dachte, es ist verpflichtend?“
Leo lachte abwertend. „Ich habe solche Schmerzen, die können mich mit ihren Verpflichtungen mal kreuzweise.“ Hatte er gestern nicht gesagt, die Schmerzen seien ihm hier genommen worden? Sprach heute Ehrlichkeit aus ihm? Und gestern war es der Trost? „Warum bist du nicht dabei, Häschen? Ah.“ Bevor ich etwas sagen konnte, sah er an mir herab und nickte bedeutungsvoll. „Verbrennt zu viele Kalorien, was?“
„Anscheinend.“
Es war einfach lächerlich, was die Pfleger und Ärzte glaubten, Anorexiepatienten zu verbieten. Ich durfte keine Treppen gehen, nicht zu weit oder zu schnell laufen. Der Morgensport in der Gruppe war ohnehin für lange Zeit für mich Tabu. Tanztherapien und sonstige Kurse, bei denen man schwitzen könnte, durfte ich auch nicht belegen. Nur, weil ich einen BMI von unter 16 hatte. Das war doch alles lächerlich!
„Heut gibt’s wieder Gruppentherapie. Da freu ich mich immer schon die ganze Woche drauf.“ Mir war nicht ganz klar, ob Ironie in seiner Stimme schwang oder nicht. „In welcher Gruppe bist du?“
„B. Und du?“
„A. Schade.“
Die 30 Patienten der psychosomatischen Station waren für Gruppensitzungen in drei Gruppen eingeteilt. So sollte ein reger Austausch wohl möglich werden.
„Also Häschen“, sagte er, rieb sich mit dem Handtuch die Stirn ab und zwinkerte mir zu. „Nicht böse sein, ich brauch jetzt dringend meine Pillen. Bis später. Lass dich nicht ärgern und iss fleißig deine Brötchen.“
Nachdem er gegangen war, sprang ich unter die Dusche und stellte mich vor der Lehrküche parat. Zehn Minuten vor Beginn des Essens mussten wir da sein und helfen, den Tisch zu decken. Pascal und Penelope begrüßten mich herzlich. Lisa würdigte mich keines Blickes. Warum war sie so abweisend zu allen?
Die heutige Essbegleitung war Arielle, was mich nervös machte. Frühstück hieß Marmelade auf Butter auf Brötchen, was für mich drei Tabu-Lebensmittel waren, die ich nicht so schnell besiegen konnte. Vor allem nicht in Kombination. Ich wollte aber nicht schon wieder so flennen wie gestern. Nicht vor ihr. Der Tisch war gedeckt, wir setzten uns und Arielle rief zum Blitz auf.
„Ich habe gar nicht geschlafen“, begann Lisa ungefragt. „Mein Kopf tut schrecklich weh. Ich weiß nicht, wie lange das in dieser Form weitergehen kann. Ein Desaster. Es wird überhaupt nicht besser. Daheim habe ich geschlafen wie ein Stein. Seit ich hier bin, kann ich kein Auge zu tun.“