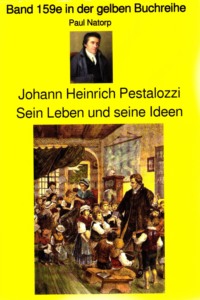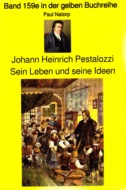Kitabı oku: «Paul Natorp: Johann Heinrich Pestalozzi, Sein Leben und seine Ideen», sayfa 2
Die Armenanstalt auf Neuhof
Die Armenanstalt auf Neuhof

An dem 1770 geborenen Söhnchen Hans Jakob („Jacqueli“) konnte Pestalozzi die ersten eigenen Erziehungsstudien machen. Die wertvollen Tagebuchaufzeichnungen über seine Beobachtungen und Versuche an dem vierjährigen Knaben (1774) lassen den Einfluss Rousseaus auch auf seine Erziehungsgrundsätze deutlich erkennen. Sachbildung geht vor Wortbildung; das Sehen, Hören und Tun muss weit vorhergehen dem Urteilen und Schließen. Stetiger, lückenloser Fortschritt der Bildung; „Ordnung, Genauheit, Vollendung, Vollkommenheit“ in allem; selber finden, was irgend selber zu finden ist; an der Hand der „Natur“ lernen, der der Lehrer nur „leise und still mit der folgenden Kunst fast nebenher schleicht“: Das gibt Mut und Freude, ohne die alles Lernen keinen Heller wert ist. Gehorsam muss sein (gegen Rousseau!), aber er muss in freiem Zutrauen, in der Erfahrung der Liebe und überlegenen Einsicht des Erziehers gegründet sein.

Zu einer bedeutenden Erweiterung und Vertiefung seiner pädagogischen Erfahrung führte ihn indirekt das baldige Scheitern seiner landwirtschaftlichen Unternehmung. Sein Plan war an sich zwar nicht unverständig. Aber schon beim Landkauf wurde er durch einen gewissen Merki, der sich durch einige wirkliche Dienste, die er ihm dabei leistete, in sein Vertrauen geschlichen hatte, hinterher betrogen. Überhaupt war Pestalozzi nie ein genauer Rechner. Misswuchs und sonstige unvorhergesehene Schwierigkeiten kamen hinzu; so begreift es sich, dass das Bankhaus, das den größten Teil der Kosten vorgeschossen hatte und nun den erhofften Nutzen nicht absah, seine Gelder endlich zurückzog. Pestalozzi allein aber konnte unter der drückenden Schuldenlast das ohnehin schwierige Unternehmen auf die Länge unmöglich weiterführen. Dieser Misserfolg musste ihn doppelt niederschlagen, weil er so auch jede Hoffnung schwinden sah, zur Linderung des Volkselends, das er jetzt täglich in nächster Umgebung vor Augen sah und das ihm näher ging als die eigne Not, auch nur irgendetwas beitragen zu können. In solcher Bedrängnis kam ihm der Gedanke, es könne ihm zugleich und dem armen Volke um ihn her geholfen werden, wenn er sein Gut in eine Anstalt zur Auferziehung von Armenkindern umwandelte.

(Band 65e dieser gelben Buchreihe berichtet über Johann Hinrich Wichern und das von ihm 1833 in Horn bei Hamburg gegründete Rauhe Haus. Wichern war von Pestalozzis Ideen beeinflusst. Er hatte bleibenden Erfolg, weil der junge Handwerker als Gehilfen anwerben konnte, die den Kindern in den „Familien“ als „Brüder“ zur Seite standen. Diese Gehilfen erhielten durch Wichern eine theoretische Ausbildung und eine berufliche Perspektive als „Hausväter“ in anderen Kinderheimen („Rettungsanstalten“), als Lehrer oder als Kolonistenprediger in Übersee.) Die Kinder sollten unter seiner Anleitung vor allem arbeiten lernen; durch die gemeinsame Arbeit des Hauses – Baumwollspinnerei und -weberei, kombiniert mit einfacher Feldarbeit, besonders Gemüsebau – würde die Anstalt, einmal in Gang gebracht, sich bald selber erhalten können, während ihre Zöglinge zugleich die Segnungen eines schlichten, aber liebewarmen Hauslebens genössen und so zu eben der Lebensführung gebildet würden, auf die ihre Lage sie hinwies. Der Plan war nicht bloß in der Absicht vortrefflich, sondern an sich auch sehr wohl ausführbar. Pestalozzi fand in seiner Nähe vielfache Aufmunterung und anfangs auch tätige Hilfe. So konnte die Anstalt im Jahre 1774 ins Leben treten. Indessen wuchs ihm die Sache nur zu bald über den Kopf. Es hätte mehr als menschliche Kräfte gefordert, neben seinem Hauptzweck der Erziehung Feldbau, Fabrikation, Handel und ein ganzes großes Hauswesen mit bis zu 50 Bettlerkindern zu bewältigen. Er hätte allerwenigstens für die äußere Verwaltung und Rechnungsführung geeignete Hilfskräfte zur Seite haben müssen. Ganz besonders nachteilig erwies sich, dass es ohne obrigkeitlichen Schutz, den er vergebens nachsuchte, nicht möglich war, die Kinder zum Bleiben in der Anstalt zu bewegen; die meisten gingen, nachdem sie sich eine Zeitlang in ihr hatten verköstigen und verpflegen lassen, ohne Dank davon. So konnte die Absicht, dass die Anstalt sich durch die Arbeit der Zöglinge selbst erhalte, natürlich nicht erreicht werden. Aus allen diesen Gründen war das Scheitern des Versuchs unvermeidlich. Mit der äußersten Anstrengung vermochte er ihn eine Reihe von Jahren hindurch fortzuführen; endlich aber, im Jahre 1780, musste er blutenden Herzens die Anstalt auflösen und stand nun da als ein gänzlich Gescheiterter.
In mehreren kleinen Aufsätzen, die der warm für ihn interessierte Iselin in Basel in seiner Zeitschrift „Ephemeriden der Menschheit“ 1777 und 1778 zum Abdruck brachte, hat Pestalozzi seinen Plan ausführlich dargelegt und über die Ausführung berichtet. Als Kerngedanke tritt deutlich hervor: Der Arme muss für seine Lage erzogen werden. Seine Auferziehungsstube muss seiner künftigen Wohnstube so viel als möglich gleich sein, während die meisten öffentlichen Stiftungen hiervon gerade das Gegenteil zeigen. Die entscheidenden Fragen sind: 1. Kann die Arbeit der Armenkinder zu so hohem Ertrag gebracht werden, dass dadurch eine solche Anstalt sich selber zu erhalten imstande ist? und 2. Ist es ratsam, die Auferziehung des Armen dem Geiste der Industrie zu unterwerfen? Was wird die Verbindung von Gewerbsamkeit mit Erziehungsanstalten für einen Einfluss auf den späteren häuslichen Zustand der so erzogenen Armen, auf ihre Sittlichkeit, auf ihre körperliche Stärke und auf den Feldbau haben? Beide Fragen glaubt Pestalozzi schon auf Grund seiner unvollkommenen Versuche im günstigen Sinne beantworten zu können. Besonders erkennt er die Erziehung zur Industriearbeit als unumgänglich notwendig. Die Entwicklung zur Industrie ist einmal da und nicht mehr rückgängig zu machen. Der Arme trägt schon jetzt allen Schaden des Fabrikwesens, es gilt ihm jetzt auch den größten möglichen Gewinn davon zu verschaffen, nicht indem man ihn in die nächste beste Fabrik schickt, wo sie „in einer ungesunden Luft zu Maschinen gebraucht werden, wo sie von Pflicht und Sitten nichts hören, wo ihr Kopf, ihr Herz und ihr Körper gleich erdrückt oder wenigstens unentwickelt und ungebaut bleibt“, sondern indem man „den in der Fabrikindustrie liegenden größeren Abtrag der Verdienstfähigkeit des Menschen als Mittel zur Erzielung wahrer wirklicher Erziehungsanstalten, die den ganzen Bedürfnissen der Menschheit genügen“, benützt. Denn an sich ist der Mensch „unter allen Umständen und bei allen Arbeiten der Leitung zum Guten gleich fähig... Mit dem Herzen allein wird das Herz geleitet... Spinnen oder Grasen, Weben oder Pflügen, das wird an sich weder sittlich noch unsittlich machen...“ Die wesentliche Voraussetzung ist nur, dass der Gewinn nicht der einzige Endzweck der Industrie, sondern nur das Mittel zu dem wahren Endzweck der Erziehung ist.

Robert Owen – 1771 – 1858
– Es ist fast derselbe Gedankengang, durch den ein Menschenalter später der hochsinnige Sozialist Robert Owen zu einem auf solideren wirtschaftlichen Grundlagen unternommenen Versuch in ähnlicher Richtung geführt wurde. Im Unterricht der Pestalozzischen Anstalt stand ihrer ganzen Absicht gemäß die Handarbeit weit voran; Lesen, Schreiben, Rechnen wurde auch getrieben, doch glaubte er die Unterweisung darin wenigstens bis zum neunten Jahre hinausschieben zu dürfen. Die Art der sittlichen Unterweisung war „meistens nicht Unterricht des Lehrers“, sondern „teilnehmender Unterricht des Hausvaters, Ergreifung der immer vorfallenden Gelegenheiten, an denen er mit ihnen, sie mit ihm Anteil nahmen“. Rührend ist es, in den Berichten zu lesen, wie Pestalozzi auf die Individualität jedes einzelnen seiner Pflegebefohlenen eingeht, wie er an die verkommensten, elendesten, unbegabtesten bis zu den blödsinnigen herab unermüdliche Sorgfalt wendet und überglücklich ist, wenn er nur eine Spur von Fortschritt bemerkt. „Ich lebte“, sagt er später über diese Zeit, „jahrelang im Kreise von mehr als fünfzig Bettlerkindern, teilte in Armut mit ihnen mein Brot, lebte selbst wie ein Bettler, um zu lernen, Bettler wie Menschen leben zu machen“.
Das Scheitern des hochsinnig geplanten Unternehmens musste ihn noch ungleich schwerer treffen als sein erster, bloß persönlicher Misserfolg. Zwar sein Glaube an das, was er gewollt, hat keinen Augenblick gewankt. Aber bei der Welt fand er keinen Glauben mehr. „Andern will er helfen und kann sich selber nicht helfen“: Diesen ewigen Spott der Weltklugheit über die selbstvergessene Liebe bekam er wie oft zu hören. Auch seine besten Freunde glaubten, ihm sei einmal nicht zu helfen; sie hielten für ausgemacht, er werde seine Tage im Spital oder gar im Narrenhause beschließen müssen. Der einzige Iselin hielt treu zu ihm und überzeugte ihn, dass „in wichtigen Dingen mutvolle Efforts, auch wenn sie für einmal nicht zum Ziele führen, dennoch entferntere gute Folgen ihrer Natur nach haben müssen“. Auch find die „entfernteren guten Folgen“ nicht ausgeblieben; es sind namentlich die sogenannten Wehrlischulen in der Schweiz indirekt aus Pestalozzis Anregung hervorgegangen, welche eben das zu verwirklichen suchen, was er mit seiner Anstalt gewollt hatte.
Seinen Landsitz vermochte er nur dadurch sich zu erhalten, dass er den größeren Teil des Gutes an Verwandte verkaufte, um von dem Erlös seine Gläubiger wenigstens teilweise zu befriedigen. Den ihm verbliebenen Rest gab er in Pacht, bis sein Sohn die Bewirtschaftung übernehmen konnte. Sein zerrüttetes Hauswesen wieder in Ordnung zu bringen, war ein ausgezeichnetes Mädchen, Elisabeth Näf („die Lisabeth“) ihm behilflich, das um diese Zeit aus freien Stücken als einfache Magd in sein Haus kam und allmählich ganz mit der Pestalozzischen Familie verwuchs. Sie ist das Urbild der „Gertrud“ des Pestalozzischen Romans. Später nahm sich ein anderer Baseler Freund, Felix Battier, seiner wirtschaftlichen Lage sachkundig an. Seitdem war wenigstens die eigentliche Not überwunden, und so konnte Pestalozzi sich während der 18 Jahre seiner unfreiwilligen Muße (1780–1798) schriftstellerischen Arbeiten ungestört widmen.
* * *
Die „Abendstunde“
Die „Abendstunde“
Er hatte bei seinem verunglückten Versuch Unermessliches gelernt. Vor allem war eine gründliche Kenntnis des Volkes in seinem Elend und seiner nur tief vergrabenen Kraft, aber auch der Mittel und Wege, wie ihm geholfen werden könnte, ihm wie von selbst zugefallen. Das alles musste sich aussprechen, und sobald er nur die Feder ansetzte, strömte ihm der Stoff von selbst zu. So entstanden in kurzer Frist (von Nebenarbeiten abgesehen) zwei hochbedeutende Schriften: Die „Abendstunde“ und das Volksbuch „Lienhard und Gertrud“.
Die „Abendstunde eines Einsiedlers“ erschien in den Ephemeriden, Mai 1780; eine Art Monolog in gedankentiefen, schwer gefassten Aphorismen, in denen er sich über die Bestimmung des Menschen und die Grundgesetze seiner Bildung klar zu werden sucht. In voller Bestimmtheit tritt schon hier der Kerngedanke hervor, dass allein „im Innern der Natur“ des Menschen der Grund derjenigen Wahrheit liegt, die er braucht, die zu seiner rechten Bildung ihm not ist. Aus dieser ersten Voraussetzung folgt die Allgemeinheit der Bildung in dem doppelten Sinne: dass die Grundkraft der Bildung an sich in allen dieselbe ist, und dass sie nach Möglichkeit in allen zu ihrer gesunden Entwicklung gebracht werden muss. Daraus folgt weiter – was schon Rousseau betont hatte – die notwendige Unterordnung der Berufsbildung unter die allgemeine Menschenbildung. Diese ist schon in der „Abendstunde“ und überhaupt in allen Dokumenten aus dieser Zeit so klar ausgesprochen, dass es als ein vollständiger Irrtum bezeichnet werden muss, Pestalozzi habe in seiner ersten Periode überhaupt nur an die Berufsbildung der untersten Klasse, und erst seit Stanz und Burgdorf an allgemeine, „humane“ Bildung gedacht. – Der zweite Hauptfaktor der menschlichen Bildung ist die „Lage“ des Menschen, die „Verhältnisse“ oder „Umstände“, in denen er sich findet. Sie sind das vorzüglichste Mittel der Entfaltung der im Menschen selbst schlummernden Kräfte. Zwar erweist sich die äußere Lage des Menschen, so wie er sie vorfindet, der gesunden Entwicklung seiner Anlagen mindestens ebenso oft hinderlich als förderlich; aber es steht an sich in seiner Macht, sie sich so zu gestalten, dass sie zu seiner Bildung förderlich wird. Die Not selbst wird ihm zum Lehrmeister; sie ruft ihn auf, seine Kräfte zu gebrauchen und durch den Gebrauch zu entwickeln; so wird er dann allmählich seiner Lage Herr. Wie der Mensch überhaupt der eigene Gestalter seines höheren, besonders seines sittlichen Lebens, insofern (nach späterem Ausdruck) „Werk seiner selbst“ ist, so sind auch die äußeren Lebensformen, in denen und durch die er sich bildet, im letzten Grunde sein eigenes Werk. Es sind die mannigfachen Formen menschlicher Gemeinschaft, von der engsten zu weiteren und weiteren hinauf bis zur höchsten, der des Menschengeschlechtes unter dem himmlischen Vater. Diese Stufenordnung der Gemeinschaftsformen – eine der tiefsten und weittragendsten Voraussetzungen der Pestalozzischen Pädagogik, durch die besonders sie als „soziale“ und nicht bloß individuale Pädagogik charakterisiert wird – tritt ebenfalls schon in der „Abendstunde“ klar zutage. Und zwar von der engsten Gemeinschaft, der des Hauses, der Familie geht die Bildung des Menschen notwendig aus; denn „immer ist tue ausgebildete Kraft einer näheren Beziehung Quelle der Weisheit und Kraft des Menschen für entferntere Beziehungen... Die häuslichen Verhältnisse der Menschheit sind die ersten und vorzüglichsten Verhältnisse der Natur“, eben weil die engsten und nächsten und damit kraftvollsten, daher gerade der ersten, überhaupt entscheidenden Entwicklung der menschlichen Kräfte günstigsten. Nur ihr vergrößertes Abbild ist der bürgerliche Verein, gleichsam eine Familie von Familien: „Vatersinn bildet Regenten, Brudersinn Bürger; beide erzeugen Ordnung im Hause und im Staat.“ Die bürgerliche Gemeinschaft stellt also gleich der häuslichen, nur auf höherer Stufe, eine Arbeits- und damit Bildungsgemeinschaft dar. Über ihr erhebt sich endlich als höchste Form der Gemeinschaft jene ideelle Gemeinschaft des ganzen Menschengeschlechtes, in der wir alle Kinder eines Vaters und damit untereinander Brüder sind. Auch die tiefe, rein moralische Deutung der Religion aus diesem Gesichtspunkt, wie sie in der „Abendstunde“ bereits vorliegt, kehrt von da ab in immer neuen und schöneren Wendungen durch alle Lebensperioden Pestalozzis wieder.
* * *
„Lienhard und Gertrude“
„Lienhard und Gertrude“
War die „Abendstunde“ nur für wenige geschrieben, so wandte sich die zweite Hauptschrift dieser Zeit, der Roman „Lienhard und Gertrud“, als „Volksbuch“ an die weitesten Kreise und besonders an das niedere, arbeitende Volk. Er erschien, zunächst in einem Bändchen, zur Ostermesse 1781 und fand sofort lebhaften Anklang. Literarisch angesehen, ist es ein erster, sehr gelungener Versuch in reiner „Heimatkunst“. Das Leben des Volkes ist dargestellt ganz in der eigenen Denk-, Empfindungs- und Sprechweise des Volkes selbst, nicht wie von einem fremden, äußeren Beobachter. Hatte doch Pestalozzi in und mit dem Volke gelebt und alle seine Nöte an eigener Haut erfahren wie selten einer. Und zwar ist dieser erste Teil fast rein darstellend. Auf Volksbelehrung zwar geht die letzte Absicht, aber die Lehre verbirgt sich weise in reine, höchst lebendige und packende Geschichte; allenfalls dass sie hier und da wie unversehens im Gespräch – denn die ganze Fassung ist fast noch mehr dramatisch als erzählend – sich auch einmal direkt äußert. So tritt das Leben des unter schwachem Regiment hauptsächlich durch den schlimmen „Vogt“ (Schulzen) Hummel tief gesunkenen Schweizerdorfes Bonnal greifbar, in regster Bewegung dem Leser vor Augen. Man blickt fast in jede seiner ärmlichen Hütten hinein; das Dorfvolk zeigt sich im Alltags- und Sonntagskleid, bei der Arbeit und beim Geschwätz, daheim und auf der Gasse, im Wirtshaus und in der Kirche, in der Barbierstube, in der Gemeindeversammlung, am Totenbett usf. An grellen Lichtern und tiefen Schatten ist nicht gespart; neben den gemütvollen, etwas zu rührsamen Szenen in den Stuben der Gertrud und des Rudi stehen in oft hartem Kontrast die abgefeimten Schurkereien des Vogts und die Jämmerlichkeiten seiner prachtvoll gezeichneten Mitlumpen, der unheimlich komische Auftritt, wie der Vogt aus Rache in mitternächtiger Stunde dem Schlossherrn im tiefen Walde einen Markstein versetzen will und der gerade des Weges kommende Hühnerträger mit dem Windlicht als Teufel in Person den Entsetzten den Berg hinabjagt. Der frische Realismus der Darstellung begreift sich zum Teil daraus, dass Pestalozzi vielfach Gestalten aus dem Leben, natürlich mit Freiheit, nachgezeichnet hat; zum Vogt hat der oben erwähnte Merki Modell gesessen, zur Gertrud die Lisabeth usf. So wirkt alles wie unmittelbar aus dem Leben gegriffen; die Vorgänge, die ganze Milieuschilderung sind zugleich ein derart typischer Ausdruck damals weit verbreiteter Zustände, dass beinahe jedes Dorf seine Leute in den Figuren des Romans wiederzuerkennen meinte.
Indessen ihm war es nicht genug, bloß den gegebenen, oft traurigen Zustand wahrheitsgetreu dargestellt zu haben; es galt, zu den Quellen der Übel aufzusteigen. Es war gezeigt: so ist es; aber nun fragte es sich: Warum ist es so? Und wie kann man machen, dass es anders werde? Diese weitere Absicht führte zu den ursprünglich wohl nicht geplanten Fortsetzungen des Romans und dann zu dem zweiten Volksbuch „Christoph und Else“, das ganz eigentlich einen Kommentar zum ersten Teil von „Lienhard und Gertrud“ darstellt, nämlich zur Erzählung die direkte Lehre hinzufügt.
Zunächst enthält der zweite Teil des Romans (1783) in der Hauptsache die Vorführung, wie es zu den im ersten gezeichneten schlimmen Zuständen hatte kommen können, besonders in Gestalt der eingehenden Lebensbeschreibung des Vogts Hummel, in dem das Verderben des ganzen Dorfes sich gewissermaßen zusammenfasst. Diese Geschichte beleuchtet vor allem die harte Wahrheit, dass jeder in die gleiche Schlechtigkeit versinken kann, wenn er in Lagen gerät, die geeignet sind, „den Samen des Bösen in ihm so zu entwickeln, wie aus einer einzigen Kornähre ein ganzes Viertel Frucht werden kann“. „Die Umstände machen den Menschen.“ Eine schneidende Kritik der üblichen Justiz liegt in der ganzen Vorführung eingeschlossen. Pestalozzi arbeitete in derselben Zeit an der hochbedeutenden Studie über „Gesetzgebung und Kindermord“; da waren ihm jene grause Wahrheit und die Ohnmacht der bisherigen Justiz gegen sie in erschütternder Stärke entgegengetreten. Es ist auffallend, wie Pestalozzi hier die wesentlichsten Gedanken der modernen Kriminologie erreicht: dass der Gesellschaft am Verbrechen nicht nur die Mitschuld, sondern geradezu die Hauptschuld zufällt, und dass die Behandlung des Verbrechers einzig darauf gerichtet sein muss, ihn zum sozialen Leben wieder tauglich zu machen, dass sie nichts anderes sein soll als „rückführende Schule des verirrten Menschen in die Bahn und den Zustand, in welchem er gewesen wäre ohne seine Verirrung“.
Kein Wunder, dass eine so harte Rede niemand gerne hören mochte. Schon der zweite Teil des Romans fand weit geringeren Anklang als der erste. Im dritten (1785) geht es endlich an die Heilung der Schäden. Er ist daher für den Pädagogen eigentlich der wichtigste. Es ist gewissermaßen ein Handbuch der sozialen Pädagogik, nicht in trockenen Lehrsätzen, sondern in anschaulicher Vorführung am typischen Fall des durch weise Maßnahmen einer gerechten und wohlwollenden Regierung, hauptsächlich aber durch die eigenen, noch nicht ganz zugrunde gerichteten Kräfte des Volkes selbst, durch das stille und sichere Wirken einer kleinen Zahl treu verbundener Männer und Frauen in ihm aus tiefstem Elend sich langsam wieder emporarbeitenden Spinnerdorfs. Die sozialen Bedingungen der Erziehung rücken hier besonders in helles Licht, und auf diesem sozialen Hintergrunde baut dann die Hauserziehung der Gertrud und die ihr treulich nachgebildete Schulerziehung des Glülphi sich umso wirksamer auf; beide greifen so ganz unmittelbar ein in das Leben, in das Arbeitsleben des ganzen Dorfes.
Zuerst kommt es darauf an, die äußere Lage der unteren Volksschichten zu bessern, die notwendigsten wirtschaftlichen Vorbedingungen für ihre geistige und sittliche Hebung zu schaffen, denn „im Sumpf des Elends wird der Mensch kein Mensch“. Aber dazu muss vor allem die eigene Tätigkeit des Volkes aufgerufen und kräftig in Anspruch genommen werden; alle Hilfe, die man ihm bietet, darf nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. Einer solchen Hilfe bedurfte es allerdings bei der gegebenen Lage. In einem stabilen Zustand, bei überwiegend ländlicher Arbeit gibt es eine ständige Fortpflanzung der sehr einfachen und stetigen, diesem Zustand genügenden Bildung des Landvolkes. Erst die große, damals bereits allenthalben sich ankündigende Umwälzung der Wirtschaft vom Landbau zur Industrie war es, die eine ernste Krise auch in der Erziehung des arbeitenden Volkes heraufgeführt hatte. Das unvermittelte, unvorbereitete Eindringen der Industriearbeit und des Industrieverdienstes in eine bloß auf den Feldbau innerlich eingerichtete und gerüstete Bevölkerung, das war der Nährboden, in dem alle sozialen Übel wuchern konnten. Da also mussten Gesetzgebung und Erziehung mit genau ineinandergreifenden Maßregeln einsetzen. Aus diesem Zusammenhang begreift es sich, weshalb Pestalozzi in dieser Zeit auf die Bildung zur gewerblichen Arbeit ein so starkes Gewicht legt und die ganze häusliche und Schulbildung ihr schlechthin unterordnen will. Er war nicht der Rousseauschen Überzeugung von der notwendigen Unterordnung der Berufsbildung unter die humane Bildung etwa untreu geworden. Die Unterordnung der Schulbildung, des Wortwissens unter die Berufsbildung steht vielmehr in bestem Einklang mit der Unterordnung der Berufsbildung selbst unter den schließlichen Zweck der Menschenbildung. Die Berufsbildung ist nur das erstwesentliche Mittel, auf Grund dessen allein hernach die höhere Schule des Lebens den Menschen zur „ganzen Befriedigung seiner Menschheit“ führen kann. Denn „die Lebenspflichten des Menschen sind der einzige echte Lehrmeister ihres Wissens und ihrer besten Erkenntnisse“. So lässt er denn, nach dem Vorbild der Hauserziehung der Gertrud, seinen Schulmeister die berufliche Arbeit geradezu in die Schule einführen. Die Kopfarbeit kommt dabei übrigens nicht zu kurz, und es wird, namentlich im Rechenunterricht, über dem unmittelbaren Zweck der beruflichen doch auch der höhere der menschlichen Bildung nicht vergessen. Vollends die Bildung des „Herzens“, d. h. die sittliche Bildung im Gewande der religiösen, tritt in nicht bloß gleichberechtigter, sondern überragender Stellung neben die des „Kopfes“ und der „Hand“ (eine von da ab ständig wiederkehrende Dreiteilung). Denn „Erziehung und nichts anderes ist das Ziel der Schule; nichts geringeres als das Erziehen der Kinder, und was immer ihr ganzes Erziehen erfordert, liegt im Kreise ihrer Aufgabe“. – Zur Erziehung hilft aber die Schule nur als ein wichtiger Faktor, in genauem Zusammenwirken mit allen übrigen: den wirtschaftlichen Ordnungen, der bürgerlichen Verfassung, Zivil- und Strafgesetzgebung, der Ordnung der gemeinen Zucht und Sitte, endlich der Religion. Und indem nun diese alle als Faktoren einer „höheren Polizei“ (Staatskunst) in einen einzigen Zusammenhang gebracht, auf ein und dasselbe letzte Ziel der Bildung des Menschen zum Menschen, des wilden Triebwesens zum Vernunftwesen, gelenkt werden sollen, so finden wir uns hier recht im Mittelpunkt jener Totalansicht des sozialen Lebens und der sozialen Erziehung, der Erziehung als Gemeinschaft und der Gemeinschaft als Erziehung, welche wir heute mit dem Schlagwort „Sozialpädagogik“ zu bezeichnen pflegen.
Im vierten Teil des Romans (1787) endlich erweitert sich die Betrachtung vom einzelnen Dorf auf ein ganzes Land. Zugleich wagt Pestalozzi am Schluss des Werkes den Versuch einer eigentlichen Theorie, einer „Philosophie“ seines Buches. Diese erfährt noch eine weitere Vertiefung in der (sonst geringeren) zweiten Bearbeitung des Romans (1790-1792). Die soziale Erziehung baut sich danach in drei wesentlichen Stufen auf: 1. „Erziehung“ im engeren Sinne; diese soll wesentlich Hauserziehung sein, die zugleich das Vorbild für die Schulerziehung abgibt. Sie ist aus dem schon angegebenen Grunde vorzugsweise Erziehung zur wirtschaftlichen Arbeit. 2. „Regierung“, die in voller Konsequenz gleichfalls dem letzten Zweck der sittlichen Bildung untergeordnet wird. Sie ist hier als Aristokratie vorausgesetzt, aber dies ausdrücklich nur im Hinblick auf die gegebene Lage und mehr im Sinne einer ernsten Warnung: Wollte der Adel sich noch in letzter Stunde auf seine wahre Aufgabe besinnen, so würde es seine Rettung sein; da er sich wirklich nicht darauf besann, so musste er freilich fallen. Das Dritte ist die „Religion“, die hier ganz nur als „Schlussstein“ jener „höheren Polizei“, des Staates im umfassenden und höchsten Sinne als einziger großer Anstalt zur sozialen Erziehung, gedacht ist.
* * *