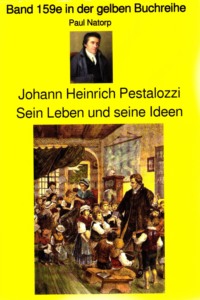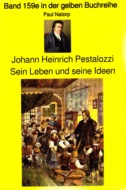Kitabı oku: «Paul Natorp: Johann Heinrich Pestalozzi, Sein Leben und seine Ideen», sayfa 3
Pestalozzi und die Revolution
Pestalozzi und die Revolution
Wie in seinem Roman, so sieht Pestalozzi durchweg in dieser Zeit die Fragen der Erziehung im engsten Zusammenhang mit denen der Wirtschaft und der Politik. Die schon genannten Schriften: „Über Gesetzgebung und Kindermord“ (gedr. 1783), dann das zweite Volksbuch „Christoph und Else“ (1782), ferner eine Reihe von Aufsätzen der im Jahre 1782 herausgegebenen (nicht weiter fortgesetzten) Zeitschrift „Ein Schweizerblatt“, kurz alle die zahlreichen Arbeiten aus dieser Zeit zeigen einstimmig diese Richtung und liefern noch viele und wertvolle Beiträge zu dem großen Thema der „sozialen Pädagogik“.
Unablässig, aber vergeblich bemüht sich dabei Pestalozzi um eine erneute praktische Wirksamkeit. An den Illuminatenorden wendet er sich, durch diesen an den österreichischen Staatsmann Grafen von Zinzendorf; dem Großherzog von Toskana, nachmaligen Kaiser Leopold II., legt er verschiedene Denkschriften über sozialpolitische Fragen in derselben Absicht vor. Die Eindrücke der französischen Revolution konnten ihn in der allgemeinen Richtung seiner Forschung auf soziale und politische Fragen nur bestärken, obgleich der Gesichtspunkt der Menschenbildung für ihn stets der beherrschende blieb. Die Briefe an Fellenberg aus dem Anfang der neunziger Jahre geben Kunde von seiner starken Anteilnahme an den Ereignissen in Frankreich. Sehr ernstlich fasst er dann – nachdem er 1792 neben Schiller und Klopstock Ehrenbürger der französischen Republik geworden ist – das Problem der französischen Revolution ins Auge in der werkwürdigen (damals übrigens nicht zur Veröffentlichung gelangten) Schrift „ Ja oder Nein“ (geschrieben „im Hornung 1793“). Den bedeutendsten Anlauf aber zu einer „Philosophie seiner Politik“ nimmt er in dem um dieselbe Zeit entworfenen, 1797 gedruckten Buche „Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts“, welches von Herder, der es rezensierte, mit vollem Recht eine „Geburt des deutschen philosophischen Genius“ genannt wird.

(Band 158e in dieser gelben Buchreihe)
Von Rousseau nimmt Pestalozzi auch hier seinen Ausgang; gleich ihm stellt er den „gesellschaftlichen“ Zustand des Menschen in schroffen Gegensatz zum „natürlichen“; auch die Erklärung des ersteren durch den Grundbegriff des „Vertrags“ (d. h. der gegenseitigen Bindung) teilt er mit ihm. Aber er schreitet dann über Rousseau wesentlich hinaus, indem er jenen beiden, dem natürlichen und gesellschaftlichen Stande, als dritten, gänzlich heterogenen, den sittlichen Stand entgegengestellt, der beide überwinden, aber nicht etwa zunichtemachen, sondern in seinen Dienst nehmen, die „Natur“ und die bürgerliche Verfassung des Menschen als bloße Mittel dem einzigen Endzweck seiner reinen sittlichen Bildung unterwerfen soll; worin man sofort den Grundgedanken der „Abendstunde“ wie des Romans in nur vertiefter und geklärter Gestalt wiedererkennt. In dem Gedanken der Autonomie des Sittlichen, auch in der hier wieder besonders tiefen und großartigen Aufhellung der Religion aus dem Gesichtspunkte der Sittlichkeit, begegnet sich Pestalozzi offenbar mit Kant. Auch ist dies Zusammentreffen nicht mehr ganz ein unbewusstes. Gerade während der Abfassung dieses Buches hatte Pestalozzi in eingehenden Unterredungen mit dem jungen Fichte sich überzeugt, „sein Erfahrungsgang habe ihn im Wesentlichen den Resultaten der Kantischen Philosophie nahe gebracht“ (an Fellenberg, 16. Januar 1794). – Ein weiteres interessantes Denkmal aus dieser bewegten Zeit sind die „Figuren zu meinem Abc-Buch“ (1797), später „Fabeln“ betitelt, geistreiche politische Satiren in Form von Tierfabeln oder richtiger Parabeln.
An den Streitigkeiten, die um diese Zeit zwischen den Regierenden der Stadt Zürich und der Landbevölkerung am See ausbrachen (den „Stäfner Unruhen“), war Pestalozzi, der sich damals viel im Hause seines Oheims Hotz in Richtersweil aufhielt, persönlich beteiligt; er hat Hand in Hand mit dem alten Freunde Lavater die größten Anstrengungen gemacht, nach beiden Seiten versöhnend, aber so viel möglich im Sinne der freiheitlichen Grundsätze zu wirken. Inzwischen griff die revolutionäre Bewegung von Frankreich nach der Schweiz hinüber. Im März 1798 erfolgte die Proklamation der einen unteilbaren Helvetischen Republik durch die Franzosen. Pestalozzi hatte den Sieg der Freiheit nicht von dieser Seite und nicht in dieser Form herbeigewünscht; aber es galt jetzt aus der einmal geschehenen Umwälzung das Beste zu machen, was sich daraus machen ließ. Und wenigstens entfachte der politische Sturm ein neues Bestreben auf Hebung der Volkserziehung. Das war der Augenblick, wo der bereits 52jährige, den man überall „unbrauchbar“ befunden hatte, hoffen durfte, wieder für brauchbar erkannt zu werden. Er stellte sich der Regierung zur Verfügung zu einem neuen Versuch der Erziehungsarbeit am niederen Volk. Die damals leitenden Männer, besonders der hochgesinnte Minister der Künste und Wissenschaften, Stapfer, brachten ihm Verständnis und Wohlwollen entgegen.

Philipp Albert Stapfer – 1766 – 1840
Einstweilen beschäftigte man ihn, durch Flugschriften das Volk über die Absichten und Maßnahmen der neuen Regierung aufzuklären und in vorsichtigerweise für diese zu gewinnen. Seit September 1798 gab Pestalozzi, der in dieser Zeit in Aarau wohnte, mit Regierungsunterstützung das „Helvetische Volksblatt“ heraus, für welches er wieder eine Reihe von Aufsätzen selbst verfasste. Die wichtigsten politischen Arbeiten aus dieser Zeit sind die zwei Blätter über den Zehnten (nur das erste damals erschienen), in welchen er nicht ohne Schärfe für gänzliche Abschaffung des Zehnten, für Staatssteuern streng nach dem Maße der Leistungsfähigkeit (progressive Einkommensteuer, mit Steuerfreiheit für ein reichlich bemessenes Existenzminimum) kämpfte.
* * *
Das Wirken in Stanz
Das Wirken in Stanz
Inzwischen trat ein Ereignis ein, das, obgleich erschütternd für sein patriotisches Gemüt, doch dadurch für ihn hochbedeutsam wurde, dass es seinem heißen Verlangen nach einem unmittelbar praktischen Wirken als Volkserzieher endlich die Erfüllung brachte. Nach der Niederwerfung des gegen die neue Verfassung aufsässigen Stanz im September 1798 gab es dort über 400 Kinder, deren Eltern im Krieg umgekommen oder ganz verarmt waren. Pestalozzi bat nun, ihn dorthin, wo Hilfe so not tat, zu entsenden, um sich dieser verlassenen Kinder anzunehmen. Die Bitte wurde gewährt; noch im Dezember 1798 begab sich Pestalozzi nach Stanz, wo er nach notdürftiger Herrichtung der erforderlichen Baulichkeiten beim dortigen Frauenkloster 1799 seine Arbeit mit Feuereifer begann.

Man war erstaunt, wie viel er in kurzer Frist mit den gänzlich verwahrlosten Kindern erreichte. Der sichtliche Erfolg hob seinen Mut. Zwar erschien sein Tun noch gänzlich planlos; der Plan sollte ihm aus seinen Erfahrungen erst erwachsen, und da sollte ihm niemand dreinreden. Irgendeine Hilfe hätte er vorerst gar nicht annehmen können, da er noch nicht so weit war, von dem, was zu tun sei, sich selbst, geschweige anderen bestimmte Rechenschaft geben zu können. Auch diesmal war ihm leider nicht vergönnt, seinen Versuch ruhig zu Ende zu führen. Die Kriegswirren störten herein, die Räumlichkeiten der Anstalt wurden für ein Lazarett in Anspruch genommen; gleichzeitig war Pestalozzi von der ungeheuren Anstrengung bis zum Blutspeien erschöpft und musste auf dem Gurnigel Erholung suchen. Als dann der Waffenlärm sich wieder verzogen hatte und er die nur aus Not auf Zeit verlassene Arbeit wieder aufnehmen wollte, hieß es, er sei als Protestant in dem ganz katholischen Ländchen für einen solchen Posten nicht geeignet, und dergleichen mehr; kurz er wurde, trotz warmer Fürsprache Stapfers, nicht wieder nach Stanz zurückgelassen. Mit Mühe erwirkte ihm der Minister stattdessen die Erlaubnis, an den geringsten Winkelschulen des Städtchens Burgdorf seine Versuche einstweilen fortsetzen zu dürfen.
Das kurze Wirken in Stanz, über das er in einem damals verfassten, später (1807) durch Niederer veröffentlichten Aufsatz („Pestalozzis Brief an einen Freund über seinen Aufenthalt in Stanz“) höchst lebendigen Bericht gibt, wurde für das Innere seiner Absichten hochbedeutsam. Denn hier entstand ihm zuerst die Idee, die sein ganzes ferneres Wirken bestimmt und die er fortan stets als die Grundidee seiner gesamten Erziehungsforschung und Erziehungsarbeit betont: die „Idee der Elementarbildung“. Zwar ist es nicht (wie Niederer meinte und dann diesem oft nachgesprochen worden ist) etwas absolut Neues, was er von jetzt ab erstrebt. Namentlich ist seine frühere Absicht, die kindliche Unterweisung streng an die Bildung zur wirtschaftlichen Arbeit anzuknüpfen und der Wohnstubenerziehung genau nachzubilden, keineswegs aufgegeben. Aber es wird ungleich bestimmter als bisher erkannt und durchgeführt, dass die Bildung des Kopfes wie des Herzens und der Hand von den ersten, einfachsten „Elementen“ ausgehen und von da in „lückenlosem Fortschritt“ zu allen höheren Stufen erst emporsteigen muss; und die Forschung nach diesen Elementen und diesem geregelten Fortschritt ist es, die von diesem Zeitpunkt an beherrschend in die Mitte seiner praktisch-pädagogischen Versuche wie seiner theoretischen Erwägungen tritt. Eben da seine Erzieherarbeit sich an die Kleinsten der Kleinen, an die Geringsten der Geringen wandte, so war es notwendig, bis zu den denkbar schlichtesten Anfängen zurückzugehen; in diesen elementaren Anfängen aber – das erkennt er jetzt – liegt gerade die höchste Kraft; denn sie enthalten als Keime die ganze fernere Entwicklung in sich. Diese Anfänge sind in Wahrheit Ursprünge, und darum nicht bloß für den Beginn der Erziehung, sondern für ihren ganzen Verlauf vor allem anderen wichtig.
Mit dem Begriff der „Elementarbildung“ aber entsteht ihm zugleich sein neuer Begriff der „Anschauung“, der in den früheren Schriften nur hier und da von fern anklingt, von jetzt ab aber als unterscheidender Grundbegriff der Pestalozzischen Erziehungslehre bestimmt und sicher hervortritt. Ganz falsch nimmt man Pestalozzis „Anschauung“ für ein und dasselbe mit der sinnlichen Wahrnehmung. Dass von der Erfahrung, das heißt, von den Wahrnehmungen der Sinne, alle menschliche Erkenntnis, also alle menschliche Bildung anfangen müsse, diese Einsicht war nichts weniger als neu; das hatten von Aristoteles an nicht bloß die Mehrzahl der Philosophen, sondern auch alle denkenden Pädagogen angenommen; Comenius hatte es nachdrücklich betont, und seit Rousseau und den Philanthropinisten war es sozusagen die allgemeine Losung des Zeitalters geworden.

Johann Amos Comenius – 1592 – 1670
Aber für Pestalozzi bedeutet die „Anschauung“ von Anfang an mehr; sie bedeutet die Betätigung, das Zurtatwerden der Idee; diese geht nicht bloß im Lehrenden voran, als solle er sie nun in den Lernenden von außen hineinbringen, sondern sie liegt der Anlage nach ursprünglich im Lernenden selbst zugrunde, und die sinnliche „Anschauung“ ist bloß ihre Betätigung im Konkreten, an der nur darum die Idee ihm bewusst werden kann, weil sie von Anfang an als gestaltende Kraft in ihr wirkt und lebt. Diese Auffassung der „Anschauung“, die im Briefe über Stanz zum ersten Mal klar zutage tritt, versteht sich allein aus dem Zusammenhange einer idealistischen Ansicht von der Erkenntnis etwa im Sinne Kants, dessen Gedanken Pestalozzi, ohne je dem Buchstaben nach Kantianer zu sein, doch der allgemeinen Richtung nach in sich aufgenommen und als mit der uranfänglichen Tendenz seines eigenen Bestrebens einig erkannt hatte. War es doch nur die klare Konsequenz der seit der „Abendstunde“ von ihm bekannten Überzeugung, dass im „Innern der Natur“ des Menschen – jedes Menschen – von Anfang an der Keim der ganzen menschlichen Entwicklung liege, dass er hinsichtlich dieser wesentlich „Werk seiner selbst“, nicht einer ihm äußeren „Natur“ oder gar der Gesellschaft sei; dass zwar ihn die Umstände „machen“ helfen, aber nur indem zuerst er die Umstände so gemacht hat, wie sie zu seiner Bildung (die immer wesentlich Selbstbildung bleibt) ihm dienlich sind. Dieser autonomistische und damit idealistische Grundzug der Pestalozzischen Pädagogik darf nicht verwischt werden.
* * *
Das Wirken in Burgdorf – „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“
Das Wirken in Burgdorf – „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“
Pestalozzi brannte auf die vollständigere Durchführung der in Stanz nur erst begonnenen Erfahrungen. Er ging in Burgdorf sofort mit ungestümem Eifer wieder ans Werk und in immer erneuten, anfangs zwar noch unsicher tastenden Versuchen gestaltete sich seine „ Methode“ allmählich fester und fester. Schon bestimmter formuliert er jetzt jene beiden Grundforderungen: das Ausgehen von den „Elementen“ und das lückenlose, stetige Fortschreiten von diesen zu allen höheren Stufen des Unterrichts; das Prinzip des „physischen Mechanismus“, wie er in einem freilich missverständlichen und tatsächlich vielfach missverstandenen Ausdruck es nennt. Solche bestimmte „Reihenfolgen“ für die einzelnen Hauptfächer des Unterrichts festzustellen, das war jetzt das Nächste, worauf seine Forschung sich richtete, und was nach manchen vergeblichen Versuchen immer sicherer gelang. Seit dem Frühjahr 1800 half ihm dabei mit ausgezeichnetem Verständnis der treffliche Krüsi, dann Tobler und Buß, und im Oktober desselben Jahres durfte er mit diesen Gehilfen auf dem Burgdorfer Schloss, das ihm von der Regierung für seinen Zweck zur Verfügung gestellt wurde, eine eigene Anstalt eröffnen.

Sein Tun erregte sofort Aufmerksamkeit nicht bloß in der Schweiz, sondern weit darüber hinaus, namentlich in Deutschland; Zöglinge kamen in Fülle, Besucher drängten sich heran, die Augenzeugen seiner Versuche sein wollten und oft begeisterte Berichte über ihre Beobachtungen in die Öffentlichkeit brachten.
Die wichtige Denkschrift „Die Methode“, datiert 27. Juni 1800, gibt zuerst von den neuen Grundsätzen seines Verfahrens Rechenschaft. Was aber hier nur erst in knappem Entwurf vorliegt, wurde dann ausführlich entwickelt in der in den ersten Monaten des neuen Jahrhunderts niedergeschriebenen, im Oktober 1801 erschienenen größeren Schrift „ Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“. Sie galt und gilt allgemein und mit Grund als Hauptdokument für das, was Pestalozzi seine „Methode“ nennt. Sie stützt sich ganz auf seine Erfahrungen und Versuche, aber sucht sich über diese doch in einigem Maße auch theoretisch klar zu werden. Das wurde ihm, dem das Theoretisieren stets ein ungewohntes Geschäft war und blieb, freilich etwas schwer, und es ist zumal bei der Eigenheit seiner Darstellung, die sehr oft den gebrauchten Kunstwörtern einen vom üblichen abweichenden Sinn beilegt, leicht begreiflich, dass über die Bedeutung seiner Prinzipien vielfach hat gestritten werden können. Doch darf jetzt so viel als ausgemacht gelten, dass seine Grundüberzeugung hinsichtlich des Entwicklungsganges der Erkenntnis die idealistische und daher wesentlich einig ist mit der Kants, die ihm auf mancherlei Wegen bekannt werden konnte und nachweislich bekannt geworden ist, die er aber schließlich weder aus Büchern noch aus persönlichen Anregungen philosophisch geschulter Freunde geschöpft, sondern, nachdem er sie sich in der Hauptsache selbständig errungen hatte, erst hinterher durch einige von Kant herrührende, übrigens nicht in buchstäblicher Fassung von ihm übernommene Formulierungen sich deutlicher zu machen versucht. Die „Form“ des Unterrichts, die er sucht, hat ihren Grund in der allgemeinen „Form“ der Erkenntnis; diese entwickelt sich zwar in und an der „Anschauung“, aber erwächst nicht aus dem Sinnlichen dieser Anschauung, sondern liegt von Anfang an in der „allgemeinen Einrichtung“ oder „Grundlage“ unseres Geistes, „vermöge welcher unser Verstand die Eindrücke, welche die Sinnlichkeit von der Natur empfängt, in seiner Vorstellung zur Einheit, das ist zu einem Begriff auffasst“ (eine ziemlich genaue Wiedergabe des Kantschen Grundprinzips der „synthetischen Einheit“), und erst dann, durch nachfolgende Analyse, sich auch „deutlich macht“. Auf diese Weise ist jede Linie, jedes Maß, jede Zahl, jedes Wort „Resultat des Verstandes“ aus „gereiften Anschauungen“, und somit die Grundsätze des Unterrichts von der „unwandelbaren Urform der menschlichen Geistesentwicklung“ zu abstrahieren. So wird der Unterrichtsgang „reiner Verstandesgang“; durch ihn wird die „Anschauung selber dem Schwanken ihrer bloßen Sinnlichkeit entrissen und zum Werk“ (zur eigenen Schöpfung) ... „des Verstandes gemacht“; eine geradezu schroff idealistische Beschreibung des Ganges der Erkenntnisgewinnung, die mit irgendeiner sensualistischen Ansicht nicht sollte verwechselt werden können. [Genaueres darüber in meiner Biographie, Kap. 5, in den Gesammelten Abhandlungen, VI, und im nächsten Kapitel.]
Großes Gewicht legt Pestalozzi sodann auf die Festlegung der „Elementarpunkte“ der menschlichen (Verstandes-)Bildung; als solche gelten ihm genau die drei: die Zahl, die Form (i. e. S.: die Raumform) und das Wort der Sprache. Irrtümlich hat man diese drei als gleichwertig nebeneinanderstehend aufgefasst und sich dann über die Zusammenstellung so ungleichartiger Dinge nicht ohne Grund gewundert. Aber die ursprüngliche Gestaltung des Gegenstandes in der Erkenntnis soll offenbar die durch Zahl und Form allein sein; erst eine wiederholende Nachschöpfung (und dann auch Weiterfühlung) dieser ersten Schöpfung, von dieser durchaus abhängig, ist die Leistung der Sprache, wobei in erster Linie an die Begriffsfassung, ja geradezu an die kategoriale Bestimmung des Gegenstandes gedacht ist. In der näheren Ausführung freilich legt Pestalozzi – zum Teil in auffallendem Maße sich selbst missverstehend – auf das Lautliche bei der Sprache und dann auf die Nomenklatur ein übertriebenes Gewicht, überhaupt steht die Bearbeitung der Sprachlehre in dieser Hauptschrift und auch in den weiteren, mit Ausdauer durch sein ganzes ferneres Leben fortgesetzten Versuchen entschieden zurück gegen die des mathematischen Unterrichts, die fast überall in die Tiefe der Sache führt und auch in der Einzelausführung sich fast in jedem Punkte probehaltig erweist. In Pestalozzis „Abc der Anschauung“ liegt der tiefe und wahre Gedanke, dass alle „möglichen“ Form- und Zahlverhältnisse sich aus wenigen einfachsten Grundelementen in zwingender Folgerichtigkeit aufbauen müssen, und zwar in engster Wechselbeziehung die Grundverhältnisse der Form zugleich mit denen der Zahl und umgekehrt; so zwar, dass die Zahl die Denkfunktion selbst in ihrer Reinheit, die Form deren zugleich anschaulich konkrete Darstellung vertritt, welches beides, ganz wie Kant es verstanden hatte, nur in enger wechselseitiger Beziehung zueinander zu seiner gesetzlichen Gestaltung und Entfaltung gebracht werden könne. So ist die Idee der Elementarbildung, wenigstens was die Ausbildung des Verstandes betrifft, bis zu einem gewissen Punkte richtig durchgeführt. Die entsprechende Durchführung in Hinsicht der technischen und namentlich der sittlichen Bildung wird als Forderung aufgestellt, und wenigstens die letztere in den Grundlinien auch angedeutet. In der Praxis der Pestalozzischen Anstalt freilich trat gegen die Pflege der Mathematik und des mathematischen Zeichnens, die schon früh eine hohe Vollendung erreichte, einstweilen fast alles andere in den Hintergrund, so dass sogar der falsche Schein aufkommen konnte, als werde das, was doch stets für Pestalozzi die große Hauptsache gewesen war, die sittliche Bildung und zwar auf der Grundlage der Arbeitsbildung, jetzt von ihm vernachlässigt und hintangesetzt. Doch müsste man nicht nur den ganzen früheren und späteren Pestalozzi, sondern auch die letzten Abschnitte der Hauptschrift selbst völlig übersehen oder nicht verstanden haben, um diesen Vorwurf irgend als begründet gelten lassen zu können.
Ganz den Grundsätzen der Hauptschrift entsprechen die in dieser bereits angekündigten, 1803 und 1804 erschienenen „Elementarbücher“: das „Buch der Mütter“ und die beiden „Anschauungslehren“ der Maß- und Zahlverhältnisse. An ihrer Ausarbeitung waren die Mitarbeiter Pestalozzis stark beteiligt, doch rühren die Einleitungen von Pestalozzi selbst her und ist auch das übrige wenigstens seinen damaligen Überzeugungen sicher entsprechend. Nicht von ihm, sondern von Krüsi stammt der auffällig verfehlte, gleichwohl von ihm selbst aufgenommene Gedanke, die früheste Bildung der kindlichen Begriffe an das Studium des eigenen Körpers des Kindes zu knüpfen. Übrigens ist der Gehalt des „Buches der Mütter“ in diesem Fehlgedanken keineswegs erschöpft; namentlich sollten die (von Pestalozzi selbst herrührenden) vortrefflichen Ausführungen über die frühe Bildung der Sinne nicht übersehen werden.
Seit dem Erscheinen des bei allen sachlichen und formalen Mängeln hochbedeutenden, auch durch die Wärme und Persönlichkeit der Darstellung fesselnden Buches („Wie Gertrud usw.“, von den Zeitgenossen kurz „Gertrud“ zitiert) wuchs der Ruf der Pestalozzischen Anstalt zusehends. Auf die allgemeine Würdigung Pestalozzis übten wohl den stärksten Einfluss der Bericht des Dekans Ith von Bern (1802, Neudruck 1902) und Anton Gruners „Briefe aus Burgdorf“ (1804). Beide Männer, bis dahin eifrige Anhänger der herrschenden rationalistischen Pädagogik, waren höchst misstrauisch nach Burgdorf gekommen, beide gingen als überzeugte Anhänger Pestalozzis und eifrige Fürsprecher seiner Sache.

Gottlieb Anton Gruner – 1778 – 1844
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Anton_Gruner
Gruner besonders hat die Formeln geprägt, in denen man den Unterschied der Lehrart Pestalozzis von der gemeinhin herrschenden auszudrücken liebte: Er strebe intensive Bildung an, nicht bloß extensive, formale statt materialer; er gehe aus auf die Entwicklung der Denk- und Erkenntnis kraft und lege nicht den Schwerpunkt in das zu erkennende Objekt. Auch darüber sind alle Urteilsfähigen in jener Zeit einig, dass unter Pestalozzis „Anschauung“ etwas wie Kants „reine“ Anschauung und nicht empirische Wahrnehmung zu verstehen sei. Pestalozzi selbst hat dies wohl am deutlichsten zum Ausdruck gebracht in der im Dezember 1802 für einige Pariser Freunde aufgesetzten Denkschrift „Wesen und Zweck der Methode“.
* * *
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.