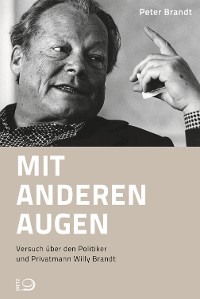Kitabı oku: «Mit anderen Augen», sayfa 3
Die Unterkunft während dieses norwegischen Gebirgsurlaubs war eine Holzhütte, die der Osloer Regierung gehörte, mit offenem Kamin als Heizung (eine Heizung war auch im Sommer dringend erforderlich) und Außenklo. Ich erhielt den Titel »Dr. W. C.«, weil ich mich, um anderer Hausarbeit zu entgehen, bereit erklärte, jeweils den Eimer mit den Fäkalien zu entsorgen. Da diese Art Hütten niedrig gebaut sind, stieß sich mein Vater beim Gang von einem Raum in den anderen fast regelmäßig den Kopf. Dabei fluchte er wahlweise auf Deutsch »Scheiße!« oder »Mist!« oder auf Norwegisch »Fan!«, was soviel wie »Teufel« bedeutet und ein ziemlich drastischer Fluch ist.
1963 war ich nur noch zur Hälfte dabei. Die ersten drei Wochen der Ferien fuhr ich mit den »Falken« in das jährliche große Sommerlager, diesmal im Allgäu, in der Nähe von Füssen, wo ich ein Zelt mit gleichaltrigen Insassen zu leiten hatte. Das war keine leichte Aufgabe für einen Vierzehnjährigen. Anschließend stieß ich zu den Eltern und Geschwistern, die in Alpbach in Tirol Urlaub machten. Dort pflegte sich auch der Schriftsteller Arthur Koestler mit seiner südafrikanischen Frau zu erholen. Koestler, der sich bei Vater später schriftlich für die »eigenhändig« gefangenen Fische bedankte, kam mir reichlich überspannt vor. Als bekehrter Exkommunist entgegnete er heftig auf meine sicher etwas grobschlächtige Kritik am »freien Westen«. Mit blitzenden Augen hielt er mir vor, es seien »junge Burschen« wie ich gewesen, die beim Ungarn-Aufstand im Herbst 1956 auf die sowjetischen Panzer aufgesprungen wären, und verkündete melodramatisch, wenn man das Imperium der Moskowiter nicht abschrecken könne, dann sei es besser, die ganze Erde und mit ihr die Menschheit flöge in die Luft. Koestler war kinderlos …
1964 erwarb meine Mutter in der norwegischen Mittelgebirgslandschaft Vangsåsen, nahe ihrer Heimatstadt Hamar, zwei Hütten mit Grundstück, wovon eine in mehreren Schritten zu einem veritablen Wohnhaus ausgebaut wurde. Ab 1965 standen sie den Familienangehörigen und engeren Freunden für Winter- oder Sommerurlaube zur Verfügung. Für Mutter waren sie ein Refugium, wohin sie sich mit Matthias Jahr für Jahr in fast allen Schulferien zurückzog. Auch die älteren Söhne nutzten das Domizil ausgiebig. Im Sommer pflegte Vater wenigstens eine gewisse Zeitlang dort zu sein. Obwohl er eine starke Verbindung mit Norwegen hatte, meinte ich zu spüren, dass er sich nicht uneingeschränkt wohlfühlte. Wenn sich unsere Aufenthalte überschnitten, stellte ich dieselbe Rückzugstendenz fest, wie ich sie auch sonst zunehmend wahrnahm. Zwischendurch war er dann wieder ganz der Alte, den ich aus der Kindheit kannte. Norwegen und erst recht das Ferienhaus waren untrennbar mit Rut verbunden, und so verwundert es nicht, dass er mit Brigitte in Südfrankreich 1983 etwas Neues kaufte, wo es warm war (was er im Alter mehr schätzte als früher) und woran sie gleichermaßen hingen.
Das Spiel mit starkem Körpereinsatz – wie das Spielen überhaupt – war nicht so sehr Vaters Sache. Doch er ließ sich leicht anstecken, wenn andere Erwachsene dabei waren. 1960 unternahmen wir mit der eng befreundeten Nachbarsfamilie eine Urlaubsreise in den Lungau, den südöstlichen Teil des Landes Salzburg. Ich erinnere mich an manches Versteck- und Geländespiel mit Vätern und Söhnen und sehe heute noch das vergnügte Gesicht meines Vaters vor mir, als er es einmal schaffte, die sehr viel wendigeren und schnelleren Jungen zu überlisten.
Die Familie Bohmbach, mit der zusammen wir den Urlaub verbrachten, wohnte in der anderen Hälfte des Reihenhauses in der Marinesiedlung (Berlin-Schlachtensee), das die Brandts von 1955 bis 1964 bewohnten. Davor war eine etwas kleinere Wohnung an anderer Stelle der Siedlung unser Domizil gewesen. Danach – bis 1966/67 – wohnten wir in einer Dienstvilla in Grunewald, wo der Senat neben einem großen Gästehaus ein auf der anderen Seite desselben Grundstücks gelegenes Haus erworben hatte, das der als »Zuckerkönig« bekannte frühere Eigentümer einst für seinen Chauffeur und Hausmeister hatte errichten lassen. Dieses stand künftig dem Regierenden Bürgermeister zur Verfügung. Es war mehr als ausreichend für eine mehrköpfige Familie. Während ich in Grunewald weder die Namen der Nachbarn nennen konnte noch wusste, wie sie aussahen, kannte man in der Marinesiedlung, die voll von Kindern war, jeden.
Bohmbachs schienen auf den ersten Blick nicht wie geschaffen für eine Freundschaft mit den Brandts: eine seit Generationen etablierte bürgerlich-katholische Familie. Die Bohmbach-Söhne Michael und Christian waren allerdings mit den Brandt-Söhnen dick befreundet, der ältere merkwürdigerweise hauptsächlich mit Lars, während die weniger als ein Jahr auseinanderliegenden Christian und Peter gut zusammenpassten. Vater Hans Eberhard Bohmbach war ein einnehmender, gutaussehender Mann, erkennbar wenig von Selbstzweifeln geplagt, erfolgreicher Rechtsanwalt und Notar, ein Mensch konservativer Lebens- und Weltanschauung. Seine Distanz zur Berliner CDU begründete er mir gegenüber einmal damit, dass deren Spitzenmann Franz Amrehn ein »Prolet« sei, wie immer das gemeint war. Als gläubige Katholiken waren Eberhards Eltern keine NS-Anhänger gewesen, nicht zuletzt auch deswegen, weil ihnen die Nazis zu primitiv waren. Im Krieg hatte Eberhard Bohmbach als Kriegsfreiwilliger gekämpft, zuletzt als Panzergrenadier an der Westfront, wo er schwer verwundet wurde. In der Nachkriegszeit fuhr er mit seinem Jungen mehrfach zu Veteranentreffen.
Mit diesem Mann schloss Willy Brandt eine zwar nicht intime, aber auch nicht ganz oberflächliche Freundschaft. Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie unter vier Augen offen über ihre früheren Lebensphasen sprachen. Ideologie hin oder her – die beiden mochten sich einfach. Willy schenkte Eberhard beim Auszug aus dem Marinesteig seinen dort benutzten Schreibtisch. Trotzdem wären sich diese Männer vermutlich nicht näher gekommen, wenn nicht ihre Ehefrauen Rut und Marianne beste Freundinnen geworden wären. Ich glaube, sie hatten keinerlei Geheimnisse untereinander, und es gab keine Sorgen, die sie nicht teilten und dadurch erleichterten. Zwischenzeitlich wurde sogar erwogen, die Wand zwischen den beiden Häuserhälften zu durchbrechen und so eine Art doppelfamiliäre Wohngemeinschaft aufzumachen.
Zur Familie Brandt gehörte fast von Anfang an Martha Litzl. Sie war unsere Haushälterin. Martha war auf einem Bauernhof in der Neumark aufgewachsen und hatte ihren Mann im Krieg verloren. Sie nahm sich der Brandt-Kinder an, als wären es ihre eigenen, harmonierte bestens mit der »Chefin«, die selbst keine Hausarbeit verschmähte – sie kochte gut und putzte unschlagbar gründlich – und verehrte den Herrn des Hauses. Wenn sie morgens früh um 5 Uhr aufstand, so erzählte sie mir später, hätte oft noch die Schreibmaschine geklappert, und sie riet mir, ebenso viel zu arbeiten wie mein Vater, wenn ich etwas werden wollte. Ein anderes Mal mahnte sie allerdings, ich solle bloß nicht so viel schuften wie der Vater, sondern auch die angenehmen Seiten des Lebens auskosten.
Wie dem auch sei. Litti, wie wir Kinder sie nannten, musste krankheitshalber zurückstecken, als sie etwa fünfzig war, und kam nur noch ein oder zwei Tage in der Woche, um das Kommando zu übernehmen, und tat das auch später noch in Bonn. Seitdem gab es ein junges Hausmädchen. Ursel, die von 1958 bis 1961 bei uns und mit uns lebte, war für Lars und mich wie eine große Schwester, und meine Mutter nahm sie wie ihre Nachfolgerinnen unter ihre Fittiche.
Ich habe mich manchmal gefragt, welche Einstellung Vater zu Martha Litzl hatte. Es erschließt sich mir auch nicht aus den Briefen, die er seiner Frau schrieb, wenn diese in Norwegen weilte. Dass er Litti respektierte, wie er andere Menschen stets respektierte, und ordentlich behandelte, steht für mich außer Frage. Doch eine emotionale Bindung konnte und kann ich nicht erkennen. Das scheint mir auch für die Chauffeure und Sicherheitsbeamten zuzutreffen, die ihm im Laufe seiner Berliner und Bonner Dienstexistenz zugeteilt waren. Das Verhältnis zu den jeweiligen Sekretärinnen schien mir teilweise persönlicher zu sein, vielleicht bedingt durch den berufsmäßig ständigen engen Kontakt.
Ich hatte in den späten fünfziger Jahren nicht das Gefühl, dass die berufliche Stellung des Vaters mich in meinen kindlichen Aktivitäten nennenswert einschränkte. Ich war, obwohl sensibel, das, was man einen »richtigen Jungen« nannte, grobe Streiche, »Mutproben« und »Bandenkriege« inklusive. Mehr unausgesprochen als ausgesprochen gaben beide Eltern mir und meinen Brüdern zu verstehen, dass wir uns auf Vaters Position ja nichts einbilden sollten. Irgendeine Überheblichkeit anderen Menschen gegenüber aufgrund ihrer Hautfarbe, Nationalität, Religion oder gar ihres sozialen Status ist mir zu Hause nicht einmal andeutungsweise begegnet. Auch der Gedanke an Sippenhaftung, etwa im Fall eindeutiger »Nazifamilien«, lag außerhalb des Brandt’schen Horizonts.
Als mein Vater Regierender Bürgermeister wurde, gratulierte mir die Klassenlehrerin in der Grundschule. Ich war ganz verdattert darüber, denn das war ja nicht mein Verdienst. Öfter als mir lieb war, kamen Pressefotografen ins Haus und verlangten irgendwelche mehr oder weniger natürlichen Familiendarbietungen. Das war mir äußerst lästig. Ich fühlte mich fremdbestimmt. Meine Mutter musste manchmal sehr nachdrücklich auf mich einreden, damit ich das Blitzlichtgewitter und die Filmaufnahmen über mich ergehen ließ. Doch das war keine Dauererscheinung. Mein Alltag sonst war kindgemäß.
Als Robert Kennedy, der US-amerikanische Justizminister und Bruder des Präsidenten, im Februar 1962 mit seiner Frau Ethel nach Berlin kam, äußerte er meinen Eltern gegenüber den Wunsch, vor seiner Abreise, die schon für den nächsten Vormittag angesetzt war, die Kinder zu sehen. Den Einwand, diese unterlägen der Schulpflicht, ließ er nicht gelten. Er würde selbst die Entschuldigung schreiben. Nun war ich darüber keineswegs begeistert. Diese Art Aufsehen war mir peinlich. Ich fragte mich, wie das bei der Lehrerschaft ankommen würde. Doch der vereinte Druck der elterlichen Regierung und der amerikanischen Supermacht war zu groß für meinen Widerstand. Lars und ich mussten zu »Bobbys« Verabschiedung zum Flughafen Tempelhof kommen, wo dieser uns ein paar freundliche Worte widmete und hauptsächlich die »Entschuldigung« schrieb: Wir hätten an »sehr wichtigen« Besprechungen teilnehmen müssen, die die »Freiheit der Vereinigten Staaten und Berlins betreffen«. Das war zwar witzig, aber anfangen konnten wir damit nichts.
Eine langjährige Freundschaft ging aus der Verbindung mit Harold, Greta und Kathy Hurwitz hervor, die Willy in seinen Briefen an Harold »die Prinzessin« nannte. Harold, der 2012 starb, war Amerikaner mit ostjüdischem Hintergrund, Sozialist und kam 1946 als Angehöriger der Militärregierung nach Deutschland. In Berlin lernte er seine Frau Margarete (Greta), die aus einer ursozialdemokratischen Familie stammte und ihn mit anderen Sozialdemokraten wie Gustav Klingelhöfer zusammenbrachte, der noch vor der »Zwangsvereinigung« von ostzonaler SPD und KPD mit Grotewohls Linie brach. Von 1946 bis 1951 war er Stadtrat beziehungsweise Senator für Wirtschaft. Auch das Ehepaar Klingelhöfer gehörte zum Freundeskreis meiner Eltern und war Lars und mir sehr zugetan. Ich erinnere mich noch genau, wie der unheilbar krebskranke Gustav mit seiner Frau ein letztes Mal zu uns kam, um bei klarem Verstand Abschied zu nehmen und die Kinder noch einmal zu sehen.
Aber zurück zu Harold Hurwitz. Harold und Willy lernten sich kennen, als mein Vater noch für die Norwegische Militärmission arbeitete. Harold war sein Leben lang so etwas wie ein linker Antikommunist ohne Scheuklappen oder Berührungsängste. Später war ich erstaunt zu erfahren, dass er, der er in den Jahren von McCarthy üblen Verdächtigungen ausgesetzt gewesen war, seine US-Staatsbürgerschaft niemals aufgegeben hatte und ebenso wenig seine jüdische Konfession. Gefühlsmäßig schien er mir mehr als allem anderen der Berliner Sozialdemokratie verhaftet zu sein. Er wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter von Ernst Reuter und Willy Brandt. Später schlug er die Universitätslaufbahn ein. Harold war ein höchst liebenswertes Unikum, über das man ein eigenes Buch schreiben könnte. Die Hurwitzens wohnten ihr Leben lang in Zehlendorf und gingen oft mit Kathy, Lars und mir baden. Harold brachte Lars das Schwimmen bei und forcierte mein frühes Interesse an Geschichte. Er schenkte mir Fritz Fischers Buch über die deutsche Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg. Das war 1961. Ich war keine dreizehn Jahre alt und hatte bis dahin nicht viel vom 20. Jahrhundert wissen wollen, was sich nun langsam änderte.
1956 machten Brandts und Hurwitzens gemeinsam Urlaub auf der dänischen Insel Møn. Harold erzählte Jahrzehnte später, wie die beiden Elternpaare nach einem guten Abendessen in dem gemütlichen Gasthof, wo wir während der Ferien wohnten, ohne Kinder einen Verdauungsspaziergang machen wollten. Willy grübelte über seine Zukunft – er war auf dem Bundesparteitag in München zum zweiten Mal nicht in den SPD-Vorstand gewählt worden und spürte noch die Berliner Fraktionskämpfe in den Knochen. Da hat Harold ihn angeblich mit der Prophezeiung aufzumuntern versucht: »Denk an Churchill, wie lange er warten musste. Eines ist ganz sicher: Außenminister der Bundesrepublik wirst du jedenfalls werden.« Über diese Perspektive verliefen sich die beiden Brüder im Geiste, verloren ihre Frauen aus den Augen, und als sie nach über zwei Stunden in finsterer, kühler Nacht umherirrend wieder am Ausgangspunkt ankamen, fanden sie Rut und Greta vergnügt in einem der großen Betten liegen und sich mit einer Flasche Weinbrand trösten. Harold sagte mir einmal ohne jeden Groll, Willy wäre »immer wieder« ein ausgesprochen zugewandter, wunderbarer Freund gewesen. Aber man hätte nicht darauf vertrauen können, den Faden bei nächster Gelegenheit einfach weiterzuspinnen.
Bei Klaus Schütz lagen politische und persönliche Freundschaft am dichtesten beieinander. Nach meinem Eindruck war Schütz in der Berliner Zeit Willys engster Vertrauter unter den Freunden – dann wurde es Egon Bahr. Klaus Schütz, auch er starb 2012, trat 1946 in die SPD ein, während er ein Studium an der Humboldt-Universität aufnehmen wollte. Er wurde zum Mitbegründer der Freien Universität. Zunächst liebäugelte er mit einem linkssozialistischen Antistalinismus trotzkistischer Observanz, wurde aber über einen Stipendienaufenthalt in Amerika 1949 zum eifrigen Parteigänger Ernst Reuters und Willy Brandts. Klaus Schütz organisierte jahrelang den Machtkampf um den Berliner SPD-Vorsitz, den Willy Brandt schließlich 1958 gegen den früheren Metallarbeiter und erprobten KPD-Bekämpfer Franz Neumann für sich entscheiden konnte.
Auch im Falle Schütz-Brandt waren die Familien miteinander befreundet, jedenfalls neben den Männern auch die Frauen. Wenn Willy Brandt und Klaus Schütz ihre langen Spaziergänge machten, auf denen sie viel (Macht-)Politisches beredeten, nahmen sie mich oft mit, auch als ich schon älter war und anfing, kritisch über das zu denken, was da zur Sprache kam. Als ich meinen Vater einmal auf etwas ansprach, das mich an Schütz irritierte, legte er mir nahe, den vermeintlichen Zynismus mancher Äußerungen von Klaus nicht falsch zu verstehen. Dahinter verberge sich ein ausgeprägtes moralisches Empfinden, das sich mit Zynismen gegen ständige Verletzungen imprägniere. Solche Belehrungen erteilte mein Vater nicht oft – und wenn, dann ohne Zeigefinger. Vielleicht haben sie sich bei mir deswegen so gut eingeprägt, weil er sie so vorsichtig dosierte. Allerdings, so denke ich, wären etwas mehr direkte Orientierungsangebote in manchen Phasen hilfreich gewesen …
Was Klaus Schütz und Willy Brandt um 1960 überlegten, klang in den Ohren eines aufgeweckten Zehn-, Zwölf-, oder Vierzehnjährigen bisweilen recht bizarr. Weil sie sicher sein konnten, dass der andere nichts in den falschen Hals bekam, sprachen sie ohne Vorbehalt und Vorsicht. Von Willys Kanzlerkandidatur war, soweit ich mich erinnern kann, vor dem Sommer 1960 nicht die Rede, jedenfalls nicht in meiner Anwesenheit. Von der programmatischen und strategisch-taktischen Neuaufstellung der SPD sprachen sie dagegen viel und zogen – neben anderem – sogar ein Zusammengehen der SPD mit der Heimatvertriebenenpartei BHE in Betracht. Das war damals nicht ganz so absurd, wie es sich in der Rückschau ausnimmt. Zwischen beiden Gruppierungen gab es inhaltliche Überschneidungen, insbesondere in der Sozialpolitik. Auch koalierten SPD und BHE in mehreren Bundesländern, wie zum Beispiel in Hessen. Schließlich gehörten wichtige Funktionäre des Bundes der Vertriebenen beziehungsweise seiner Landsmannschaften auch der SPD an, so Wenzel Jaksch, der als sudetendeutscher Sozialdemokrat in den dreißiger Jahren einen »volkssozialistischen« Flügel repräsentierte. Jaksch war übrigens im Früherbst 1965 zum letzten Mal bei uns zu Besuch, im Jahr danach kam er bei einem Autounfall ums Leben. Ich will nicht zu viel in solche Episoden hineinlegen. Mir liegt vor allem daran zu illustrieren, wie Willy Brandt um 1960 gemeinsam mit Klaus Schütz Gedankenspiele anstellte, die einem einzigen Ziel dienten: der bundesdeutschen SPD einen Weg aus der Dreißigprozentecke und der strukturellen Minderheitsposition zu eröffnen. Meine Mutter meinte scherzhaft: »Wenn sie das an die Regierung brächte, würden sie sich selbst mit dem Teufel verbünden.«
Im Herbst 1961, kurz nach dem Mauerbau und der verlorenen Bundestagswahl, beschloss mein Vater, im kommenden Januar mit seinem Berater und engen Mitarbeiter Egon Bahr in Tunesien auf der Insel Djerba zwei oder drei Wochen Urlaub zu machen. Verglichen mit dem Tourismus späterer Jahrzehnte war das Land noch ziemlich ursprünglich. Ob er selbst darauf gekommen war oder ob meine Mutter ihm das eingeblasen hatte: Ich als Sohn Nr. 1 sollte mit. Nach einem ausführlichen Antrag an die Schule (»einmaliges Bildungserlebnis«), durfte ich als dritter Mann mitfahren.
Die tunesische Regierung stellte unaufgefordert einen Chauffeur und zwei Sicherheitsleute für uns ab, die wir, in der Annahme, damit auch ihren Rang zu erfassen, Nummer eins, Nummer zwei und Nummer drei nannten. Tatsächlich war Nummer zwei der Chef der kleinen Crew. Einmal zeigte er uns die Narben an seinem Bein, die von Folterungen durch die französische Kolonialmacht herrührten. Wir verbrachten zwei Wochen in einem wunderbar orientalischen Hotel auf Djerba und reisten dann mehrere Tage durchs Land. Es war nicht nur für mich außerordentlich faszinierend. Am Ende der Reise traf mein Vater in Tunis Präsident Habib Bourguiba, der sich schon durch seinen Palast als ein orientalischer Potentat zu erkennen gab, wie er leider auch aus antikolonialen Bewegungen hervorgehen konnte. Der Westberliner Bürgermeister war Anfang 1962 nicht wählerisch, wenn es galt, Unterstützung zu finden.
Meine »objektive Funktion« auf dieser Reise bestand nicht zuletzt darin, bei den gelegentlichen Einladungen durch starkes Essen die Wertschätzung der Gäste für das ihnen Kredenzte glaubwürdig auszudrücken. Ob in einem Beduinenzelt, wo undefinierbare scharfe Gerichte serviert wurden, oder beim Gouverneur von Djerba, der von Soldaten oder Polizisten eine Unzahl von Gerichten in unglaublichen Quantitäten bringen ließ – ich war von Natur aus sehr dünn und konnte folgenlos riesige Mengen verdrücken. Willy und Egon gaben sich ebenfalls Mühe, lagen aber am Folgetag prompt krank darnieder. Nur ich war putzmunter!
Egon Bahr fungierte seit 1960 als Senatspressechef, nachdem er Redakteur beim RIAS gewesen war. Als wir zusammen nach Tunesien fuhren, waren die beiden schon per Du, aber so ganz sicher schien sich mein Vater nicht zu sein, wie vertraulich er mit seinem befreundeten Mitarbeiter und Berater umgehen konnte. Als Egon beim Hochseeangeln besonders viele Fische fing, ernannten mein Vater und ich ihn zu »Dr. Barsch« (natürlich waren es keine Barsche, die er gefangen hatte). Egon wurde des Herumalberns wohl irgendwie überdrüssig, sodass Vater mich, der ich kein Ende finden konnte, unauffällig stoppte. Er war ein sorgsamer Mensch, stets bestrebt, andere weder absichtlich noch unabsichtlich zu beleidigen oder zu verunsichern. Wieder in Berlin, kam Egon Bahr immer häufiger zu uns nach Hause, manchmal auch mit seiner damaligen Frau Dorothea (die sich dauerhaft mit Rut anfreundete), Sohn Wolfgang und Tochter Marion. Ich werde nie vergessen, wie mich Egons Äußerung elektrisierte, nach Adolf Hitler hätte »der Separatist« Adenauer (nebst Ulbricht) am meisten zur Verhinderung der Wiedergeburt Deutschlands als eines einheitlichen souveränen Staates beigetragen. Vater, der dabei war, kommentierte diese Äußerung nicht, obwohl er meine Verwirrung bemerkt haben muss.
Zum Freundeskreis der Familie Brandt gehörten auch nordeuropäische Diplomaten und Journalisten, Iris und Frank Holte, Hjørdis und Oddvar Ås, »Poppi« und Per Monsen aus Norwegen, Christina und Dieter Winter sowie Astrid und Bo Jærborg aus Schweden. Mit den nordischen Freunden sang mein Vater deutsche Volks- und Fahrtenlieder, darunter sein Lieblingslied aus der Jugendbewegung, das auch mein Lieblingslied werden sollte: »Wilde Gesellen«. Dazu spielte er damals noch auf seiner Mandoline.
Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht, Fürsten in Lumpen und Loden, ziehn wir dahin, bis das Herze uns steht, ehrlos bis unter den Boden. Fidel Gewand in farbiger Pracht trefft keinen Zeisig ihr bunter, ob uns auch Speier und Spötter verlacht, uns geht die Sonne nicht unter.
Ziehn wir dahin durch Braus und durch Brand, klopfen bei Veit und Velten. Huldiges Herze und helfende Hand sind ja so selten, so selten. Weiter uns wirbelnd auf staubiger Straß immer nur hurtig und munter. Ob uns der eigene Bruder vergaß, uns geht die Sonne nicht unter.
Aber da draußen am Wegesrand, dort bei dem König der Dornen. Klingen die Fiedeln ins weite Land, klagen dem Herrn unser Carmen. Und der Gekrönte sendet im Tau tröstende Tränen herunter. Fort geht die Fahrt durch den wilden Verhau, uns geht die Sonne nicht unter.
Bleibt auch dereinst das Herz uns stehn, niemand wird Tränen uns weinen. Leis wird der Sturmwind sein Klagelied wehn, trüber die Sonne wird scheinen. Aus ist ein Leben voll farbiger Pracht, zügellos drüber und drunter. Speier und Spötter, ihr habt uns verlacht, uns geht die Sonne nicht unter.
Emotional und intellektuell wichtiger waren für Willy Brandt jedoch die Verbindungen zu politischen Freunden, früheren Genossen der linkssozialistischen SAP, der er ja von 1931 bis 1944 angehört hatte. Stefan und Erszi Szende, beide aus wohlhabenden ungarisch-jüdischen Familien stammend, die fast vollständig in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern ermordet wurden, gehörten dazu. Wie alle linksgerichteten Juden, die ich im Umfeld meines Vaters kennenlernte, so auch Valtr und Luci Taub, waren oder schienen sie areligiös zu sein und im Übrigen völlig frei von antideutschen Affekten. Das Leid, das ihnen vom »Dritten Reich« zugefügt worden war, führten sie – und das war ihnen äußerst wichtig – nicht auf »rassische«, sondern auf politische Verfolgung zurück.
Der undogmatische Denker und Zeitdiagnostiker Fritz Sternberg, der 1963 verstarb, war ein sehr geschätzter politischer Gesprächspartner Willy Brandts, ebenso Irmgard und August Enderle, die mit Vater im Stockholmer Exil gewesen waren und mit ihm zusammen den Weg in die SPD fanden. Der schwäbische Facharbeiter und Gewerkschafter August Enderle gehörte gewissermaßen zum Adel der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung: Von der SPD und USPD ging er zum Spartakusbund und zur KPD, von der KPD zur KPD-Opposition, von dort zur SAP und zur SPD. Das war ein Lebensweg, für den Vater hohen Respekt hatte: seine Grundüberzeugungen nicht aufgeben, auch nicht einer pervertierten Parteidisziplin unterordnen, sondern einen glaubhaften Weg suchen, der sich an den Realitäten orientiert und neue Einsichten zulässt. Ein ganz anderer Typ war Boris Goldenberg. Sein Exilland hieß Kuba, wo er als Lehrer auch den Sohn des Diktators Batista unterrichtete. Er erlebte den Umsturz durch Fidel Castro und erzählte bei Besuchen zum Teil haarsträubende Begebenheiten aus der Zeit des alten Regimes und der Kubanischen Revolution. Der relativ reiche Inselstaat hätte völlig unter Kontrolle der USA und des Batista-Clans gestanden und sei eine Art Bordell für US-amerikanische Gangster gewesen. Castro hatte, so Goldenberg, mindestens 95 Prozent der Kubaner hinter sich, als er die Macht übernahm. »Ich wünsche Fidel alles Gute – es wird aber nicht funktionieren.« Den hingerissenen Brandt-Söhnen, die sich Fidel Castro als eine Mischung von Robin Hood und Florian Geyer vorstellten, beantwortete Goldenberg geduldig jede Frage.
Horst Lison war ein jüngerer Freund meiner Eltern und gewissermaßen mein »großer Bruder«. Er hatte mal einem Schul- und Spielfreund von mir Privatunterricht gegeben. Ich durfte einige dieser Nachhilfestunden mitmachen, sie bereiteten mir einen Riesenspaß. Doch mit dem Erlernen des Lateinischen als erster Fremdsprache wehte irgendwann auch bei mir der Wind schulischen Lernens schärfer. Die meisten Mitschüler erhielten von ihren Eltern Unterstützung. Bei mir ging das nicht, wegen beruflicher Überbeanspruchung einerseits und Fehlens höherer Schulbildung andererseits. Da wurde Horst Lison zu einem Helfer in der mehr oder weniger großen Not. Nicht nur für mich, sondern auch für Lars. Aus Gründen, die mir heute nicht mehr erklärlich sind, ging ich ab der Sexta nicht gern zur Schule. Meine Leistungen waren in der Summe so etwas wie guter Durchschnitt. Allerdings wurde damals strenger benotet als heute, und eine gar nicht so kleine Zahl von Jugendlichen wiederholte am Gymnasium mindestens eine Klasse. Meinem väterlich-brüderlichen Freund sei Dank, geriet ich nie in diese Gefahrenzone. Doch die wichtigste Spätfolge seines Einsatzes war, dass er mir das konzentrierte geistige Arbeiten beibrachte.
Horst, der sein Diplom in Psychologie um ein Medizinstudium ergänzte, wurde von meinen Eltern häufig gebeten, nach dem Unterricht noch zu bleiben. Daraus ergaben sich, vor allem mit Vater, oft lange Gespräche über Politik. Bei einigen dieser Unterredungen war ich dabei, und ich erinnere mich, wie Horst von autoritären Tendenzen in der Bundesrepublik sprach. In seinem Freundes- und Kommilitonenkreis habe man vereinbart, im Falle des Falles nicht zuzuwarten, bis ein diktatorisches Regime sich gefestigt hätte, sondern umgehend Widerstandszellen zu bilden. Horst war ein Mann der Tat. Als die innerstädtische Demarkationslinie in Berlin mit den Absperrungsmaßnahmen des 13. August 1961 zur beinahe unüberwindbaren Grenze wurde, organisierte er – wie so viele – nichtkommerzielle Fluchthilfe. Sein Zirkel kümmerte sich speziell darum, an der Freien Universität studierende Ostberliner, die keine Chance hatten, ihr Studium an der Humboldt-Universität oder einer andern Hochschule der DDR fortzusetzen, mithilfe gefälschter Pässe nach West-Berlin zu schaffen. Das ging eine Zeitlang gut. Aber in einer der Gruppen, die herübergeschleust wurden, befand sich ein Spitzel. Horst wurde verhaftet, endlos verhört, auch über Willy Brandt. Er gab sich naiv und räumte nur ein, was schon bekannt war. Nach mehrmonatiger Haft im Stasigefängnis in Hohenschönhausen wurde er zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt.
Mein Vater bemühte sich intensiv um seine Freilassung, und nach knapp zwei Jahren gelang dies im Rahmen eines Gefangenenaustauschs und mit der Hilfe der Anwälte Stange (West-Berlin) und Vogel (Ost-Berlin), die sich seit 1962 um humanitäre Dinge kümmerten. Horst Lison wurde später Leiter von kinderpsychiatrischen Kliniken. Nach seiner Freilassung traf er meinen Vater just an dem Tag wieder, als John F. Kennedy in Berlin war, also am 26. Juni 1963. Trotz des hohen Gastes nahm Willy Brandt sich Zeit, den frisch aus der Haft Entlassenen im Rathaus Schöneberg zu empfangen. Niemals, so erzählte Horst später, hätte er Willy wieder so fröhlich erlebt, nie mehr sei Willy in seiner Gegenwart so aus sich herausgegangen. Der Bürgermeister umarmte den Ankömmling heftig und schüttelte lange seine Hand. Bis heute hat diese Freundschaft Bestand.
Immer wieder ist zu lesen, dass nach der »Wahlniederlage« von 1965 zwischen den Eheleuten Brandt ernsthaft diskutiert worden sei, sich nach Norwegen zurückzuziehen. Tatsächlich war mein Vater aufgrund des SPD-Wahlergebnisses von 39,3 Prozent tief deprimiert und hatte öffentlich seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur erklärt. Im Familienkreis hatte er den Gleichstand von CDU/CSU und SPD, wenigstens den Sprung über die 40-Prozent-Marke prognostiziert. Die Söhne bekamen von dem, was zwischen den Eltern beredet wurde, nichts mit. Allerdings schüttete Mutter mir ihr mitleidendes Herz aus, weinte und sprach tatsächlich von einem möglichen Rückzug ins Privatleben. Ich würde auch nicht ausschließen, dass im Gespräch mit Vater von ihrer Seite das Stichwort »Norwegen« gefallen ist. Dass aber ein Umzug konkret in Erwägung gezogen worden wäre, insbesondere von meinem Vater, halte ich für extrem unwahrscheinlich, um nicht zu sagen: für Unsinn.
Zum Weihnachtsfest 1965 hatten sich die Gefühle wieder beruhigt. Bemerkenswerterweise war Weihnachten in meiner Erinnerung mehr vom Vater geprägt als von der Mutter, und das, obwohl er sicher nicht die Hauptlast der Vorbereitung trug. Vielleicht kommt meine Erinnerung auch daher, dass Vater und Söhne regelmäßig am späten Nachmittag des 24. Dezember den Kirchgang absolvierten. Obwohl Vater eher ein kirchenferner Agnostiker war als ein gläubiger Christ (doch auch kein Atheist), gehörte der Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend für ihn unbedingt zum Fest dazu. Zu Hause sangen wir häufig Weihnachtslieder. Manchmal las er aus der Bibel die Weihnachtsgeschichte vor. Wenn wir aus der Kirche zurückkamen, wurde nach norwegischer Sitte ein Schweinebraten serviert, den Mutter und Litti vorbereitet hatten. Gans gab es am ersten und Grünkohl mit Rauchfleisch, wie Vater es aus Lübeck kannte, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Bescherung fand nach dem Essen statt. Wir Kinder durften jetzt das Wohnzimmer betreten, wo der von den Eltern herrlich geschmückte Baum stand. Die Geschenke nahmen sich nach heutigen Maßstäben eher bescheiden aus, nach damaligen reichlich, doch nicht übertrieben. Ich bekam meist Bücher, manchmal Ritterfiguren. Noch nicht selbstverständlich waren diverse Süßigkeiten samt den von Mutter nach norwegischen Rezepten gebackenen Keksen. Auch andere Leckereien kamen zunächst nur zu Weihnachten auf den Tisch, wie echte ungarische Salami und französischer oder italienischer Käse. Irgendwann traten Lebensmittelgeschenke weit entfernter Absender hinzu, die den weihnachtlichen Gabentisch bereicherten: Apfelsinen aus Israel, Feigen aus dem Maghreb, Kaviar aus Persien und Russland. Wer hat, dem wird gegeben, dachte ich mir schon damals …