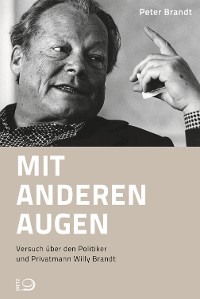Kitabı oku: «Mit anderen Augen», sayfa 4
An der abnehmenden Feierlichkeit des familiären Weihnachtsfests ließ sich seit dem Umzug nach Bonn im Frühjahr 1967 der Verfall der Ehe meiner Eltern beobachten. (Ich selbst hatte nur noch ein Jahr bis zum Abitur und blieb in Berlin, wo ich so lange in der Familie meines Freundes Wolf-Rüdiger Knoche wohnte.) In meiner Erinnerung lösten sich nach und nach alle Festelemente ins Unverbindliche auf. Die Eltern hatten sich offenbar nicht mehr viel zu sagen. Die beiden älteren Söhne trugen auch nicht gerade dazu bei, Weihnachten zu retten. Man gewann den Eindruck, nur des jüngsten Bruders Matthias wegen riss sich die Familie noch halbwegs zusammen. Vater verschwand dann sehr schnell mit einem neuen Roman in sein Zimmer. Die Zurückgebliebenen plauderten über mehr oder weniger Belangloses. Zumindest ich war froh, mich manchmal schon am Abend des 25. Dezember mit dem Nachtzug wieder nach Berlin absetzen zu können.
Doch Weihnachten 1970 feierten alle Brandts »groß« in Berlin, was von Willy nach der Unterzeichnung des Moskauer und des Warschauer Vertrags auch als demonstrativer Akt gemeint war. Ein Empfang im Bundesgästehaus, zu dem vor allem alte Berliner SPD-Genossen geladen waren, verstärkte dieses Signal. Ansonsten machten sich Brandts in diesen Weihnachtstagen vor allem mit der Familie des Pfarrers Theodor Jänicke gemein. Seine Tochter Maria und ich lebten, wie man damals noch sagte, in wilder Ehe. Am Heiligen Abend besuchten wir alle zusammen Theos Gottesdienst. Er war ein Mann der ehedem Bekennenden Kirche und entschiedener Anhänger der neuen Bonner Ostpolitik. Wir alle hatten es noch einmal richtig schön. Seitdem zog ich es vor, Weihnachten nur noch zusammen mit meinen Lebensgefährtinnen zu verbringen.
In Bonn besiedelte die Familie Brandt ein großes Haus, das schon als Dienstvilla des vorherigen Außenministers gedient hatte. Als 1969 der Wechsel in den Kanzlerbungalow anstehen sollte, war Vater froh, dass der neue Außenminister Scheel in seinem gerade gebauten eigenen Haus wohnen bleiben wollte. Brandts mussten also nicht umziehen. Die Außenminister-, jetzt Kanzlervilla auf dem Venusberg barg im Erdgeschoss mehrere Repräsentationsräume, während die eigentliche Wohnung im ersten Stock lag. Im zweiten Stock befanden sich etliche, meist kleine Zimmer und Kammern. Dort wohnten Lars und die Hausmädchen. Wenn ich zu Besuch kam, fand auch ich dort problemlos einen Platz. Zwischen August 1972 und März 1974 wohnte ich immer wieder wochenlang auf dem Venusberg, um in Ruhe mein Abschlussexamen und die geplante Dissertation vorzubereiten, sodass ich in diesen etwa fünfzehn Monaten noch einmal dichter am Geschehen war als in den Jahren davor und danach.
Die Einrichtung des Hauses war von Mutter vorgenommen worden: geschmackvoll und freundlich. Vater interessierte sich nicht übermäßig dafür, obwohl das Grundlegende sicher abgesprochen war. Mutter prägte die Atmosphäre, unterstützt von wechselnden fröhlichen Au-pair-Mädchen, die sie teilweise aus der entfernteren norwegischen Verwandtschaft rekrutierten. Meine Freundin Maria weilte mit mir ab und zu einige Tage dort. Sie hatte den Eindruck eines allzu stillen, unlebendigen Ortes, bewohnt von Menschen, die nichts oder nicht mehr viel miteinander anfangen konnten, obwohl sie für sich genommen alle umgänglich und gefühlvoll gewesen seien. Ein »Getüm von beherrschten Gefühlen« sei Vater Brandt gewesen, wenn er plötzlich und unerwartet den Flur entlangkam, höflich und nicht unfreundlich, auch humorvoll, aber von ihr als bedrohlich wahrgenommen. Dass Mutter in der Familie für gute Stimmung sorgen wollte und – mehr noch – für Besucher die charmante Gastgeberin verkörperte, änderte das nur vordergründig.
Noch in Berlin, im Frühherbst 1966, gab es an einem Sonntagmorgen einen bedenklichen Zwischenfall. Mutter war nicht zu Hause und Martha Litzl führte das Regiment. Die Zimmer von Lars und mir lagen im Dachgeschoss. Plötzlich hörte ich einen Schrei oder vielmehr einen leicht röchelnden Ausruf: »Ein Arzt!« Danach die aufgeregte Frauenstimme der Haushälterin, die offenbar schon auf dem Weg zum Telefon war. Als ich die Treppe hinab kam, lag Vater mit geschlossenen Augen im Bett und atmete normal. Höchstens eine halbe Stunde später traf ein mehrköpfiges Team von Ärzten unter der Leitung von Professor Freiherr von Kreß ein. Man untersuchte den Patienten gründlich, aber ohne technische Gerätschaften. Man kam zu dem Ergebnis, dass kein Herzinfarkt oder eine andere bedrohliche Erkrankung vorläge. Den Anfall, bei dem der Oberbauch durch das Zwerchfell aufs Herz drückt, wobei regelrechte Vernichtungsgefühle erzeugt werden, kennen Mediziner als das Roemheld-Syndrom. Vermutlich wurde an einem der Folgetage eine genauere Untersuchung im Krankenhaus nachgeholt. Einen verschiedentlich kolportierten dramatischen Rettungseinsatz habe ich nicht erlebt. Wie mir mein Vater einige Zeit später erzählte, sah er, während er kollabierte, gleich einem Sterbenden sein ganzes Leben in Zeitraffer an sich vorüberziehen – sicherlich ein einschneidendes Erlebnis.
Zwölfeinhalb Jahre später erwischte es ihn tatsächlich. Er stand kurz vor seinem 65. Geburtstag, den die Partei 1978 mit einer Riesenveranstaltung in der Dortmunder Westfalen-Halle unter Einbeziehung weltbekannter Musiker feiern wollte. Offenbar während einer Reise nach New York erlitt Vater einen sogenannten »stillen«, aber beträchtlichen Herzinfarkt und nach der Rückkehr in Bonn einen kleineren zweiten. Dem Krankenhausaufenthalt folgte ein mehrwöchiger Reha-Aufenthalt im südfranzösischen Hyères. Im dortigen Sanatorium wurde er nach allen Regeln der ärztlichen Kunst wieder in Form gebracht, soweit das möglich war. Vater war von den Bemühungen der Ärzte, von den wohnlichen wie kulinarischen Umständen seiner Kur sehr angetan und hatte das Gefühl, gesünder nach Hause zu fahren, als er seit etlichen Jahren gewesen war. Bislang bewegte er sich wenig, rauchte Kette und sprach stark dem Alkohol zu, auch wenn sein Konsum nie völlig aus dem Ruder lief, dazu der unvermeidliche Stress und die vielen Fernreisen mit Klima- und Zeitzonenwechseln – das alles musste er unter dem strengen, doch wohltuenden Einfluss seiner neuen Lebenspartnerin Brigitte Seebacher nun ändern. In den folgenden Jahren konnte man beobachten, wie er auflebte. Die Fotos vom Wochenendeinkauf in Unkel waren keine Show, jedenfalls nicht in erster Linie. Er schien wieder Gefallen am normalen Leben zu finden und ließ sich beim Kochen bereitwillig für die Hilfsarbeiten einsetzen.
Zum 65. Geburtstag hatte ich ihm eine Zeichnung des Malers Michael Sowa geschenkt, der damals noch nicht so bekannt war. Sowa hatte sie nach meinen Wünschen zu einem Freundschaftspreis angefertigt. Zum 70. Geburtstag, am 18. Dezember 1983, konnten meine Frau Gabriele und ich ihm unsere knapp zwei Monate alte Tochter Karoline Luise präsentieren, ein Fressen für die Fotoreporter und unverkennbar eine Freude für den Großvater. Kontinuierlich bemühte ich mich darum, dass sich »Opa Willy« und Karoline immer wieder in Berlin sahen. Ich erlebte ihn dabei zugewandt, lieb und keineswegs unbeholfen. Das nahm wohl auch meine Tochter so wahr, die nur nicht verstehen konnte, warum er manchmal plötzlich so schnell wieder weg musste. Als Dauerbeschäftigung wäre das Opa-Sein aber sicher nichts für ihn gewesen.
Zu einer Scheidung gehört eine finanzielle Auseinandersetzung. Nun hätte meine Mutter bei der Einstellung des Vaters in jedem Fall auf eine ordentliche Versorgung rechnen dürfen. Aber naturgemäß gab es auch Dinge, die sich nicht von selbst regelten, sondern ausgehandelt werden mussten, selbst dann, wenn beide Seiten auf eine einvernehmliche Lösung ausgerichtet waren. Ich vermied damals jede Äußerung zu kontroversen Fragen in der Sache. Vater hätte sie weder erwartet noch goutiert, aber Mutter wohl doch erhofft. Psychische Verletzungen lassen sich ohnehin nicht mit Geld heilen. Am Ende zeigte sich Vater durchaus großzügig und erklärte sich einverstanden, den norwegischen Besitz der Mutter bei der Berechnung der Unterhaltszahlungen unberücksichtigt zu lassen.
Wenn zwei Menschen, die eigentlich Humor besitzen, nicht mehr über dieselben Geschehnisse lachen können und nicht mehr freundlich übereinander und über sich selbst lachen können, dann stimmt etwas Grundlegendes nicht mehr. Von meinem Vater ist bekannt, dass er zumindest zwei ernsthafte außereheliche Beziehungen hatte. Das blieb mir bis 1974 ebenso verborgen wie die Gerüchte über ein ausschweifendes Sexualleben, die ich für maßlos übertrieben halte. Es lockte mich nicht, ihn zu bitten, für mich das Wahre vom Falschen zu trennen. Über so etwas offen zu reden, waren wir beide zu scheu und zu genant.
Nun ist es eine Binsenweisheit, dass zur Zerstörung einer Beziehung – jenseits der Frage von Schuld und Verantwortung im moralischen Sinn – immer zwei gehören. Während Willy sich immer öfter unverstanden fühlte, reagierte er mit zunehmender Sprachlosigkeit. Nur wenn seine Frau ihn wegen einer politischen Handlung kritisierte, was nicht oft vorkam, konnte er ungehalten werden. Rut hingegen wehrte sich durch Neckereien und Sticheleien, die in einer anderen Situation harmlos gewesen und vielleicht sogar lustig aufgenommen worden wären. In der Niedergangsphase ab 1966, die Zwischenhochs kannte, aber immer öfter einer resignativen Grundhaltung wich, wirkten sie jedoch destruktiv. Als die Trennung Anfang 1979 offiziell vollzogen wurde, war ich weder erstaunt noch unglücklich.
Im Gespräch bestätigte mein Vater mir, dass es eine andere Frau in seinem Leben gab: die Journalistin und Historikerin Brigitte Seebacher. Das wusste ich zwar schon, aber immerhin hat er es direkt angesprochen. Für mich war sofort klar, ich würde diese Wahl akzeptieren und mich vorbehaltslos um ein gutes Verhältnis zu Brigitte bemühen, weil ich den Vater-Sohn-Faden in Eintracht weiterspinnen wollte. Wir würden uns also wie bisher alle paar Monate, manchmal auch häufiger, in Berlin oder in Bonn sehen, meist zum Abendessen, und ich würde ihn gelegentlich auch in der gemeinsamen Wohnung des seit dem 9. Dezember 1983 verheirateten Paars besuchen. Ich konnte stets nur Mutter oder Vater einladen. Er drängte sich nie auf, und so habe ich ihm hier und dort auch manchmal den Vortritt gelassen.
Arbeiterbewegung, revolutionärer Sozialismus und soziale Demokratie
W
illy Brandt hat wiederholt geschrieben, er sei in die Arbeiterbewegung hineingeboren worden. Der Sozialismus bildete die Grundlage seiner Anschauung der Welt seit Kindertagen. Brandts Großvater war ein treues Mitglied der SPD und selbstverständlich der jeweils zuständigen Gewerkschaft und eines Konsumvereins. Auch Brandts junge Mutter gehörte der »Bewegung« an. Sie hatte ein Abonnement der Volksbühne, machte mit bei einem der zeittypischen »Proletarischen Sprechchöre«, bei den »Naturfreunden« und schon vor dem Ersten Weltkrieg bei der »Freien Jugend«, einer Frühform der sozialdemokratisch ausgerichteten organisierten Arbeiterjugend. Besonders von Frauen und Jugendlichen erhielten die sozialdemokratische Organisationen nach 1918 starken Zuwachs. Arbeitersport und Arbeiterkultur erlebten eine Blütezeit. Arbeiter-Radfahrer, Arbeiter-Philatelisten, Arbeiter-Abstinenzler, Arbeiter-Samariter, proletarische Freidenker (die Mehrzahl der Arbeiter blieb in der Kirche), Arbeiterwohlfahrt, diverse »gemeinwirtschaftliche« Unternehmen und Vereine: Es war ein imponierendes Geflecht von Basisaktivitäten – kein bürokratischer Wasserkopf. Ich selbst habe noch etliche Menschen ohne Amt und Würden kennenlernen dürfen, die als Arbeiter von der klassischen Sozialdemokratie (oder von der Kommunistischen Partei) vor 1933 geformt worden waren. Sie hatten sich auch außerhalb der politischen Sphäre ein Wissen angeeignet, mit dem sie so manchen Studierten in den Schatten stellen konnten. Willy Brandt hat zurecht immer wieder die große kulturelle Leistung der alten Arbeiterbewegung hervorgehoben, die aus Unterdrückten, Ausgebeuteten und Elenden klassenbewusste, selbstbewusste und urteilssichere Staatsbürger gemacht hat. Die Arbeiterbewegung ist eine der großen Emanzipationsbewegungen der Menschheitsgeschichte.
Wer »von der Wiege bis zur Bahre« in dieser Bewegung gelebt hatte, konnte leicht den Eindruck gewinnen, sie sei mit der Gesamtmasse der Lohnarbeiter identisch. Das war aber nie der Fall. Mindestens ein Drittel der Arbeiterschaft Deutschlands, vor allem in ländlichen Regionen, stand den sozialistischen Parteien fern oder enthielt sich bei Wahlen. Der größere Teil der Klasse im soziologischen Sinn blieb unorganisiert und nahm nie oder nur ausnahmsweise an einem Streik teil. In den Jahren bis 1933 blieb der addierte Wähleranteil von SPD und KPD recht stabil, doch nahm die KPD auf Kosten der SPD zu. Zwar konnte die NSDAP zwischen 1930 und 1932 in allen Bevölkerungsschichten Stimmen fangen und wurde zur stärksten Partei. Doch trotz ihres Namens war ihr Erfolg bei beschäftigten Arbeitern unterdurchschnittlich, ebenso bei Erwerbslosen – auch wenn die populäre Vorstellung es anders will.
Als der Schüler Herbert Frahm 1928 aus eigenem Entschluss den »Roten Falken« beitrat und ein Jahr später zur Sozialistischen Arbeiterjugend wechselte, schien sich die Weimarer Republik konsolidiert zu haben. Die Jahre davor waren turbulent: Kriegsniederlage, der drückende Versailler Frieden 1918/19 und die verheerende Hyperinflation. Die Reichstagswahlen vom August 1928 brachten der SPD, die seit 1923 in der Opposition war, rund 30 Prozent der Stimmen und der KPD 10,6 Prozent. Die »Sozen« wurden stärkste Kraft in einer Großen Koalition mit bürgerlichen Parteien. Doch diese zerbrach im März 1930 an der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung. Da war noch nicht zu erkennen, wie vernichtend die Weltwirtschaftskrise, die im Herbst 1929 an der New Yorker Börse ihren Anfang nahm, einmal sein würde.
In Lübeck hielt auch Willy Brandt ein von jungen Sozialdemokraten bei Aufmärschen gezeigtes Transparent in die Höhe, auf dem stand: »Republik, das ist nicht viel – Sozialismus ist das Ziel!« Die rechtsstaatlichen und demokratischen Errungenschaften waren aus Sicht dieser jungen Linken durchaus verteidigungswert, doch eher Bedingungen für den »eigentlichen« Kampf. Für junge Marxisten – und als Marxisten sahen sich fast alle Linken einschließlich der Masse der Sozialdemokraten – schien die Angelegenheit nicht sehr kompliziert zu sein: Deutschland war offensichtlich auch unter republikanischer Verfassung eine Klassengesellschaft. Konzernherren, ostelbische Junker, hohe Beamte aus dem Kaiserreich und Offiziere harrten in ihren sozialen Führungspositionen aus. In seinem Abituraufsatz von 1932 schrieb Willy Brandt: »Politische Demokratie allein gibt es … nicht. Soziale und kulturelle Demokratie gehören zur wirklichen Demokratie hinzu.« Ganz ähnlich erläuterte er mir knapp drei Jahrzehnte später auf meine Frage hin den Unterschied zwischen dem »freiheitlichen Sozialismus« der SPD und dem »Sozialismus« der SED: Recht verstandener Sozialismus sei radikale (an die Wurzel gehende) und umfassende Demokratie.
Als Jugendlicher rezipierte er die sozialistische Tagespresse, auch Zeitschriften wie die »Weltbühne«, gesellschaftskritische Romane von Jack London, Maxim Gorki, Henri Barbusse, Ludwig Renn und Ernst Toller. Mit dem »Kapital« von Marx befasste er sich erst im norwegischen Exil, um 1934, als er bei der ersten Übersetzung ins Norwegische helfen sollte. Der dialektische und historische Materialismus eines Marx gingen für ihn aber mit Elementen eines ethischen Sozialismus sowie ausgeprägtem Idealismus Hand in Hand.
Zu Hause fand der Knabe Herbert den Band »Die Frau und der Sozialismus« von August Bebel im Bücherschrank des Großvaters. Darin skizzierte der große Arbeiterführer Bebel anschaulich eine freie, gerechte und gleiche Gemeinschaftsordnung auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel. Aber ebenso wichtig wie diese identitätsstiftenden Erlösungsvorstellungen von der klassenlosen Gesellschaft und vom »Zukunftsstaat« (so sagte man im Kaiserreich) war das unmittelbare Erlebnis der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung als egalitärer Solidargemeinschaft. Einen Eindruck davon, was Solidarität unter Arbeitern und Klassenstolz hieß, bekam Herbert mit etwa acht Jahren. Sein Großvater arbeitete in einem großen Betrieb und war mit seinen Kollegen im Zuge eines Arbeitskampfs ausgesperrt. Einer der Direktoren, als freundlich und kinderlieb bekannt, kaufte dem jungen Herbert zwei Brote, die dieser froh nach Hause trug. Anders als erwartet gab es dafür aber kein Lob, sondern Tadel: Solche Almosen würden aufrechte Arbeiter von sich weisen. Herbert musste die Brote zum Bäcker zurückbringen. Für einen Achtjährigen war das einschneidend, wie mein Vater mir einmal sagte.
In den sozialistischen Kinder- und Jugendorganisationen beinhaltete die Idee der Solidargemeinschaft, sich frühzeitig mit Fragen der Selbstverwaltung auseinanderzusetzen, Konflikte argumentativ auszutragen, Kenntnisse aller Art zu vermitteln, die die Schule nicht vermittelte, und sich gegenseitig neue Horizonte zu eröffnen. Willy Brandt erinnerte sich lebenslang der Teilnahme am großen Zeltlager der Falken 1929 auf der Rheininsel Namedy bei Andernach: eine zweitausendköpfige »Kinderrepublik«, gegliedert in »Dörfer«. In der SAJ-Gruppe »Karl Marx«, die er seit dem Herbst leitete, kamen auch Heimabende und Lagerfeuerromantik nicht zu kurz, ähnlich wie bei den Pfadfindern und den Bündischen. Einen Unterschied machte jedoch das kameradschaftliche Zusammensein von Jungen und Mädchen. Die reichsweit nicht mehr als 50.000 SAJ-Angehörigen trugen Blauhemd mit rotem Halstuch.
Schon mit sechzehn, also zwei Jahre früher als üblich, wurde Willy Brandt in die Lübecker SPD aufgenommen. Lübeck, die Freie und Hansestadt mit Landeseigenschaft, gehörte zu den Hochburgen der Sozialdemokratie. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 erreichte sie fast 60 Prozent der Stimmen. Auch die KPD war hier nicht unbedeutend, aber eindeutig in der Minderheit. Die unumstritten führende Gestalt der Lübecker Sozialdemokraten wurde der aus dem Elsass stammende Chefredakteur des »Volksboten«, Dr. Julius Leber. Nach damaligen Maßstäben war Leber ein eher »rechter« Sozialdemokrat, vor allem, weil er für eine konstruktive Wehrpolitik der SPD eintrat. Zugleich war er ein militanter Verteidiger der Republik gegen die »Reaktion« und die NSDAP. Leber förderte den jungen Willy Brandt, der im »Volksboten« gelegentlich kleinere Artikel schreiben durfte, obwohl er deutlich zur Parteilinken tendierte. Seine Begabung war erkennbar. So half Leber dem Jungen auch zum vorzeitigen Eintritt in die Mutterpartei.
Ein Streit um die Tolerierung der Präsidialregierung des katholischen Reichskanzlers Heinrich Brüning und den Bau des Panzerkreuzers B führte dazu, dass zwei SPD-Reichstagsabgeordnete, Max Seydewitz und Kurt Rosenfeld, aus der Partei ausgeschlossen wurden. Am 4. Oktober 1931 gründeten sie mit ihren Anhängern, darunter überdurchschnittlich viele Junge, die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP). Von der sozialdemokratischen Linken kamen nicht sehr viele hinzu. Dafür schlossen sich der SAP etliche linkssozialistische Splittergruppen, parteilose sozialistische Intellektuelle sowie eine Fraktion politisch erfahrener Exkommunisten an, die mit der KPD im Zuge ihrer Stalinisierung gebrochen hatten. Diese Männer faszinierten den jungen Willy Brandt, besonders der gelernte Dreher Jakob Walcher, der schon der Spartakusgruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angehört hatte. Im Januar 1932, drei Monate nach Gründung der SAP, bekundete Willy Brandt eine besondere Distanz zur Sozialdemokratie. Ihr Erbe müsse überwunden werden. Da war er mit einem großen Teil der Lübecker SAJ in die neue Partei gewechselt.
Die anfangs recht heterogene, innerparteilich sehr diskussionsfreudige und demokratisch strukturierte SAP hatte auf Reichsebene nie mehr als 25.000 Mitglieder. In Lübeck waren es vielleicht 300, vor allem aus der Arbeiterjugend. Bei Landtags- und Reichstagswahlen kam sie nie über den unteren Promillebereich hinaus. Doch für Willy Brandt wurde die SAP über mehrere wichtige Jahre zum Zentrum seiner Existenz. Das bedeutete in erster Linie mühselige Kleinarbeit an Abenden und Sonntagen. Er lernte, was er in der SAJ schon seit Jahren geübt hatte: über fast jedes Thema zu schreiben und frei zu sprechen. Er war der noch minderjährige lokale Führer einer kleinen Partei, die doch mehr war als eine Sekte. Seinen kargen Lebensunterhalt verdiente er als Schiffsmaklervolontär.
In der Vorstellung ihrer Gründer sollte die neue Partei nicht eine weitere Zersplitterung der Linken herbeiführen, sondern angesichts der demoralisierenden Wirtschaftskrise, der autoritären Entwicklung der Verfassungsordnung und der akuten Drohung von Rechtsaußen eine Korrektur in der Politik der beiden großen Arbeiterparteien herbeiführen. Vereinfacht gesagt: Die staatstragend daherkommende SPD sollte aufhören, alles zu tolerieren, was ihr von der Regierung als »kleineres Übel« vorgesetzt wurde, und die Kommunisten sollten ihre lärmende Agitation gegen die »Sozialfaschisten« – sprich die SPD – beenden. Man war in der SAP überzeugt, dass nur eine bedingungslose, defensive sozialdemokratisch-kommunistische »Einheitsfront«, also eine Aktionsgemeinschaft der Arbeiterbewegung auf allen Ebenen, die NSDAP zurückwerfen könne. Welche Konsequenzen im Fall einer Machtübernahme dieser Partei zu erwarten seien, darüber machte sich die SAP relativ wenig Illusionen. Ausdrückliche Unterstützung fand sie bei namhaften Schriftstellern wie Heinrich Mann, Künstlern wie Käthe Kollwitz und Wissenschaftlern wie Albert Einstein. Zwar gab es hier und da ein ermutigendes Zeichen in Richtung »Einheitsfront«, doch insgesamt warteten die parteipolitisch verfeindeten Arbeiter auf Signale ihrer Führungen. Und die zögerten so lange, bis Hitler sie hinwegfegte. Die in Jahrzehnten eingeübte Disziplin funktionierte bis zum bitteren Ende.
Auch wenn Willy Brandt in späteren Jahren das Konzept der antifaschistischen Aktionseinheit nicht mehr explizit verteidigte, hielt er die Kritik an den großen tradierten Organisationen der Arbeiterbewegung in den Jahren 1930 bis 1932/33 sehr wohl aufrecht. Vor allem die fatalistische Auffassung, dass die Weimarer Republik (und mit ihr die klassische Arbeiterbewegung) zwangsläufig hätte untergehen müssen, erregte seinen Widerspruch. Das konkrete Ergebnis des historischen Prozesses beruhe immer auf dem Ringen lebendiger Kräfte. Trotz skeptischer Einwände von Historikern beharrte er auf der echten Chance, die ein aktiver Widerstand gehabt hätte, ganz besonders gegen die sogenannte »Reichsexekution« der ultrakonservativen Regierung Papen, welche die SPD-geführte Regierung Preußens am 20. Juli 1932 in einer staatsstreichähnlichen Aktion entmachtete. In Lübeck jedenfalls sei sogar die Basis der KPD zum Kampf mit der SPD und der SAP bereit gewesen. Wie vielerorts habe man auf ein Signal von oben gewartet. Vergebens. Noch nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 habe sich massenhaft Widerstandswillen geäußert, nicht nur in Lübeck. In der Tat: Dort protestierte am 3. Februar die Arbeiterschaft mit einem Streik gegen einen Überfall von SA-Leuten auf Brandts »Ziehvater« Julius Leber und dessen anschließende Verhaftung. Und am 19. Februar demonstrierten bei eisiger Kälte 15.000 Lübecker gegen die Regierung Hitler. Auf einer großen Kundgebung der KPD-dominierten »Antifaschistischen Front« sprach für die SAP auch Willy Brandt. Doch die sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen reagierten insgesamt abwartend. Die örtlichen Gewerkschaftsfunktionäre wollten nicht zum Streik aufrufen. Man lasse sich nicht provozieren und warte auf Weisungen aus Berlin.
Da Hitlers Staatsapparat nach dem Reichstagsbrand zuerst die großen Arbeiterorganisationen verfolgte und zerschlug, vor allem die KPD, konnten sich die kleineren linkssozialistischen Gruppierungen, unter denen die SAP die größte war, relativ unbehelligt auf die Illegalität einstellen. Am 11. und 12. März 1933 trafen sich die SAP-Genossen zu einem geheimen Parteitag in Dresden. Zum ersten Mal benutzte mein Vater hier den Namen Willy Brandt. Die Mehrheit der Delegierten widersetzte sich den Vorsitzenden Kurt Rosenfeld und Max Seydewitz, die die SAP auflösen wollten. Man beschloss, die Arbeit unter veränderten Umständen fortzusetzen. Nach der »schmählichen« Kapitulation der SPD und dem »noch viel grauenvolleren« Versagen der KPD sollte sich die Neuformierung der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung um die SAP herum vollziehen.
Die SAP gehörte einer Internationalen Arbeitsgemeinschaft an. Es gab in dem »Londoner Büro« genannten Verbund einige Parteien von Gewicht, darunter die Norwegische Arbeiterpartei (DNA). Nur sie konnte tatsächlich beanspruchen, die Masse des Industrieproletariats, zu dem auch Landarbeiter, Fischer und Kleinbauern, in ihrem Land hinter sich zu haben. Es liegt auf der Hand, dass die Arbeiterpartei Norwegens für Brandts SAP von besonderem Interesse war. In den Jahren 1935 bis 1937 hatte Brandt seine norwegische Lektion zu lernen, eine Lektion, die von einer freiheitlichen nationalen Tradition, von nordischer Demokratie und von echter Volksverbundenheit der Sozialisten handelte. Um für sie aufnahmefähig zu sein, musste er sich von jenen deutschen Sichtweisen freimachen, mit denen die Auslandsleitung der SAP in Paris die »norwegische Frage« bewertete.
(Kurzzeitig beteiligte sich die DNA an einem Aufruf für eine Vierte Internationale, die Gefolgsleute Leo Trotzkis ins Leben rufen wollten. In seinen Schriften über Deutschland, die Anfang der dreißiger Jahre entstanden, war Trotzki zu ähnlichen politischen Schlüssen gelangt wie die SAP. Von 1935 bis 1937 lebte auch er im norwegischen Exil, musste das Land dann aber Richtung Mexiko verlassen, wo er 1940 von einem stalinistischen Agenten ermordet wurde. Das alles ist deshalb interessant, weil die Trotzkisten damals ein Auge auf Willy Brandt geworfen hatten. Trotzki wollte ihn angeblich sogar persönlich treffen, legte dann aber plötzlich keinen Wert mehr darauf, weil er fand, dass Brandt sich zu wenig von der DNA distanzieren wollte. Umgekehrt war der trotzkistische Weg genau das, was Brandt nicht mochte: Sektierertum par excellence, gepaart mit arrogantem Auftreten und notorischer Rechthaberei. Aber auch ohne Trotzkisten kamen ihm die Diskussionen im »Londoner Büro« und der Arbeitsgemeinschaft der linkssozialistischen Jugendverbände oft dogmatisch, haarspalterisch und wirklichkeitsfremd vor.)
Am 7. April 1933 traf Willy Brandt in Oslo ein. Den Weg von Travemünde nach Rødbyhavn machte er versteckt auf einem kleinen Fischkutter, dann ging es weiter über Kopenhagen. Ob er sich selbst und junge illegale Genossen gefährdet hätte, wenn er in Lübeck geblieben wäre, ist unklar. Klar ist aber, dass er nicht aus freien Stücken nach Norwegen fuhr, sondern dorthin geschickt wurde, um einen Stützpunkt der SAP aufzubauen, nachdem Paul Fröhlich, der die Aufgabe zuerst übertragen bekommen hatte, bei Antritt der Reise verhaftet worden war.
In Oslo ging Willy Brandt bei nächster Gelegenheit in die Redaktion des DNA-Zentralorgans »Arbeiderbladet«. Dem außenpolitischen Redakteur Finn Moe war seine Ankunft avisiert worden. Moe gehörte zum Vorstand der AUF, der großen Jugendorganisation der Arbeiterpartei. Brandt, Gewährsmann des Sozialistischen Jugendverbandes der SAP, sollte mit ihm zusammenarbeiten. Der Chefredakteur von »Arbeiderbladet« und eigentliche Spiritus rector der DNA war mehr als fünfzig Jahre lang Martin Tranmæl. Mir selbst war es noch vergönnt, dem legendären Freund des Vaters und Endachtziger kurz vor seinem Tod 1967 die Hand zu schütteln. Das oft beschriebene Feuer seiner jüngeren Lebensphase ließ sich nur noch ahnen.
Brandts Aufgaben waren dreierlei: Erstens sollte er die norwegischen Genossen und die Norweger über die Zustände in Deutschland aufklären. Zweitens sollte er materielle Hilfe für die politische Arbeit der SAP im Reich und im Exil sammeln. Drittens, und das war problematisch, sollte er den Norwegern vermitteln, welche Konsequenzen die Niederlage in Deutschland aus SAP-Sicht hatte, und den internen Diskussionsprozess der DNA in eine »revolutionäre« Richtung lenken.
Der erste Artikel, den Brandt in Norwegen veröffentlichte, erschien am 1. Mai 1933 in der Zeitschrift der DNA-Jugendorganisation über die Frage »Wie sieht es in Hitlerdeutschland aus?«. Hiermit begann die unglaublich rege publizistische Tätigkeit Willy Brandts in seinem Gastland. Mit den Jahren summierte sich die Zahl der Manuskriptseiten auf mehrere tausend. Zu seinen frühen bemerkenswerten Einsichten gehörte, dass der NS-Faschismus eine starke Attraktivität auf junge Menschen ausübte. Dass der junge Brandt die Diktatur fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Vernichtung der eigenständigen Arbeiterorganisationen betrachtete, dass er den Antisemitismus als Randphänomen ansah, sogar als Ablenkungsmanöver der Machthaber, und dass er die Aufrüstung zum Krieg früh in den Blick nahm, entsprach der gängigen Optik der sozialistischen Linken. In dieser Phase hatte das alles seine Berechtigung.
Willy Brandt hielt Verbindung zu den illegalen SAP-Gruppen in Deutschland. Als Ende 1934 in Berlin vor dem neu eingerichteten, aber offenbar noch nicht ganz nazifizierten Volksgerichtshof gegen die Inlandsleitung der SAP verhandelt wurde, gelang Brandt ein kleiner »Coup«, wie man heute sagen würde. Offenbar existierten bei den Richtern noch Reste rechtsstaatlichen Denkens, und mutig thematisierten die vierundzwanzig Angeklagten, dass sie gefoltert worden waren. Vor allem aber wirkte sich positiv aus, dass Brandt ein rein juristisch argumentierendes Protestschreiben mehrerer angesehener Rechtsanwälte zuwege gebracht hatte, das vom Gericht irrtümlich für eine offizielle Stellungnahme des norwegischen Justizverbandes gehalten wurde. Die Urteile fielen mit zwei bis drei Jahren Haft erstaunlich milde aus. Auch beim Friedensnobelpreis für Carl von Ossietzky 1936 hatte Willy Brandt die Hand im Spiel. Schon 1934 setzte er eine Kampagne in Gang. Erfolgreich bearbeitete er die Parlamentsfraktion der DNA und die Mitglieder des Nobelkomitees, das aus Angehörigen des norwegischen Parlaments, dem Storting, bestand. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die mutige Entscheidung des Komitees für Ossietzky zu einem beträchtlichen Teil meinem Vater zu verdanken war, der offenbar damals schon persönlich und sachlich sehr zu überzeugen vermochte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.