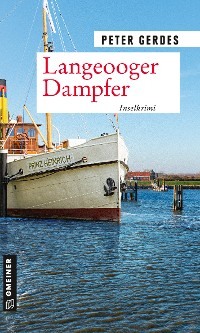Kitabı oku: «Langeooger Dampfer», sayfa 3
6.
»Himmel nochmal, nun guck dir den an!« Bea Wulf stand breitbeinig vor dem Schaukasten mit Veranstaltungsankündigungen der Kurverwaltung. »Das ist doch mal was! Wird dir da nicht auch gleich ganz anders, wenn du den siehst?«
»Kann ich dir nicht sagen. Dazu müsste ich ihn ja erstmal sehen können.« Sina Gersema drängelte ihre Freundin etwas beiseite, um einen Blick auf das ausgehängte Plakat werfen zu können. Was nicht gerade leicht war, denn Bea Wulf war deutlich größer und breiter als sie; ihre walkürenhafte Weiblichkeit war raumgreifend und gewichtig.
Das Plakat zeigte fünf Kerle. Fünf nackte Kerle. Nackte Kerle in Seestiefeln. Und mit Matrosenmützen auf dem Kopf.
Sina zwinkerte. Nackte Männer in einem Schaukasten der Langeooger Kurverwaltung? Nicht möglich! Nicht einmal als Plakat. Das konnte doch nur ein schlechter Traum sein. Sie musste sich mal kneifen.
»Aua! He, was soll das?« Bea schubste ihre Hand weg, ganz leicht nur, aber Sina geriet dennoch ins Taumeln. »Wieso kneifst du mich?«
»Ach, äh, ich … aber hör mal: Fünf nackte Männer?«
»Mein Gott, Sinchen! Was bist du denn auf einmal so prüde? Das sind doch die ›Steamboat-Boys‹, diese Männer-Strip-Truppe, die demnächst im ›Haus der Insel‹ auftritt! Im Rahmen der 1. Langeooger Dampfer-Tage! Sowas ist doch schon lange kein Skandal mehr, die treten sogar im Fernsehen auf. Und außerdem – die sind ja nur fast nackt. Da, guck! Die entscheidenden Stellen sind bedeckt.«
Jetzt bemerkte auch Sina die knappen Tangaslips. Hautfarben, aha, war ja kein Wunder, dass man erst dachte … Außerdem betonten die Dinger eher, als dass sie etwas verbargen, fand sie.
»Sind doch bestimmt ausgestopft!« Bea knuffte Sina in die Seite; wieder hob es sie fast aus den Schuhen. »Muss auch. Solche Muskelberge züchtet man doch nicht ohne Steroide! Tja, und was an der einen Stelle schwillt, das schrumpft an der anderen. Die Götter geben und die Götter nehmen, so ist das nun mal.«
»Götter, sagst du? Na, das weiß ich nicht.« Unbemerkt war eine dritte Frau zu ihnen gestoßen. Eine ältere Frau, hochgewachsen und hager. Sina kannte sie gut.
»Moin, Gertrud! So hat Bea das nicht gemeint mit den Göttern«, erwiderte Sina. »Obwohl – also früher … Ich meine, diese nordischen Götter … sieht man ja jetzt viel im Kino, in diesen Actionfilmen. Da besteht schon eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich.«
Gertrud Reershemius zog die dünnen Augenbrauen hoch. »Also, wenn das eine Anspielung sein soll, dann muss ich dich korrigieren: Auch in meiner Jugendzeit war Ostfriesland bereits christianisiert. Soo alt bin ich nun auch wieder nicht.«
»Oh, äh, Entschuldigung, das wollte ich nicht …« Sina schoss das Blut in die Wangen.
Bea Wulf lachte als Erste los, Gertrud Reershemius stimmte ein. »Ach, Sina, du liebes Schäfchen!«, dröhnte die Walküre. »Dich kann man immer so leicht auf die Rolle nehmen! Vergiss niemals, mit wem Gertrud verheiratet ist. Bei der musst du immer mit allem rechnen, genau wie bei ihrem Kerl.«
Jetzt lachte auch Sina mit, ein bisschen beschämt, aber vor allem erleichtert.
Gertrud hatte inzwischen ihre Lesebrille gezückt, die sie sonst nur trug, wenn sie die Etiketten ihrer Gläser mit selbstgekochter Sanddornmarmelade prüfte. »Mädels, guckt euch bloß mal diese Bauchmuskeln an«, rief sie. »Die sind doch nachgeschminkt, ganz klar! Wetten, die sehen später auf der Bühne nicht halb so definiert aus?«
Bea beugte sich vor. »Respekt, Gertrud!«, dröhnte sie. »Was du alles siehst! Dir macht keiner was vor. Aber wenn schon, wir helfen doch alle ein bisschen nach, oder?« Jetzt knuffte sie Gertrud, und Sina bekam Angst um die dünne alte Frau. Aber die hielt deutlich mehr aus als erwartet.
»Klingt ja so, als würdest du dir das tatsächlich ansehen wollen«, fuhr Bea Wulf fort. »Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Was sagt denn dein Klaas dazu? Und teuer sind die Karten auch, Donnerschlag, weiß gar nicht, ob ich mir das leisten kann.« Die Wirtin des Restaurants »Veggie-Paradies« machte kein Geheimnis daraus, dass ihr Lokal alles andere als eine Goldgrube war.
»Klaas soll bloß seinen Rand halten, der glotzt doch nach jeder Touristen-Mieze, dass ihm die Augen rausquellen«, schimpfte Gertrud. Versöhnlicher fuhr sie fort: »Das Geld hab ich übrig, die Touristen sind richtig wild auf meine Marmelade. Komm doch mit, Mädel, ich lad dich ein! Und dich auch, Sina.«
»Ach, danke, aber ich weiß noch gar nicht, ob …«
Weiter kam Sina nicht, denn Bea schnitt ihr das Wort ab. »Aber sagt mal, wieso sind das denn nur fünf Kerle auf dem Plakat? Ich dachte, die wären zu sechst. Da fehlt doch einer.«
»Ja, allerdings«, bestätigte Gertrud Reershemius. »Und zwar ausgerechnet Marco Heidergott. Der, den alle Langeooger unbedingt tanzen sehen wollen. Natürlich vor allem wir Mädels, klar. Aber es gibt auch ein paar vom anderen Ufer, die wären da spitz drauf gewesen. Schade, dass sie nicht reinkommen werden. Guck, hier steht es: Nur für Frauen.«
»Marco Heidergott?« Bea schnappte nach Luft. »Doch nicht etwa der Sohn von Renko? Einer von hier?«
»Ja, genau, der Sohn deines Kochkollegen und ehemaligen Konkurrenten«, bestätigte Gertrud Reershemius. »Marco, der wilde Bengel, der seinem Vater nichts als Ärger bereitet hat. Ist ja auch nicht leicht, solch einen Jungen ohne Mutter großzuziehen. Und dann geht der los, zieht in die weite Welt und wird berühmt. Nicht zu glauben!«
»Ist ja schön, dass er so berühmt sein soll – aber warum ist er dann nicht mit auf dem Plakat?« Bea verschränkte die Arme, so gut ihre Oberweite das eben zuließ. »Ist er sich etwa zu gut dafür, uns auf seiner Heimatinsel etwas vorzutanzen? Mit so gut wie nix am Mors?«
Sina öffnete schon den Mund, konnte sich aber beherrschen. Dazu hätte sie etwas sagen können – aber sie wusste, dass sie das nicht durfte. Also presste sie ihre Lippen aufeinander.
»Nee, er hat sich verletzt«, sagte stattdessen Gertrud Reershemius. »Soll ein Unfall gewesen sein. Wie schlimm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann er nicht mit auftreten. Und überhaupt in nächster Zeit nicht, heißt es. Muss wohl was Ernsteres gewesen sein.«
»Ach, das ist ja schade«, sagte Bea; ihr Bedauern klang echt. »Den Marco hätte ich doch zu gerne nackig auf der Bühne herumhampeln sehen.«
»Ach, wirklich? Ist der Kleine nicht ein bisschen grün für dich? Du holst dir doch deine Männer sonst nicht aus dem Kindergarten!« Gertrud lachte derart schamlos, dass Sina stellvertretend gleich rot anlief.
»Nee, deswegen doch nicht!« Schallend stimmte Bea in das Gelächter ein. »Nee, wegen Renko, seinem Papa, dem alten Fischbräter! Dem wär es doch hochnotpeinlich, wenn sein Sohn sich zum nackten Affen machen würde! Auch wenn er seinen Laden letztes Jahr verkauft hat und jetzt in Esens wohnt. Die Peinlichkeit wäre auch bis dorthin gedrungen.«
Was für eine Hassliebe zwischen diesen beiden Gastronomen, dachte Sina, so verschieden und dabei doch so ähnlich. Und vielleicht hätte sie das auch ausgesprochen, wenn nicht im selben Moment ein Hubschrauber im Tiefflug über sie hinweg gedonnert wäre, dass ihr buchstäblich Hören und Sehen verging. Unwillkürlich duckte sie sich; die beiden anderen Frauen rissen schützend die Arme über die Köpfe.
»Der kurvt schon den halben Tag herum«, schimpfte Bea, sobald sie sich verständlich machen konnte. »Was ist da bloß los? Ein Krankentransport wird das ja nicht schon wieder sein. Und der würde auch nicht so bescheuert fliegen.«
Eine Gruppe Touristen stürmte an ihnen vorbei, die Augen geradeaus gerichtet, Handys in Bereitschaft. Einer der jüngeren Männer rempelte Gertrud Reershemius an. »He, pass doch auf, du blinde Bitch!«, pöbelte er und holte aus, als wollte er nach der alten Frau schlagen. Als er bemerkte, wie Bea ihre Fäuste ballte, ließ er das bleiben und eilte den anderen hinterher.
»Die rennen zum Strand«, sagte Bea. »Irgendwas ist da passiert. Bestimmt nichts Gutes.«
Eine junge Frau lief an ihnen vorbei. Sina drückte sich dichter an den Schaukasten, weil sie glaubte, es handele sich um eine Nachzüglerin der Pöblertruppe. Mit ihrer langen schwarzen Hose und dem rot-weiß geringelten T-Shirt wirkte sie jedoch geschäftsmäßig, nicht wie eine Touristin. Dann bemerkte Sina das verzerrte Gesicht und die verheulten Augen. Schlimm sah das aus, vor allem das verlaufene Make-up. Oder hatte die Frau ein blaues Auge? Schon war sie vorbei. Hinten auf ihrem T-Shirt prangte die Aufschrift »Prinz Heinrich«.
»Ich glaube, wir müssen uns dringend umhören«, konstatierte Bea und stapfte los, den Passanten hinterher. Gertrud Reershemius war ihr ein paar Schritte voraus. Sina eilte den beiden nach.
7.
Die Pressekonferenz im »Haus der Insel« fand Marian wenig ergiebig. Jedenfalls, was den Informationstransfer anging; er hatte nichts erfahren, das er nicht bereits gewusst hätte. Manches war bestätigt worden, aber längst nicht alles. Was nicht weiter tragisch war, denn für die morgige Ausgabe hatte er mehr als genügend Stoff.
Als eigenständiges Event dagegen gab die PK weitaus mehr her. Dieses Getümmel von Festlandkollegen jeder Couleur, die sich gegenseitig zu überschreien versuchten, dieses Gerangel von Fotografen und Kameraleuten, die um die besten Plätze rivalisierten! Trittleitern verschiedenster Längen kamen zum Einsatz. Einige trugen noch die Preisschilder der örtlichen Läden. Darüber ließe sich bestens schreiben, fand Marian. Eine bunte Geschichte, eine Art Sittengemälde – eines, auf dem die besseren Sitten durch Abwesenheit glänzten.
Aber das war etwas für die kommenden Tage. Jetzt ging es um das Aktuelle, um die Fakten und deren Einordnung. Mit der ihm eigenen Akribie hackte Marian den neuen Aufmacher in die Tasten, konzipierte dazu einen Infokasten und einen Extrabericht mit Stimmen von Augenzeugen und bedeutsameren Persönlichkeiten. Wie man das halt so machte. Gelernt war eben gelernt. Die Stimmen lieferte ihm überwiegend Ocko Onken, der ein Talent dafür hatte, Leute zum Reden zu bringen. Oder zum Schwätzen, dachte Marian, während ihm der alte Onken ein Bündel Notizen nach dem anderen neben die Tastatur legte, begleitet von Erläuterungen, die die bekritzelten Zettel fast überflüssig machten. Augenzeugen und Persönlichkeiten, repetierte Marian bei sich. Von wegen! Gaffer und Wichtigtuer waren das, nichts anderes. Aber was half es, solcherlei Anreicherungen wurden eben verlangt. »Namen sind Nachrichten, Menschen sind per se interessant«, lautete das gültige Journalismusprinzip. Schon als Volontär hatte Marian sich dagegen aufgelehnt: »Interessant sind doch nur interessante Menschen!« An die Abfuhr, die ihm das eingebracht hatte, erinnerte er sich heute noch.
Irgendwann war es geschafft, der letzte Artikel getippt, auf Zeile gekürzt und Korrektur gelesen, das letzte Foto elektronisch beschnitten und eingepasst, die letzte seiner Seiten fertig gebaut. Noch ein letzter Blick. Und noch ein allerletzter, damit es nicht wieder einen Abschuss gab. Dann klickte er auf »send«. So, das war’s. Für heute jedenfalls. Morgen begann wieder alles von vorn.
Und jetzt? Draußen war es noch einigermaßen hell, und Marian war hellwach. Was tun? Mit ein paar Bieren Helligkeit und Wachheit dimmen? Oder mit ein paar Gläsern Wein? Das tat er in letzter Zeit häufig. Oder vielleicht bei Sina anklingeln? Bisschen zusammensetzen, vielleicht etwas essen, von alten Zeiten erzählen? Immerhin hatten sie mal gemeinsam die Redakteursausbildung im selben Zeitungsverlag absolviert. Und noch mehr hatten sie zusammen gemacht, viel mehr. Aber nein, Stahnke war auf der Insel. Marian hatte ihn bei der Pressekonferenz gesehen, in Aktion, wortkarg und ruppig wie immer. Was fand Sina bloß an diesem Klotz? Warum hatte sie ihn seinerzeit in die Wüste geschickt, nur um sich an diesen Kerl zu hängen, der so viel älter war als sie beide? Sie beide, die doch so viel besser zusammenpassten. Marian schloss die Augen und atmete tief durch. Solche Gedanken hatte er sich doch verboten! Mit dem Erfolg, dass Sina ihn immerhin als Freund akzeptierte und wieder an sich heranließ. Auf Armeslänge sozusagen. »Lass uns doch Freunde bleiben«, hatte sie nie gesagt. Aber nerven lassen würde sie sich nicht von ihm, das stand felsenfest.
Er schloss die Redaktion hinter sich ab und stieg die knarrende Treppe hinunter. Das mit den Bierchen war bestimmt nicht die schlechteste Idee. Aber vorher ein bisschen Bewegung, um Dampf abzulassen. War sowieso besser, denn mit dem Alkohol würde der Hunger kommen, und er fühlte sich mal wieder etwas zu schwer. Spazieren? Nein, lieber das Fahrrad. Das lag ihm mehr, und er liebte den Fahrtwind im Gesicht. Sein Trekkingrad liebte er auch. Es war extrem leichtgängig, durch die beiden Hörner seitlich am Lenker auch auf längeren Strecken sehr bequem und durch die Schaltung mit 21 Gängen sowohl ergonomisch als auch flott. Mancher hatte ihm schon »Elektrospinner« nachgerufen, wenn er ihn mit viel Speed überholt hatte. Dabei hatte das Rad gar keinen Elektroantrieb.
Wenn er so darüber nachdachte, dann waren die unfreundlichen Kommentare in letzter Zeit häufiger geworden. Und die Wortwahl deftiger. Pöbeln lag offenbar im Trend, selbst hier auf Langeoog, wo die meisten Menschen im Urlaub waren und eigentlich entspannt sein sollten! Woher kam das eigentlich? War das die allgemeine Verrohung der Gesellschaft, von der man las?
Marian hörte auf zu treten, ließ sein Rad ausrollen und richtete sich im Sattel auf. Ganz schön weit war er in den letzten zehn Minuten gefahren; er befand sich irgendwo im Niemandsland zwischen Inselbahnhof und Hafen. Musste hier nicht der Golfplatz sein? Ach nein, da war ja der neue Reiterhof, wo man Großpferde und Ponys für Ausritte mieten konnte. Die Betreiber boten Kutschfahrten und andere Freizeitbeschäftigungen an, Lassowerfen und Bogenschießen zum Beispiel. Hatte erst letzte Woche in einer größeren Anzeige im »Inselboten« gestanden. Außerdem hatte er gehört, dass Landwirtschaftliches und Handwerkliches zum Angebot gehören sollten: Käseproduktion, Bier brauen, Holz- und Schmiedearbeiten und solche Dinge. Klang alles in allem nach einer Bereicherung der insularen Infrastruktur.
Zur Straße hin war das Hofgelände eingezäunt. Das breite Holztor der langen, schnurgeraden Einfahrt stand offen. Am Mast vor dem Wohn- und Stallgebäude flatterte eine Flagge. Die deutsche war das nicht. Die Grundfarbe sah nach Orange aus, darauf war ein schwarzer Kreis zu sehen mit etwas Geknicktem innen drin. Ein Ellbogen? Oder etwa ein Bumerang?
Ein Hund!
Nicht auf der Flagge, dafür in der Realität. Ein großer Hund, schwarz wie die Nacht. Und anscheinend schnell. Sein wütendes Knurren klang abgrundtief bis zu Marian herüber. Manche Hunde, so hieß es, wollten ja nur spielen. Dieser Hund spielte eindeutig nicht. Marian hob den Hintern aus dem Sattel. Die Pedale fühlten sich plötzlich an wie einbetoniert, und es dauerte einen Moment, bis er auf die Idee kam herunterzuschalten. Einen kostbaren Moment. Die Bestie hatte fast das offene Gatter erreicht, das drohende Grollen klang lauter und lauter.
Echte Radprofis konnten während voller Fahrt unter der eigenen Achsel hindurch nach hinten schauen, um die Konkurrenz im Auge zu behalten; Marian wusste das von den Tour-de-France-Übertragungen im Fernsehen. Als er das jetzt selbst versuchte, hätte er sich um ein Haar auf die Nase gelegt. Ein Blick zurück gelang ihm trotzdem: Die Zähne dieser Töle waren lang und blendend weiß.
Marian hatte Fahrt aufgenommen, schaltete hoch. Und gleich noch einmal. Viel schneller ging es nicht mehr. Noch ein Blick, diesmal oben über die Schulter: Es würde nicht reichen. Der Hund kam immer näher, und er schien wild entschlossen, seinen Angriff zu Ende zu bringen.
Zu Ende? Zu welchem Ende?
Früher, als Schüler, hatte Marian mal morgens Zeitungen ausgetragen, mit seinem alten Fahrrad. Ein riesiger Hirtenhund war ihm bellend auf die Pelle gerückt; Marian hatte sein Rad als Schild benutzt und das tobende Tier so lange auf Distanz gehalten, bis der verschlafene Besitzer ein Fenster geöffnet und gepfiffen hatte. Ob er das wieder versuchen sollte? Aber dazu müsste er zunächst mal anhalten und absteigen, und in den paar Sekunden hätte er das Biest garantiert am Bein hängen. Oder am Hintern.
Was also tun? Nach dem Tier treten, sobald es nahe genug heran war? Mit dem Sommerschuh samt ungeschütztem Knöchel mitten hinein ins Labyrinth dieser blitzenden Hauer? Außerdem müsste er dazu aufhören zu treten und konnte ins Schlingern kommen, dann war er geliefert. Oder schlagen? Aber womit? Er hatte nichts dabei, nicht einmal einen Regenschirm. Höchstens die Luftpumpe unten am Rahmen. Nur war die aus Plastik und federleicht, darüber lachte diese Riesentöle doch nur! Aber irgendetwas musste er tun. Also bückte er sich und angelte nach dem Ding, ohne dabei aus dem Tritt zu kommen, was nicht leicht war, denn die Pumpe war nicht eingehakt, sondern mit Lochbändern angelascht. Als er sie endlich gelöst hatte, war der Hund neben seinem Hinterrad. Marian spürte, wie die Angst alles in ihm zusammenkrampfte. Andeuten, dachte er, erstmal nur andeuten. Vielleicht lässt sich das Tier erschrecken. Muss ja nur ein bisschen auf Distanz bleiben. Irgendwann sind wir an seinem Territorium vorbei, dann wird es aufhören, mich zu jagen. Allerdings ließ ein Blick auf den schier endlosen Zaun keine nahende Grundstücksgrenze erkennen. Also hob Marian die Plastikpumpe und fuchtelte damit nach hinten, vor der Nase des Hundes vorbei. Überraschenderweise traf seine Finte auf Widerstand. Der Hund jaulte kurz auf, dann wurde sein Grollen lauter.
Und wurde von einem schrillen Pfiff übertönt. »Rasmus!«, rief eine Männerstimme. »Rasmus, hierher!«
Der Hund gehorchte, ohne zu zögern, ließ von Marian ab und rannte auf den Zaun zu. Dort, in Fahrtrichtung, stand ein Mann. Grüßend nickte er Marian zu, während er das Tier mit knapper Geste zum Sitzen aufforderte. Wieder gehorchte der Hund augenblicklich.
Keine Sekunde zu früh, dachte Marian. Er fühlte sich am Ende seiner Kraft. Seine Beine hatten das Treten eingestellt, ohne auf seinen Entschluss zu warten; sie brannten und schmerzten. Das Fahrtmoment trug ihn dennoch an dem Mann am Zaun vorbei. Aus den Augenwinkeln nahm er dessen Bild in sich auf: schwarzes T-Shirt, knielange schwarze Hose, derbe hohe Schuhe. Dunkle Haare, seitlich raspelkurz gestutzt, hinten zu einem kurzen Zopf geflochten. Dichter dunkler Vollbart. Der Mann trug etwas Länglich-Schmales in der Hand, einen Wanderstab vielleicht.
Sollte Marian sich bei diesem Menschen bedanken? Immerhin hatte der ihn durch sein Eingreifen – na ja, wenn nicht gerettet, so doch vor Schaden bewahrt. Andererseits wäre sein Hund der Verursacher dieses Schadens gewesen und damit quasi er selbst. Also wofür bedanken? Aber doch wenigstens grüßen, dachte Marian und hob die freie Hand. Zu spät fiel ihm ein, dass er die Luftpumpe darin hielt.
Der schwarze Mann lachte. Es klang weder böse noch spöttisch, sondern einfach nur heiter.
Im selben Moment wurde Marian etwas klar. Er bremste scharf und hielt an, stemmte ein prickelndes Bein auf den Boden und schwang sein Fahrrad herum. Jetzt stand der Mann in seinem Blickfeld, schwarz gekleidet, den schwarzen Hund neben sich sitzend. Und in der Hand dieses Ding.
Marian stieß sich ab, ließ sein Rad dichter an den Zaun heranrollen. Der Hund zeigte seine scharfen Zähne, aber nur beim Hecheln. Es sah aus, als ob er lachte.
Der Mann am Zaun tat das wirklich. »Clever, das mit der Luftpumpe«, rief er. »Sowas schnallt ein Hund natürlich nicht, dass sich solch ein Ding beim Zuschlagen verlängert. Woher soll er das auch wissen? Also weicht er nicht aus, und zack! Schon bekommt er eins auf die Nase. So verschafft man sich Respekt, ohne dem Tier allzu sehr wehzutun. Was, Rasmus?« Er rubbelte den Hals des Hundes, der daraufhin so heftig mit dem Schwanz wedelte, als gelte es, die ganze Wiese stoppelkurz zu mähen.
»Godehau«, keuchte Marian, immer noch um Atem ringend. »Marian Godehau. Tut mir leid, wenn ich Ihren Hund …«
»Petersen«, unterbrach ihn der Mann. Er mochte Mitte 30 sein, vielleicht auch jünger; die Fältchen in seinem hageren, sonnenverbrannten Gesicht konnten täuschen. »Sven Petersen. Und Sie heißen also Godehau, ja? Ein sprechender Name, sehr interessant. Einer Ihrer Vorfahren war wohl ein angesehener Handwerker. Wissen Sie, was der gehauen hat? Holz oder Stein? Und was hat er hergestellt?«
Marian fühlte sich auf dem falschen Fuß erwischt. »Äh, nein, weiß ich nicht«, musste er zugeben. »Meine Mitschüler früher haben den Namen ganz anders interpretiert. Sie wollten immer, dass ich ihnen beweise, wie gut ich hauen kann.«
»Auch eine mögliche Erklärung.« Er grinste breit. Rasmus hechelte.
Marians Lächeln blieb schmal. Es ging diesen Petersen nichts an, dass er den Beweis guten Hauens schuldig geblieben war.
Lieber wollte er über das Ding reden, das der Schwarzgekleidete in der Hand hielt. »Ein Langbogen. Sie schießen? Auf diesem Gelände?«
»Ja, genau. Hier auf meinem Land.« Er hielt Marian den Langbogen hin; die Sehne war entspannt, weshalb der Bogen keine Krümmung aufwies und für einen unkundigen Betrachter wie eine Stange oder ein Stab aussah. Lediglich die Ledermanschette in der Mitte wies auf den wahren Verwendungszweck hin, ebenso wie die Kerben für die Sehne an beiden Enden.
»Sie sind auch Bogenschütze?«
»Ja, bin ich. Allerdings Recurve. Und ich bin schon ewig nicht mehr dazu gekommen.« Ehrfürchtig betrachtete er die geflochtenen Zierbänder ober- und unterhalb des Ledergriffs. Der Bogen selbst war etwa so lang wie sein Besitzer, vermutlich 1,80 Meter; er war völlig schlicht gehalten, das Holz war dunkel gescheckt, vermutlich mit einem kleinen Brenner geflämmt, und braun lasiert.
»Tja, das ist so eine Sache, wozu man kommt und wozu nicht. Ich sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.« Er wies hinter sich, quer über die Weide: »Hab mir meine eigene Strohscheibe aufgestellt, abseits der Schießbahn für Touristen, da kann ich trainieren, wann immer ich will.« Auf seinem ausgestreckten Unterarm zeichnete sich eine großflächige Tätowierung ab.
Marian konnte nicht erkennen, was sie darstellen sollte. Vielleicht war es auch nur ein Tribal, ein Muster aus einer anderen Kultur. Tja, dachte er, wenn man sein eigenes Land hat, dann ist der Weg vom Willen zur Zielscheibe natürlich nicht weit. Das behielt er aber für sich. Stattdessen nickte er anerkennend: »Haben Sie den Bogen selbst gebaut?«
»Ja«, sagte Petersen. »Aus Manau-Holz. War mein erster, da ist man mit Manau auf der sicheren Seite, das ist wie Rattan, hat keine Jahresringe. Das kann man bearbeiten, wie man will, ohne dass es bricht.« Spielerisch drehte er den Bogen in der Hand: »Inzwischen habe ich ganz andere Kaliber gebaut. Aber dem hier halte ich trotzdem die Treue.«
Jetzt erst entdeckte Marian die Sehne, ebenfalls geflochten, aus verschiedenfarbigen Strängen; auf der einen Seite war sie eingehakt, auf der anderen Seite mit der Schlaufe, Öhrchen genannt, über den verjüngten Bogenarm nach unten geschoben, sodass das Bogenholz entspannt und nahezu gerade war. Diese Technik hatte den Vorteil, dass solch ein Langbogen sekundenschnell schussbereit gemacht werden konnte: Man legte das eine Ende über den Spann des rechten Fußes, stieg mit dem linken darüber und bog das Holz über den linken Oberschenkel, bis sich das Sehnen-Öhrchen nach oben schieben und einhaken ließ. Fertig, schon konnte man … Apropos, wo hatte dieser Petersen eigentlich seine Pfeile? Am Gürtel, wo Marian immer seinen Köcher trug, baumelte bei ihm nichts.
Der Schwarzgekleidete tätschelte seinen Hund, beugte sich dabei leicht zur Seite. Aha, er trug einen Rückenköcher! Und zwar tief und eng, sodass die Pfeile hinter dem Oberkörper verborgen blieben. Die Haltegurte des Köchers waren ebenso schwarz wie Petersens T-Shirt.
Marian wandte sich Rasmus zu, hielt ihm den Handrücken hin; der Hund schnupperte neugierig, dann schlappte er darüber, ehe Marian zurückzucken konnte. Die Zunge war warm, weich und rau zugleich. Und natürlich nass.
Petersen lachte. »Na, jetzt habt ihr beide ja schon Freundschaft geschlossen! Da könnten Sie doch nächstens mal zum Schießen rüberkommen, oder? Oder darf ich Du sagen, Marian? Macht man doch so unter Sportkollegen.«
»Ja, aber klar, das ist nett.« Marian war ehrlich erfreut über die Einladung. Wäre schön, endlich mal wieder mit dem Bogen zu trainieren! Wär bestimmt auch gut für seinen gestressten Rücken und seine Haltung. »Wann wollen wir denn … ich meine, ich rufe am besten vorher an, oder?«
»Ja genau, mach das. Wir kommen bestimmt zusammen, terminlich. Die Nummer hast du ja, stand letztens in der Anzeige bei euch im Blatt.« Er zwinkerte Marian zu; offenbar war er bestens darüber informiert, wen er vor sich hatte.
Petersen musterte den Himmel, der nach und nach dämmerig wurde. »Ich hätte sonst gesagt, wir schießen gleich mal ein paar Passen mit meinem Bogen, aber das Büchsenlicht kommt uns abhanden. Also ein andermal.«
Marian verabschiedete sich, auch bei Rasmus, der ihm mit vollem Körpereinsatz nachwedelte. Unglaublich, wie schnell solch ein Tier sein Verhalten ändern konnte!
Langsam radelte er in Richtung Wasserturm. Jetzt noch ein Bierchen im »Dwarslooper«, dann war er endgültig reif fürs Bett. Trotz all der Aufregung, die der Tag gebracht hatte, würde er bestimmt gut schlafen.
Interessanter Mann, dieser Petersen, dachte Marian. Typ Waldläufer, aber auf eigenem Terrain. Und dass der auch noch Bogenschütze war! Vielleicht hatte er endlich eine verwandte Seele gefunden. Schöner Bogen, spannender Rückenköcher. Und diese Pfeile – irgendetwas an denen war ihm komisch vorgekommen. Ihm fiel ein, was. Es waren die Federn. Jeder Pfeil trug drei Federn an seinem Ende, gewöhnlich zwei gleichfarbige und eine in anderer Couleur, nämlich die Leitfeder. Damit man den Pfeil immer gleich richtig an der Sehne einnockte. Petersens Federn jedoch zeigten drei verschiedene Farben: Schwarz, weiß und rot. Merkwürdig. Aber auch nicht so wichtig, fand Marian und trat kräftiger in die Pedale.