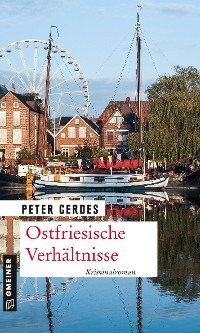Kitabı oku: «Ostfriesische Verhältnisse», sayfa 4
6.
»Domian, nein! Lass das, Domian! Domian, kannst du nicht hören? Ich will das nicht, verdammt noch mal!«
Die Frau wehrte sich aus Leibeskräften, aber Domian war einfach zu stark. Unmöglich, ihm zu widerstehen, wenn er etwas wirklich wollte. Dann bremste ihn nichts und niemand. Und ein »Nein« schon gar nicht.
»Nein, Domian! Nicht!« Vergebens, sie hatte keine Chance. Sie musste aufhören, sich dagegenzustemmen, zu ziehen und zu zerren, sonst ging es ihr dreckig. Das wusste sie aus böser Erfahrung.
Sie ließ die Leine los. Während die Frau auf dem weichen, glitschigen Boden stolpernd um ihr Gleichgewicht rang, sauste Domian davon, hinter der getigerten Katze her hinein in den modderigen Graben. Während aber die Katze leichtfüßig über den stinkenden Schlamm hinwegsetzte und am jenseitigen Ufer im Unterholz verschwand, platschte der blendend weiße Golden Retriever mitten hinein.
»Ach, Domian.« Die Frau schüttelte den Kopf. Hoffentlich blieb das dämliche Viech nicht auch noch im Modder stecken! Einmal war das schon passiert, und sie hatte Hilfe holen müssen, um das Vierzig-Kilo-Biest wieder auf festen Boden zu zerren. Anschließend hatte sie Stunden gebraucht, um den Hund zu waschen, zu trocknen und zu bürsten, bis jedes Stäubchen und jede Geruchsspur wieder entfernt war. Ihre Tochter stellte sich ja dermaßen an mit dem Hund!
Dabei gehörte der Retriever eigentlich Oliver. Aber der hatte schon lange das Interesse an dem Tier, das ihm sein Onkel geschenkt hatte, verloren. Sich selber um die Töle zu kümmern und womöglich mit Domian Gassi zu gehen, dafür hatte der feine junge Herr natürlich keine Zeit.
»Komm her, Domian! Komm her! Sei ein Braver. Kriegst auch ein Leckerli.« Auch noch belohnen musste sie dieses störrische Vieh. Das ging ihr total gegen den Strich. Aber was half es, Oliver Eickhoff hatte den Hund in der kurzen Zeit, die er bei ihm verbracht hatte, komplett verwöhnt, und jetzt war Domian mit normalen Mitteln nicht mehr beizukommen. Bestochen wollte er werden, verhätschelt und betütert, bei jeder Gelegenheit. Tja, wie der Herr, so das G’scherr.
Erschrocken schaute sich Antje Baumann nach allen Seiten um. Dass sie diese ungebührlichen Worte nicht etwa laut ausgesprochen hatte, das wusste sie natürlich. Aber vielleicht stand es ihr ja ins Gesicht geschrieben, was ihr da gerade durch den Kopf gegangen war! Wusste man’s? Nein, man wusste es nicht. Wusste man nie! Es gab eben doch mehr zwischen Himmel und Erde, als in der Schule gelehrt wurde. So hatte es neulich erst wieder im Fernsehen geheißen. Und in der Kirche auch.
Antje Baumann war Anfang fünfzig; nächstes Jahr würde sie nun schon fünfunddreißig Jahre bei den Eickhoffs in Stellung sein. Sie hatte bereits den Haushalt in der großen Villa in Leer-Loga besorgt, ehe Karl-Friedrich dort das Kommando übernommen hatte. Seit Heinrich-Wilhelm Eickhoff vor einigen Jahren verstorben war, wurde sein Sohn Karl-Friedrich »Eickhoff senior« genannt. Für Antje Baumann klang das immer noch irgendwie falsch. Obwohl, das gab sich, so nach und nach. Karl-Friedrich Eickhoff, früh verwitwet, wurde seinem Vater immer ähnlicher. Außerdem nannte sie ihn sowieso immer »gnädiger Herr«, genau wie seinen Vorgänger, da konnte sie sich nicht verplappern.
Er nannte sie immer »Mädchen«, auch jetzt noch, mit Anfang fünfzig. So hatte eben alles seine Ordnung.
»Domian!« Antje Baumann beeilte sich, dass sie dicht genug an den Graben herankam, um womöglich das Ende der langen, edlen Lederleine zu erwischen. Hoffentlich war die nicht auch ganz verdreckt! Die musste nach dem Reinigen nämlich eingefettet werden, sonst wurde sie beim Trocknen rissig. Und falls der junge Herr das bei einem seiner Besuche im Stammhaus mitbekam, würde er wieder fuchsteufelswild. Auch wenn ihm der Hund ansonsten egal war.
Sie erreichte den Grabenrand und beugte sich vor, die Arme ausgebreitet, um nicht die Balance zu verlieren. »Domian?« Der Hund war nirgends zu entdecken, ebenso wenig wie das Leinenende. Um Gottes willen, das Tier würde doch nicht im Schlamm versunken sein?! Das würde ihre Tochter ihr nie verzeihen, und sie sich auch nicht. Denn verzogen oder nicht, sie hatte dieses trottelige Tier doch ziemlich lieb. Ebenso wie Aylin.
Nein, nichts zu sehen. Zwar dämmerte es bereits, aber einen Hund mit einem derart hellen Fell hätte man doch auf jeden Fall noch erkennen müssen, sogar im Schatten! Es sei denn, das Viech war von oben bis unten schlammgrau eingefärbt, dann konnte sie lange gucken. Und später schrubben.
»Domian? Domian!« Wie aus dem Nichts war der Hund plötzlich da, sprang von der Seite her an ihr hoch, stieß mit seiner nassen Schnauze ausgelassen nach ihrem Gesicht. Natürlich war er von oben bis unten eingedreckt. Vergeblich versuchte Antje Baumann, Domian mit ausgestreckten Armen von sich und ihrer Kleidung fernzuhalten; dadurch verlor sie erst recht die Balance. Schwer plumpste sie auf den weichen Untergrund des Spazierwegs.
»Dreck! Verfluchter Dreck!« Der Rock war hin, die Strümpfe bestimmt auch, und was die Schuhe anging, konnte sie nur hoffen. Die Herrschaft verlangte stets ein tadelloses Äußeres von ihr, und bei dem Lohn, den sie bekam, was das nicht immer leicht. Wenigstens hatten Jacke und Bluse noch nicht so viel abbekommen …
Domian stellte sich direkt vor sie und schüttelte sich ausgiebig. Der Dreck flog ihr nur so um die Ohren – und auf ihre Kleidung. Na toll, jetzt sah sie endgültig aus wie ein Schwein.
Mühsam rappelte Antje Baumann sich auf. Mit der linken Hand schnappte sie sich Domians Leine, mit der anderen zückte sie ihr Handy. So, wie sie aussah, konnte sie unmöglich unter Leute.
»Edwin? Du musst mich abholen. Bitte. Ich hab ein Malheur gehabt.« So knapp, wie es ihr möglich war, schilderte sie Eickhoffs Chauffeur, was ihr widerfahren war. »Du müsstest doch jetzt Zeit haben. Der gnädige Herr ist bestimmt mit seinem Geländewagen los, richtig? Na also. Dann bitte zu dem Parkplatz am Spazierweg, ja, in Heisfelde, du weißt schon, wo das ist. Und beeil dich, ehe mich noch einer sieht.«
Edwin war alles andere als begeistert. »Was gibst du dich denn auch immer noch mit diesem Hund ab? Fütterst ihn auf eigene Kosten durch! Dabei gehört der dem jungen Herrn, und seit der seinen eigenen Bungalow bekommen hat, sind wir für ihn doch gar nicht mehr zuständig! Und für seinen Hund schon gar nicht! Oliver hat jetzt seine eigene Haushaltshilfe, warum geht die denn nicht Gassi?«
Antje Baumann schüttelte den Kopf. Natürlich hatte Edwin recht, leider, aber darum ging es ja nicht. Es ging um Verantwortung. Wenn man die einmal übernommen hatte, dann gab man die nicht so einfach wieder ab. Verantwortung klebte an einem wie Honig. Zumal Aylin so in den Hund vernarrt war.
»Kommst du mich jetzt holen, oder was?«, schimpfte sie in ihr Telefon. »Wenn nicht, dann kannst du deine Klamotten gleich wieder aus meinem Schrank holen, das sage ich dir! Dann schläfst du ab sofort wieder oben unterm Dach, verstanden?«
»He he, nun übertreib mal nicht gleich. Ich komme ja.« Edwin beendete das Gespräch.
Antje Baumann straffte sich. Fünfzig mochte sie ja sein, aber ihre Möglichkeiten hatte sie immer noch.
Sie steckte ihr Handy weg, klopfte ein wenig an ihrer verdreckten Kleidung herum, was sich als ebenso zwecklos erwies wie vermutet, und machte sich auf den Weg zurück zum Parkplatz. Domian hatte sich offenbar ausgetobt und folgte ihr willig. Wenigstens etwas, dachte Antje Baumann. Hoffentlich hatte Edwin genügend Verstand, um mit dem alten Kombi zu kommen, den sie immer zum Einkaufen benutzten. Da lagen alte Decken drin, dann musste sie anschließend wenigstens nicht noch ein ganzes Auto putzen.
Der Knall ließ sie erstarren. Ein Schuss, das war ihr erster Gedanke, ein Schuss, und ziemlich nah noch dazu. Verdammt, wer jagte denn hier, direkt am Rand der Siedlung? Dann erst erwog sie die anderen Möglichkeiten. Eine Fehlzündung, ein geplatzter Reifen, ein Feuerwerkskörper? Nein, nichts davon. Sie hatte ihre Herrschaften schon zu Jagdgesellschaften begleitet, um nach verblasener Strecke einen Imbiss zu reichen. Sie wusste, wie Schüsse klangen, und dies hier war einer gewesen.
Na Gott sei Dank, wenigstens war sie nicht getroffen worden. Vorsichtig ging sie weiter.
Domians Leine straffte sich, und als Antje Baumann sich umdrehte, sah sie, dass der Hund zu Boden gesunken war. Sein dreckverkrustetes Fell nahe der Hinterhand glänzte von frischer Nässe. Mit großen, unendlich traurigen Augen starrte der Golden Retriever sie an. Dann erst begann er leise zu fiepen.
»Domian?« Antje Baumann bückte sich, fasste nach der feuchten Stelle. Unter ihren Fingern pulste es warm, und obwohl es schon fast dunkel war, konnte sie den roten Schimmer deutlich erkennen. Nun jaulte der Hund, leise und schicksalsergeben. Es war herzzerreißend.
Jemand hatte auf Domian geschossen! Auf ihren Hund, vielmehr auf den Hund, für den sie die Verantwortung trug, die so klebrig war wie das Blut an ihrer Hand. Wer tat denn sowas? Wer schoss denn auf einen unschuldigen Hund?
Motorengeräusch drang zu ihr herüber. War das Edwin mit dem Kombi? Aber so klang es nicht, es klang anders. So, wie es früher geklungen hatte, wenn Olivers merkwürdige Freunde zu Besuch gewesen waren und wieder wegfuhren. Auf ihren Motorrädern! Richtig, das Geräusch kam von einem Motorrad. Und es entfernte sich. Jetzt kam noch ein Quietschen dazu, der Motor brüllte in der Ferne noch einmal auf, dann war es wieder still. Bis auf das Jaulen des Hundes.
»Domian, mein armer Domian. Stirb mir bloß nicht.« Sie riss ein Päckchen Taschentücher heraus, presste es auf die Wunde, um die Blutung zu verlangsamen, und versuchte es mit ihrem Halstuch zu fixieren. Schade drum, das war ihr gutes Halstuch. Aber darauf kam es auch nicht mehr an.
Als Edwin einige Minuten später den Spazierweg mit seiner starken Taschenlampe ableuchtete, fand er Antje Baumann zusammengekauert und schluchzend vor, die Arme um Domian geschlungen. Der Hund lag ganz still, nur seine Rute zuckte leicht zur Begrüßung.
7.
»Hören Sie mal, Herr Christiansen, jetzt müssen Sie aber mal was unternehmen. So geht es wirklich nicht weiter!«
Gerd Christiansen seufzte leise, ließ sein Fahrrad ausrollen und schwang sich aus dem Sattel. Eine Bewegung, die er seit seiner frühen Kindheit praktizierte und die ihm daher auch immer noch halbwegs elegant gelang, trotz seiner Körperfülle. In der Leeraner Altstadt fuhr er grundsätzlich mit dem Rad; Parkplätze waren hier Glückssache. Deshalb war er nach seiner Rückkehr aus Aurich auch zunächst nach Hause gefahren, obwohl es schon fast sieben Uhr war und er sich beeilen musste, um seine Buchhändlerin noch anzutreffen.
Das konnte er nun vergessen. Sein Nachbar hatte ihm aufgelauert, und Christiansen ahnte auch schon den Anlass. Kein erfreulicher, so viel war klar.
Unnötig umständlich schob er sein Rad in die schmale Lohne zwischen seinem Geschäftshaus und dem benachbarten Gebäude, lehnte es gegen die Wand und ließ das Ringschloss einrasten. Danach war die Konfrontation nicht länger hinauszuzögern.
»Dann waren die jungen Leute wohl wieder mal zu laut, Herr Terveer?« Christiansen legte den Kopf in den Nacken und schaute die efeubewachsene, cremeweiß verputzte Mauer seines Geschäfts- und Mietshauses hoch; die beiden großen Sprossenfenster im ersten Stock gehörten zur Küche der großen Wohnung, die er nach langem Zögern an diese WG vermietet hatte. Eine Entscheidung, die er längst bereute.
»Laut ist überhaupt kein Ausdruck.« Der kleine, rotgesichtige Mann bebte vor unterdrücktem Ärger. »Das war ein Radau letzte Nacht, schlimmer als bei den Hottentotten! Erst diese Musik, Sie wissen schon, die so klingt, wie wenn dicke Bleche ausgestanzt werden. Dann kam noch dieses Gebrüll und Gekreische dazu. Und alles lange nach Mitternacht! Irgendwann wurde es mir zu bunt, ich hab mir den Bademantel übergezogen, bin raus und hab bei denen geklingelt, zweimal. Danach war es dann ruhig, aber aufgemacht hat keiner.« Er schnaufte vor Wut. »Es reicht. Es reicht mir wirklich! Greifen Sie endlich durch!«
Christiansen nickte verständnisvoll. Die Beschreibung seines Nachbarn stand wohl für Techno und Hip-Hop, in dieser Reihenfolge. Auch er fand beide Musikrichtungen überwiegend grauenhaft, da brauchte er nicht zu heucheln. Nur zu südafrikanischen Völkern hatte er eine andere Einstellung, aber die hier und jetzt zu thematisieren, schien ihm nicht angeraten. »Ich verstehe das wirklich nicht, Herr Terveer«, beteuerte er. »Letztes Mal habe ich den jungen Leuten doch ganz klar gesagt, was hier in der Altstadt geht und was nicht! Gelbe Karte, habe ich gesagt, ach was, dunkelgelb! Benehmt euch, hab ich gesagt. Noch so ein Ding, und ihr könnt euch eine andere Bleibe suchen!«
»Das war wohl, als deren Besuch nachts übers Dach geklettert und über den Balkon eingebrochen ist, weil er den Hausschlüssel vergessen hatte, was?« Terveers Gesicht lief noch dunkler an. »Meine Frau hätte seinerzeit fast einen Herzinfarkt bekommen, als sie wach geworden ist und das gesehen hat! Bloß gut, dass sie letzte Nacht gar nicht hier war, sondern bei ihrer pflegebedürftigen Mutter übernachtet hat. Also, das sage ich Ihnen, ich hätte diesen WG-Typen damals gleich den Stuhl vor die Tür gestellt.«
Christiansen biss sich auf die Lippe. Jetzt hatte er sich selbst in die Ecke geschwatzt. Mit einer weiteren letzten Verwarnung konnte er nicht mehr kommen; diese Karte hatte er bereits ausgespielt. Und sie hatte ganz offenkundig nicht gestochen.
Er musterte sein Haus, die Hände in die Seiten gestemmt, und seufzte erneut. Er liebte dieses Gebäude, hatte es schon früher geliebt, als es noch nicht seins gewesen war. Dann hatte es leer gestanden und wäre vielleicht ganz verfallen, wenn seine Frau und er es nicht gekauft und gerettet hätten. Tja, schön und gut. Um aber solch ein Haus dauerhaft zu erhalten, mussten sämtliche Räume genutzt werden, nicht nur Buchladen und Restaurant, sondern auch die beiden Wohnungen im ersten Stock. Christiansen musste also Vermieter werden. Damit hatte der ganze Ärger angefangen.
Und jetzt war es Zeit für den Befreiungsschlag. Da hatte der Nachbar wohl recht.
Christiansen gab sich einen Ruck, stieg die beiden Stufen zum Seiteneingang hoch und betätigte die Klingel. Von oben war schwach der Gong zu hören. Big-Ben-Sound, das hatte er passend gefunden für ein Haus, das ganz auf Krimi abgestellt war. Krimi, das war immer noch irgendwie englisch, Dartmoor, Themse-Nebel und so. Eigentlich hätte er ja auch selbst in die Wohnung einziehen können; dann wäre ihm dieser Ärger erspart geblieben.
Er klingelte noch einmal. Nichts rührte sich. Waren die Bewohner etwa schon ausgeflogen? Oder lagen sie nach dieser durchzechten und durchtobten Nacht immer noch im Säuferkoma? Abends um nach sieben? Nicht wirklich wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen.
Christiansen war sich gar nicht sicher, wie viele Mieter eigentlich tatsächlich hier wohnten. Vier waren es ursprünglich gewesen, die den Vertrag unterzeichnet hatten, nicht zu viele für diese ungewöhnlich große, verwinkelte Wohnung mit dem riesigen Wohnzimmer. Aber schon sehr bald hatte reges Kommen und Gehen eingesetzt, immer wieder waren neue Gesichter aufgetaucht, andere dafür nicht mehr. Frederik Jaschinsky, der Hauptmieter, hatte auf Nachfragen stets ausweichend geantwortet. Der Vermieter hatte sich damit zufriedengegeben. Die Miete war ja auch immer pünktlich überwiesen worden.
Er drehte sich zu Terveer um und zuckte die Achseln. »Es öffnet keiner«, stellte er überflüssigerweise fest. Problem vertagt, jetzt konnte er sich doch noch dem Tagesabschluss seiner Buchhandlung widmen. Christiansen fühlte sich erleichtert.
Der Nachbar aber machte nicht den Eindruck, als gäbe er sich damit zufrieden. Sein Kinn zuckte auffordernd in Richtung Tür. »Ist doch gar nicht richtig zu«, sagte er. »Gehen Sie doch einfach rauf. Einer von denen ist bestimmt da oben. Dann können Sie’s dem gleich direkt ins Gesicht sagen.« Seine verschränkten Arme machten deutlich, dass er vorhatte, die Ausführung dieses Vorschlags bis zum Schluss zu überwachen. Offenbar traute er dem korpulenten Buchhändler nicht allzu viel Konsequenz zu.
Christiansen stupste die schwere Holztür mit den Fingerspitzen an. Tatsächlich, nur angelehnt; geräuschlos schwang sie auf. Der typische, feucht-staubige Geruch nach altem Gemäuer schlug ihm aus dem Treppenhaus entgegen. Heute schien er besonders intensiv zu sein.
»Los jetzt!«, knurrte es hinter ihm. Christiansen gab sich einen Ruck. Einmal musste es ja sein, warum also nicht jetzt?
Die gewundene Holztreppe knarrte und dröhnte unter seinen schweren Schritten. Der bordeauxrote Anstrich, noch keine zwei Jahre alt, sah schon wieder fleckig und verschrammt aus. Christiansen stöhnte erneut, diesmal aber lautlos, denn er hörte Terveer hinter sich her trapsen, und vor dem wollte er sich nicht noch mehr Schwächen erlauben.
Fast fünf Meter waren die Räume im Erdgeschoss hoch; entsprechend lange dauerte es, bis der obere Treppenabsatz in Sicht kam. »Hallo, Herr Jaschinsky? Sind Sie zu Hause?«, rief Christiansen. »Herr Jaschinsky, ich müsste mal mit Ihnen reden.« Als er selber noch Mieter gewesen war, hatte er zudringliche Vermieter gehasst. Wenigstens eine Vorwarnung musste sein.
Hinter sich hörte er Terveer verächtlich schnauben.
Die Treppe mündete direkt in einen Flur, von dem diverse Türen zu den Zimmern, in die Küche und ins Bad führten; Christiansen und sein nachdrängender Nachbar standen also praktisch schon mitten in der Wohnung. Nur eine der vielen baulichen Besonderheiten, die die Vermietung dieser ansonsten attraktiven Wohnung ziemlich erschwert hatten. Der Buchhändler entschied sich für die Küchentür und klopfte.
»Sind Sie irgendwo reingetreten?«, fragte Terveer hinter ihm. »Hier, gucken Sie mal, die Flecken. Macht aber nichts, ist ja sowieso alles dreckig.«
Christiansen schüttelte unwillig den Kopf. Für so etwas war jetzt nicht die Zeit. Die bevorstehende Konfrontation mit seinem unbotmäßigen Mieter beanspruchte seine volle Konzentration. Er klopfte noch einmal, horchte kurz, und als sich wieder nichts rührte, öffnete er die Küchentür.
Die Küche war menschenleer. Ansonsten sah sie genauso aus wie befürchtet: Umgeworfene Stühle, Scherben auf dem Boden, eklige Flecken, offenbar von Speiseresten und Rotwein. Batterien leerer Flaschen standen unter dem Fenster; in der Spüle türmte sich dreckiges Geschirr. Das ärgerte Christiansen. Hatte er diesem Jaschinsky und seinen Kumpanen nicht sogar die Küchenmöbel überlassen, kostenlos? Sah so der Dank dafür aus? Terveer hatte völlig recht, dieser Kerl und seine Mitbewohner mussten hier weg, unverzüglich, am besten heute noch.
Er durchquerte die Küche, wobei er sich Mühe gab, den schlimmsten Flecken auszuweichen. Eine seiner Sohlen klebte sowieso schon, da hatte sein Nachbar, der ihm nach wie vor auf den Fersen war, anscheinend recht gehabt. So langsam ging ihm dieser Rechthaber auf die Nerven. Jetzt würde er dem aber mal zeigen, dass ein Christiansen auch durchgreifen konnte.
»Herr Jaschinsky! He!«
Von dem winzigen Stück Flur hinter der Küche gingen gleich drei Durchgänge ab. Der Abstellraum links stand offen; aus den Augenwinkeln erkannte er ein Chaos aus Kartons und Plastikbeuteln. Geradeaus ging es in eines der Schlafzimmer. Mit Klopfen hielt sich der Vermieter nicht mehr auf. Er riss die Tür auf, stürmte hinein, drehte sich einmal um die eigene Achse, stellte sich auf die Zehenspitzen: niemand, auch in dem geräumigen Hochbett nicht. Aber es gab ja noch genügend weitere Zimmer.
Die dritte Tür führte ins Wohnzimmer, den prachtvollsten Raum der Wohnung, dessen sechs hohe Fenster gerade erst neu gestrichen worden waren. Das edle Parkett hatte Christiansen schleifen und ausbessern lassen. Wäre er doch bloß selber hier eingezogen! Der Himmel mochte wissen, was dieser Jaschinsky mit dem Parkett angestellt hatte.
Christiansen riss die Tür auf und stürmte hinein. Dann blieb er stehen, als sei er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Terveer rannte ihm in die Hacken, aber der Vermieter stand wie angewurzelt.
Gleich links von der Tür hatte sich ein See auf dem Parkett ausgebreitet. Auf den ersten Blick wirkte er schwarz; nur an den Rändern, wo die Flüssigkeit tief in die Ritzen und die Maserung des Parketts eingesickert war, offenbarte sie ihre wahre Farbe. Rot.
Links von der Tür befand sich auch der Heizkörper, ein mächtiges gusseisernes Ding, dessen Holzverkleidung entfernt worden war. An dieser Heizung hing ein Mensch, ein toter Mensch, Hals und Oberkörper an die Heizungsrippen gefesselt. Die Arme waren ausgebreitet, die Beine ausgestreckt und gespreizt, die Füße nackt und mit blutigen Wunden übersät, ebenso wie die Hände. Christiansen nahm an, dass dieser Mensch Frederik Jaschinsky war. Sicher sagen konnte er es nicht, denn das Gesicht dieses Menschen sah aus wie … Ihm fehlte ein Vergleich, bis ihm die Platte mit den Gulaschbrocken in der Fleischtheke seines Supermarkts einfiel.
Der süßlich-metallische Geruch, der im Raum hing, wurde ihm bewusst. Jetzt wird mir sicher gleich übel, dachte er, und als sich der Brechreiz meldete, war er bereit und kämpfte ihn nieder. Schweiß perlte über seine Stirn.
Etwas streifte ihn an Rücken und Arm. Christiansen zuckte zusammen; fast wäre er zur Seite gesprungen, mitten hinein in den See aus Blut. Gerade noch rechtzeitig merkte er, dass das nur Terveer war, der besinnungslos vornüberkippte und hart auf dem Boden aufschlug.
Christiansen zückte sein Mobiltelefon und drückte 110. Was für eine Schweinerei, dachte er dabei. Den Parkettboden kriege ich bestimmt nie wieder hin.