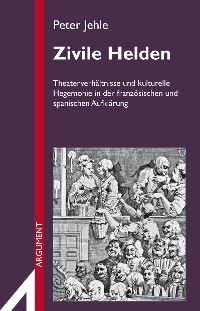Kitabı oku: «Zivile Helden», sayfa 2
II
Die Theaterverhältnisse in Madrid bieten im 18. Jahrhundert ein ähnliches Bild wie ein Jahrhundert früher in Paris. Zwar war auch in Spanien die Diskussion um die Regeln so alt wie in Frankreich, hatte doch bereits Cervantes den canónigo, der sich nicht dem »confuso juicio del desvanecido vulgo« unterwerfen wollte, zum Fürsprecher der Regeln gemacht (Don Quijote I, Kap. 48), aber erst im Bündnis mit der absolutistischen Reformbewegung kommt es im 18. Jahrhundert zu jener Konstellation von institutionalisierter Protektion, regelgeleiteter Textproduktion und einer den Text respektierenden Aufführungspraxis, die – wie der canónigo sich wünscht –, den Behörden die Unannehmlichkeit ersparen soll, strafend einzugreifen. Der Wunsch, die Theaterverhältnisse mögen – in selbsttätiger Regie der beteiligten Instanzen (Autoren, Schauspieler und Publikum) – als eine »lícita recreación« zum Besten des Gemeinwesens organisiert sein, ist so deutlich, dass Fritz Fries den Eindruck hatte, man entnehme den Diskussionen im 18. Jahrhundert »nichts Neues« (1964, 277). Es ist auch kein Zufall, dass die Jesuiten keineswegs ästhetische, sondern stets moralische Gründe gegen das Theater mobilisierten (in der Regel den unmoralischen Lebenswandel der Schauspielerinnen – ein ›Argument‹, das noch die antirepublikanische Presse gegen Lorcas Studententheater La Barraca in Anschlag bringt).
Die neoklassische Bewegung könnte also verstanden werden als ein Versuch, das Theater zu rehabilitieren, indem das moralische durch ein ästhetisches Paradigma ersetzt und so eine neue In/Kompetenz-Struktur etabliert wird. Zuständig für die Unterscheidung von richtigem und falschem Theater sind dann nicht mehr Kleriker, sondern die Neoklassizisten selbst, als Spezialisten für die Interpretation der in diesem Bereich geltenden Regeln. Wie die französischen Vertreter der doctrine classique stützten sie sich auf die Autoritäten der Antike. Dass sie selbst es sind, die diese Regeln allererst »erfinden«, ist weniger wichtig als der Versuch, der bestimmten Regelhaftigkeit Anerkennung zu verschaffen. Ihre Durchsetzung definiert ein neues Terrain der Auseinandersetzung: Es genügt nicht mehr, das Theater in toto als Erregung unsittlicher Leidenschaften zu verdammen, sondern die neue Differenz zu respektieren, diejenige zwischen dem schlechten und dem guten Theater, zwischen dem »gusto del vulgo« und dem »buen gusto«. Das neoklassische Paradigma betrifft die Theaterverhältnisse insgesamt: die Textproduktion so gut wie die Aufführung, die Autoren ebenso wie die Schauspieler und die Zuschauer, deren Rezeptionsgewohnheiten durch den neuen »Stil« enttäuscht werden und die sich deshalb auf das neue Theater nicht einlassen. Die Erfolge Moratíns sind die Ausnahme.
Vom Standpunkt der Neoklassiker erscheinen die Theaterverhältnisse bestimmt durch eine chaotische Ansammlung unregelmäßiger Stücke, über deren Erfolg ein ungebildetes Publikum entscheidet. Indes findet sich ›Aufklärung‹, wie Jorge Campos gezeigt hat, auch auf der Seite der von den neoclasicistas im Namen ihres ästhetischen Kanons bekämpften Werke eines Comella oder Francisco Durán, die die neue bürgerliche Arbeitsmoral vertreten. Ist, was vom Standpunkt der neoclasicistas als hoffnungslose Traditionsgebundenheit des »vulgo« erscheint, nicht gerade das Fundament einer Haltung, die nicht klein beigibt? Bedeutet, was sich als bloßes »Festhalten« am Alten darstellt (Krömer 1968, 34), nicht auch Protest gegen eine Elite, deren Bevormundung man sich nicht gefallen lässt? Ähnlich wie in Deutschland die Frontstellung gegen die französische Tragödie der ins Kulturelle gebannte Protest gegen eine französisch parlierende, selbstherrlich agierende aristokratische Oberschicht war? Die spanische Aufklärungsbewegung glaubte im Neoklassizismus die Muster und Formen des kulturellen Zements zu besitzen, mit dem sich der neue geschichtliche Block formieren konnte. Dieser Zement verlor mit dem Ankommen jenseits der Pyrenäen seine Bindekraft. Die Achse Intellektuelle/Volk kommt nicht zustande, weil in Spanien – anders als in Frankreich – das neue Theater sich nicht als Bewegung für eine neue Welt- und Lebensauffassung zu akkreditieren vermag. Fritz Rudolf Fries, der vom Misserfolg der neoclasicistas überzeugt ist, meint jedenfalls, dass dieser nicht auf »ästhetische Ursachen« zurückgeführt werden darf. Dass die Reform nicht gelang, darin will Fries überhaupt einen Schlüssel sehen für das »Versagen der Aufklärung in Spanien«, die scheitern musste, »solange sie nur in den Köpfen einzelner« existierte und »nicht von der historisch vorbereiteten Situation getragen« wurde (1964, 286). Was die Massen ergriff, das seien die Vorstellungen von Spaniens Ruhm und Größe gewesen, einer Vorstellungswelt, der die Stilgrenzen nicht standhielten.
Andererseits ist die neoklassizistische Theaterreform im Bündnis mit der Aufklärung doch auch eine kulturelle Tatsache. Wo immer auf dieser Linie erfolgreiche Stücke geschaffen wurden und man die Kraft zur Veränderung der Theaterpraxis aufbrachte, war weniger Konformität mit der poetischen Theorie der Grund, als vielmehr die Gestaltung von aus der spanischen Geschichte genommenen Stoffen. Selbst ein radikaler Neoklassizist wie Montiano fesselte das Theater an die »Historie […], aus der es Luzán befreien wollte« (Krömer 1968, 90). Indem die spanische Tragödie ihre Themen der nationalen Geschichte entnimmt (vgl. Caso González 1972, 28), wird die Bühne aufnahmefähig für die Darstellung von Möglichkeiten und Formen des Zusammenlebens; »auch als Tragödienautoren wollen sie […] als veränderbar erweisen, was lange als schicksalhaft verstanden wurde, und so setzen sie der blind waltenden fortuna der Geschichte die virtus des bewusst handelnden Menschen […] entgegen« (Lope 1992, 273). So bringe etwa García de la Huertas Raquel die »Notwendigkeit des kontrollierten Aufbegehrens gegen einen unfähigen Herrscher« auf die Bühne: das kontrollierte Aufbegehren ist nicht nur Einengung, Begrenzung, ein Sich-Bescheiden im Gegebenen, sondern eben auch Ermöglichung, Probehandeln, letztlich Einübung von Politikfähigkeit auf Seiten der Subalternen. Es ist, als deute diese Orientierung an Geschichtlichkeit mehr nach England oder Deutschland7 als nach Frankreich. Indes ist die dort erfundene weinerliche Komödie ein Genre, das in Spanien im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts große Erfolge feiert. Ausgerechnet Luzán, der dem Neoklassizismus das theoretische Brevier geschrieben hat, ist vom Erfinder des Genres, Nivelle de la Chaussée, so beeindruckt, dass er dessen Le préjugé à la mode übersetzt. Was Luzán theoretisch bekämpft, die Vermischung von Komödie und Tragödie, die ernsthafte Darstellung alltäglicher Begebenheiten, begeistert ihn praktisch: ein Werk, das mit der klassischen Entmischung der Genres gerade bricht. Die Personen, die bei Moratín auftreten, sind denn auch weder Könige noch Leute vom Dorf, sondern Stadtbewohner, die wesentlich der »clase media« entstammen.
Wenn Spanien als ›Land ohne Aufklärung‹ von der politischen Rechten lange Zeit positiv akzentuiert werden konnte, so deshalb weil die neue Achse Intellektuelle / Volk tatsächlich nicht zustande gekommen war und die Aufklärung als Bruch mit den Traditionen des Volkes präsentiert werden konnte – eines »Volkes«, dessen Begriff selbst traditionalistisch war und in der Vorstellung einem natürlichen Gewächs näher stand als dem aufklärerischen Begriff einer sich zum Souverän konstituierenden politischen Körperschaft. Die Voraussetzung eines Zusammenkommens von popular-nationaler Tradition und Aufklärung ist die Republik. Die Erfahrung von García Lorcas Theaterunternehmen gewinnt von daher eine paradigmatische Bedeutung.
III
Als Anton Reiser einmal auf der Straße vom Direktor des Lyzeums überraschend angeredet wurde, ob er nicht »Reiserus« heiße, war dies für den begabten, von den Eltern missachteten und in materieller und moralischer Bedrückung lebenden Knaben wie eine zweite Geburt. Der latinisierte Name, ausgesprochen von einer Person höchster Autorität, war wie das Versprechen einer von Misere freien Existenz, die sich ihm als künftigem Bewohner einer übers Latein integrierten universalen Bildungswelt bieten würde. In Karl Philipp Moritz’ Roman (1785) fungiert das Kulturelle als ein ›Gelobtes Land‹ für jene, die in der höfischen Gesellschaft als Dritter Stand für subalterne Funktionen vorgesehen sind. Es wird zum Medium der Ausarbeitung einer neuen Welt- und Lebensauffassung, die den bürgerlichen Gruppen das Bewusstsein ihrer spezifischen Differenz verleiht. Während jedoch in Deutschland die Kompetenz im Kulturellen, die Leistungen in Philosophie und Musik, »mit dem Mangel der gesellschaftlichen Entwicklung […] auf das genaueste zusammenhängt« (Plessner 1959/1988, 14)8, wird sie in Frankreich zur Triebkraft der politischen Emanzipation des Dritten Standes. Wenn Marie-Antoinette am Vorabend der Revolution gar die »comédie poissarde« zu schätzen beginnt (Larthomas 1989, 33), so ist das weder eine nur individuelle Geschmacksverirrung, noch gar der Hinweis auf die Dekadenz eines ganzen Standes. Die Fischverkäuferinnen, die der Gattung den Namen geben, sind zwar nicht die dominierende stilbildende Kraft, aber ›die Stadt‹ hat die Blickrichtung auf den Hof aufgegeben und verfügt über eigene kulturelle Muster, die auf andere Gruppen ausstrahlen. Das Kräftegleichgewicht zwischen ›la cour et la ville‹, auf das die Monarchie ihre Stabilität gründete, hat sich im Laufe des Jahrhunderts zugunsten der Stadt verschoben. Das Theater ist eines der Felder, auf denen dieser Prozess kultureller Hegemoniebildung gestaltet wird.
Die spanische Entwicklung wiederum lehrt, dass populare kulturelle Formen, etwa der »majismo«, zwar stilbildende Kraft gewinnen, indem sie von der aristokratisch-aufgeklärten Schicht nachgeahmt werden, doch bleibt diese zugleich dem französischen Vorbild verpflichtet. Der »petimetre«, der nur am ästhetischen Ausdruck des plebejischen majo interessiert ist, wird den »petit-maître« nicht los. Umgekehrt geht der vor allem wegen seiner »carga erótica« (Martín Gaite 1987, 302) geschätzte »majismo« mit Bildungs- und Frauenverachtung einher. Er lässt sich in jene ›nationale‹ Kraft einschmelzen, die Napoleon vertreibt. Aber abgespalten von der Aufklärung, die den mit dem Besatzer gemeinsame Sache machenden ›afrancesados‹ überlassen bleibt, handelt das Volk reaktionär. »Auf der einen Seite standen die Afrancesados […], und auf der anderen stand die Nation.« (Marx, MEW 10, 444)9 In Spanien kann die klassische Entmischung von Komischem und Tragischem nicht Fuß fassen. Das neoklassische Theater, das mit dem Dynastiewechsel zu den Bourbonen den französischen kulturellen Einfluss repräsentiert, vermag das Publikum, das an rasche Ortswechsel und phantastische Handlungsumschwünge gewöhnt ist, nicht zu überzeugen. Aber den ästhetischen Formen kommt nicht per se ein fortschrittliches oder reaktionäres Wesen zu. Wie die Tragödien Voltaires empfänglich sind für die Sache der Aufklärung, so auch die ›reißerischen‹ Stücke eines Comella, die dem klassischen Geschmack ein Greuel sind. Die neuen »zivilen Helden«, die die alten Subjekttypen des Conquistador und Mönch ebenso in Frage stellen wie den plebejischen Typ des Majo, werden auf beiden Seiten des ästhetischen Gegensatzes zwischen Regelpoetik und ›regelloser‹ popular-nationaler Tradition hervorgebracht: Ihr sozialer Ort ist die »clase media«, deren Konturen sich im patriotischen Pulverdampf des nationalen Befreiungskrieges gegen die französische Besatzung alsbald wieder verlieren.
IV
Die Berliner Volksbühne hat im Januar 2005 zu einem Ein-Euro-Abend eingeladen. Ein bei jungen Leuten beliebter Radiomoderator teilte dem zahlreich erschienenen Publikum mit, das Theater könne der neuen sozialen Wirklichkeit nur beikommen, indem die Zuschauer selbst aktiv werden: Für eine Stunde Warten vor leerer Bühne wurde an der Kasse ein Euro ausbezahlt, der anschließend bei einer »sozialkritischen Diskothek« in Bier angelegt werden konnte. Die große Mehrheit blieb sitzen. War es »Willfährigkeit gegenüber neoliberalen Zumutungen«, oder war es die »Bedeutungsmaschine Theater, die denen, die sich ihr ausliefern, auch dann noch Sinn spendet, wenn sie gar nichts eigenes produziert«, fragte Mark Siemons und verstand das Ereignis als Experiment auf die »Macht des Kunstversprechens über die Seelen« (FAZ, 22.1.2005, 33). Wäre es so, müsste man annehmen, dass das sinnverstehende Zuschauen auch dann noch funktioniert, wenn es gar nichts zu sehen gibt. Was den Ort als Theater definiert, ist eben die materielle Anordnung von Bühne und Zuschauerraum, die nicht dadurch zu suspendieren ist, dass die Bühne leer bleibt. Die Veranstaltung hatte ausschließlich performativen Charakter, d. h. sie war mit dem Vorgang selbst identisch, der die Zuschauer in sich hineinnimmt. Aber auch wenn kein Text zur Aufführung kommt, heißt das nicht, dass die soziale Situation, in die sich die Zuschauer – wenn auch nur als symbolisch Handelnde – versetzt sehen, nicht allererst ›verstanden‹ werden müsste. Das heißt auch: das Zeug hat, sie zu ›Verstehenden‹ zu machen. Die Auszahlung eines Euros am Ende der Performance rückte den Un/Sinn einer Gesellschaft ins Bewusstsein, die solche Veranstaltungen nötig hat.
Was Fischer-Lichte als das Neue beschreibt, das einzig durch eine »Ästhetik des Performativen« adäquat zu verstehen sei, beherrscht das Theater bis zu dem Moment, da die Literarisierung die Aufführung erreicht und diejenige Rezeptionsform verallgemeinert, die das Zuschauen zur sinnverstehenden Aktivität macht. Solange das Theater selbst ein Ereignis war, bei dem der zur Aufführung kommende Text, mithin sein literarischer Anteil weder von der Seite der Schauspieler (die lieber improvisierten als eine Rolle auswendig lernten) noch von der der Zuschauer im Mittelpunkt stand, galt auch hier, was Fischer-Lichte für die moderne Performanz-Kunst konstatiert, dass »der Körper- bzw. Materialstatus den Signifikantenstatus« überlagerte (2004, 24). Wenn Performance- und Aktionskunst seit den 1960er Jahren als das unerhörte Neue erscheinen können, so deshalb, weil das Dispositiv des literarischen Theaters – trotz der immer wieder vorgetragenen Angriffe seit Beginn des 20. Jahrhunderts – Theatralität auf die mit ihm selbst unauflöslich verbundenen Erscheinungsformen festlegte und alle übrigen Formen als defizitär, illegitim, seinen hochkulturellen Anspruch verfehlend abqualifizierte. Die »Ästhetik des Performativen« geht gewissermaßen den Weg zurück vom literarischen Theater zum Theater als Ereignis, dem keine von seinem ›Schöpfer‹ unabhängige Existenz zukommt und in dem das Gezeigte sich im Vorgang des Zeigens selbst verzehrt. Die Trennung von Schauspielern und Zuschauern, die das literarische Theater voraussetzt, um die Zeichenhaftigkeit der auf der Bühne dargestellten Welt entziffern zu können, wird überflüssig, wo die körperliche Präsenz der Akteure dem Zuschauer auf den Leib rückt und weniger ein ›Verstehen‹ als ein ›Erfahren‹ provoziert (vgl. ebd., 19). Die Ästhetik des Performativen trägt die Elemente zusammen, die seit 150 Jahren unter der Dominanz des literarischen Theaters zu einer Randexistenz verurteilt waren. Es ist, als hätten sich Schauspieler und Zuschauer nach so langer Zeit der Trennung durch die ›vierte Wand‹ allererst ihrer wechselseitigen Präsenz wieder versichern müssen. Der »Performativierungsschub« (Fischer-Lichte 2004, 25), den das Theater – aber auch musikalische Aufführungen oder Lesungen – seit den 1960er Jahren erfuhr, etwa in Handkes Publikumsbeschimpfung10, bezeugt dieses Bedürfnis.
Wenn man der traditionellen Literaturgeschichtsschreibung zu Recht vorwerfen konnte, sie reduziere Kulturelles auf Artefakte, die den Sprung in die literarische Existenzform geschafft haben, so tendiert eine Ästhetik des Performativen dazu, überall ›Kunst‹ zu entdecken und Wirklichkeit nur mehr als inszenierte gelten zu lassen. Die Abstraktion des Literarischen setzte ein Gefüge voraus, in dem der Text und damit die Kompetenz, Texte auszulegen, als oberste Instanz institutionalisiert war. Wie sich das Auslegen von Texten nicht außerhalb der Materialität von Institutionen, Praxen und Diskursen bewegt, die ein ›hermeneutisches Dispositiv‹ bilden, in dem sich der ›Sinn‹, d. h. die geschichtliche Geltung einer Aussage oder Auffassung konstituiert, so die Abstraktion des Performativen. Die Privilegierung des Ereignishaften, mittels einer englischen Vokabel zum ›event‹ gesteigert, ist unverkennbar Reaktion auf einen Zustand, in dem die real existierende Kluft zwischen Ereignis und Dabeisein immer größer geworden ist, auch wenn (oder gerade weil) die Bilder in Echtzeit übertragen werden und der heimische Bildschirm die Dimensionen einer mittelgroßen Leinwand angenommen hat. Die Figur des befugten Interpreten, der immer neue Texte, Kommentare, Erläuterungen lieferte (vgl. Jehle/Orozco 2004), wird im neuen Paradigma durch den Reporter abgelöst, der mit der Kamera, dem Repräsentanten des Zuschauers, die Welt durchstreift und immer neue Ereignisse liefert.
Die Metaphorisierung des Theater-Begriffs, die ihre Evidenz aus einer »Theatralisierung und Ästhetisierung unserer Lebenswelt« (Fischer-Lichte 2004, 316) bezieht, läuft Gefahr, die inszenierten Wirklichkeiten als »Wiederverzauberung der Welt« (315) zu verklären, in der sich die »›Eigenbedeutung‹ von Mensch und Dingen« enthüllt (325). Wo aber die ›kulturelle Wende der Geisteswissenschaften‹ die Begriffe Herrschaft und Ideologie durch Kultur oder, noch kurzatmiger, durchs ›Ereignis‹ substituiert, statt in der Kultur die Spuren und Modi der Auseinandersetzung um Herrschaft, um Herrschaftssicherung von oben bzw. um die Erweiterung gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit von unten zu entziffern, können die wirklichen Kämpfe, die in einer Gesellschaft ausgetragen werden, nicht in den Blick kommen. Die vorliegende Studie versteht sich dagegen als Beitrag zu einer sozialgeschichtlich fundierten Kulturwissenschaft, die die Herkunft ihrer Maßstäbe aus einer ideologiekritischen Sicht der Gegenwart nicht verleugnet.
V
Ich danke Thomas Barfuss, Ruedi Graf und Manfred Naumann für wertvolle Anregungen und die aufmerksame Lektüre des Typoskripts. Das theoretische Fundament zu dieser Studie ist durch das Projekt Ideologie-Theorie gelegt worden. Wenn sich die Früchte meiner damaligen Bemühungen, eine Studie zur Entstehung des französischen Staatstheaters, die im letzten Band der PIT-Reihe erschienen ist (AS 111, Der innere Staat des Bürgertums, 1986), auch nach Jahren noch als genießbar erwiesen haben, so zeigt das nicht zuletzt, wie viel die neue Arbeit dem alten Projektzusammenhang, insbesondere Wolfgang Fritz Haug und Jan Rehmann, verdankt.
Teil I
Frankreich
1 Die Eroberung des Theaters durch die Literatur
Einer Zeit, in der eine global organisierte Illusionsindustrie ihre Bilder vom besseren Leben bis in die Wellblechhütten ohne Wasser-, aber mit Fernsehanschluss sendet, muss das Theater des 18. Jahrhunderts als ein lächerlich mangelhaftes Produkt zur Befriedigung der Schaulust erscheinen. Mehrere Hundert im Parterre frei umherschweifende, ausschließlich männliche Zuschauer, die der Bühne nicht selten den Rücken zukehren, weil hinten im Saal gerade das interessantere Schauspiel stattfindet; Sitzplätze auf der Bühne, dem Lieblingsaufenthalt eingebildeter »petits-maîtres«, die alles tun, um sich selbst in Szene zu setzen; die rechteckige Form des Saales, die denjenigen Logenbesuchern, die tatsächlich das Bühnengeschehen verfolgen wollen, einen steifen Hals beschert11; schließlich eine Luft zum Schneiden und eine Saalbeleuchtung, die jedes Gesicht in einen Halbschatten taucht, »qui détourne l’attention et impose à chaque individu l’existence de ses voisins« (Lagrave 1972, 417) – wir sind im 18. Jahrhundert noch weit entfernt von jenen Momenten »vollkommener Illusion«, die sich Stendhal gewünscht und auf deren Erlebnis er das »dramatische Vergnügen« beziffert hat.12 Claude-Nicolas Ledoux spricht die Erfahrung eines ganzen Lebens aus: »Nos théâtres […] sont encore dans l’enfance de l’art et laissent beaucoup à désirer« (1804, 222). Die aus langgestreckten Ballspielsälen hervorgegangene Bauweise versagt genau in dem Punkt, auf den es ankommt: »de voir par-tout et d’être bien vu« (222). Es genügt, sich von dem Schauspiel anregen zu lassen, das sich auf den öffentlichen Plätzen bietet: »Traversez la place publique, que voyez-vous? Un charlatan qui attire la curiosité des passants, et les appelle au son des clairons […]. Ses bruyants accords amassent la multitude qui se pelotte en foule autour de lui. On l’entoure de rayons égaux; le plus fort l’approche de plus près; le plus faible est plus éloigné. Toutes les places sont bonnes; toutes tendent à un seul point.« (223) Der Halbkreis, den die Menge um den Marktschreier bildet, ist zugleich die einzige Form, »qui laisse la possibilité de découvrir toutes les scènes du théâtre« (ebd.). Doch vorerst ist das Stehparkett ein »parc moutonnier […] où nos semblables, où l’espèce la moins favorisée de la fortune, est tellement saccadée, comprimée, qu’elle sue le sang; elle répand autour d’elle une vapeur homicide« (219).
Erst wenn der Nachbar zu einem die Wahrnehmung nicht länger tangierenden Moment geschrumpft ist, wenn das Geschehen auf der Bühne allein die Aufmerksamkeit der auf Sitzplätze gebannten Zuschauer zu fesseln vermag, wenn die Beleuchtung ausschließlich dem Bühnenraum gilt und das von den Zuschauern geforderte sinnverstehende Dabeisein unterstützt, wird das Theater zu dem Illusionsraum, der etwas anderes als sich selbst vorstellen kann. Die rezeptive Gestimmtheit der Zuschauer, die Öffnung der Sinne für das von den Schauspielern Gebotene, mithin eine »bereits geformte und empfangsbereite Theateröffentlichkeit«, deren früheste Spuren Erich Auerbach in die 30er Jahre des 17. Jahrhunderts zurückverfolgt hat (1933a, 5), ist nicht zuletzt das Resultat einer Erziehung durch die materiellen Umstände. Ein »höfisch-absolutistisches Kulturprogramm«, auf das Peter Bürger die Institutionalisierung der doctrine classique zurückgeführt hat (1979, 56), wäre als isolierte Aktion einer Kulturpolitik-von-oben zum Scheitern verurteilt gewesen; eine solche konnte nur greifen, wenn sie die Materialität der Theaterverhältnisse in Rechnung stellte und planmäßig in Richtung des sinnverstehenden Zuschauens zu entwickeln suchte. Voltaire war lebhaft bewusst, dass es daran fehlte. Nicht an hervorragenden Stücken, sondern am Vermögen der Schauspieler und an der Einrichtung der Spielorte mangelte es nach seiner Meinung. Allein schon die Zuschauer auf der Bühne genügten, um die poetische Kunst noch der besten Autoren zu Fall zu bringen.13
Es überrascht kaum, dass der Schriftsteller Voltaire den literarischen Anteil am theatralen Ereignis als den einzig gelungenen präsentiert, von dem aus alles andere als defizitär sich darstellt. Schon d’Aubignac konstatierte um die Mitte des 17. Jahrhunderts, dass die Ablehnung des Theaters wegen der mangelhaften Qualität der Stücke für die »Modernes qui ont établi leur estime par beaucoup d’Ouvrages excellents« jeder Grundlage entbehrt (Projet, 701). Die Eroberung des Theaters durch die Literatur ist indes ein langwieriger Prozess, denn noch ein La Harpe konzipierte Theaterkritik als rein literarische Stilübung, die in der Stille des Studierzimmers zu erfolgen hat.14 Sie wagt sich nicht in die Höhle des Löwen, wo eine Stimmung herrscht wie heute bei Fußballspielen (vgl. hierzu Teil II, Kap. 3.1).15 Freilich ist La Harpes Haltung erst in zweiter Linie die Marotte eines gelehrten Pedanten; zunächst ist die literarische Theaterkritik die Folge einer Konstellation, die zwar die Beurteilung von Theaterstücken als eine allein den Gelehrten zukommende literarische Kompetenz zu installieren vermag, das theatrale Ereignis selbst aber noch kaum erreicht. D’Aubignac hat zwar mit seinen Reformvorschlägen vor allem dieses im Blick und tut so, als handelte es sich um ein bloßes »rétablissement«, ein Zurück zu einem früheren Zustand, der noch gekennzeichnet war durch die »soins et […] libéralités de feu Monsieur le Cardinal de Richelieu« (Projet, 698), doch auf den komplexen Zusammenhang, den Schauspieler, Publikum und architektonische Anlage bilden, in dem das Theater Ereignis wird, vermögen sie kaum einzuwirken. Obwohl seine Pratique du Théâtre, wie der Titel anzeigt, schon unverkennbar mit diesem Anspruch auftritt und, über die habituelle Auslegung der aristotelischen Regeln hinausgehend, bereits Elemente einer »Ästhetik des Performativen« (Fischer-Lichte 2004) enthält16, bleibt die Modellierung des Theaters durch die literarische Wertform prekär. Dieser Begriff, der an den der »ideologischen Wertförmigkeit« anschließt17, richtet das Erkenntnisinteresse auf die Rekonstruktion eines gegliederten Ganzen, eines Ensembles unterschiedlicher Instanzen, Praxen und Zuständigkeiten, in dem die vielstimmig und kontrovers betriebene Reform sich materialisiert und worin ihre ›Ideen‹ Kraft gewinnen und zirkulieren. Wenn von ihnen konkrete Regulationen der Theaterverhältnisse abgeleitet werden, so heißt das nicht, dass ›die Ideen‹ herrschen. Ihre Wirksamkeit ist an die Autorität der Instanzen gebunden, von denen aus gesprochen wird. Die wichtigsten Elemente der von d’Aubignac propagierten Reform sind: Vertikalisierung der Kompetenzen durch Einsetzung eines Intendanten; Professionalisierung der Schauspieler; Individualisierung der Zuschauer; Polizierung des Spielortes (Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols); schließlich die Forderung nach einem Neubau »où les sièges des Spectateurs soient distingués, sans que les personnes de condition y soient mêlées avec le menu peuple« (Projet, 705f). Dass es auf diese Entmischung von Vornehmen und ›kleinen Leuten‹ überhaupt ankommt, erweist die Hartnäckigkeit, mit der sich das Theater als Element der Popularkultur behaupten kann, aber umgekehrt auch keine Kraft findet, auf die ›Nation‹ auszustrahlen und, mit Gramsci zu sprechen, »popular-national« zu werden.
Die vertikale Struktur, die sich zwischen Lehre und Aufführung konstituiert und die der doctrine classique und ihren gelehrten Adepten den Resonanzraum sichert, besteht im 18. Jahrhundert fort.18 Zwar kann sich die 1637 gegründete Académie Française in der Querelle du Cid als Ordnungsmacht im Kulturellen präsentieren, aber das gilt nur für dessen schmale literarische Zone, die in den Werken der Literarhistoriker meist allein ausgeleuchtet und mit ›dem Kulturellen‹ schlechthin verwechselt wird. Mehr noch: Es ist genau die Trennung vom Theater als Ereignis, die der doctrine classique die Definitionsmacht über den obersten literarischen Wert einräumt. Mit ihrer Vorherrschaft geht es zu Ende, sobald der literarische Anspruch ›popular‹ wird, d. h. sich mit dem wirklichen Theater verbindet. Daher die paradigmatische Bedeutung des drame bourgeois, mit dem nicht nur eine literarische Form entsteht, in der das Bürgertum seine Welt- und Lebensauffassung erproben kann, sondern mit dem sich erstmals eine umfangreichere Reflexion über Schauspielkunst, Dekoration, Kostümierung usw. verbindet. Indem, wie bei Diderot, die genuin theatralen Anteile entwickelt werden, erweist sich der immer wieder neu ansetzende Kommentar der aristotelischen Regeln als ein verknöcherter Ritus, der kein Gemeinsames mehr zu stiften vermag. Wenn Félix Gaiffe an den Theoretikern des bürgerlichen Dramas kein gutes Haar lässt, um allein die Überlegungen zur szenischen Gestaltung als Pluspunkt zu buchen19, so verkennt er, dass eben damit das materielle Dispositiv des klassizistischen Theaters insgesamt revolutioniert wird: Theater wird als theatrales Ereignis entwickelt, ohne den Anspruch auf eine neue Form der höheren (literarischen) Kultur aufzugeben. Was in der klassizistischen Über-/Unterordnungsstruktur auf verschiedene kulturelle Kontinente verteilt war, auf literarische und Popularkultur (deren Hegemonie sich auf den Moment der Aufführung beschränkte)20, wird jetzt zusammengebracht und resultiert in einer szenischen Neuerfindung des Theaters, die die literarische Wertform für ihre Sache, d. h. die Sache der »Nation« mobilisiert. Nicht nur wird die Ständeklausel durchbrochen und ist der Bürger keine bloß komische Figur mehr21, auch in der Art und Weise, wie er auftritt und spricht22, wie sein In-der-Welt-Sein zur Darstellung gebracht wird, steckt ein revolutionäres Moment. »Pflegen die Prinzen und Könige wohl anders zu gehen, als sonst ein Mensch, der gut geht? Gestikulieren sie wohl jemals wie Besessene und Rasende?«, fragt die Favoritin, Diderots Alter Ego in Les bijoux indiscrets (38. Kap., zit. n. Lessing, HD 85). Dieselbe Forderung nach ›Natürlichkeit‹, die die Physiokraten die Vorzüge des Ackerbaus vor aller gewerblichen Luxusproduktion rühmen lässt, verweist den Deklamierstil auf der Bühne unter die überlebten Gestalten höfischer Kultur.