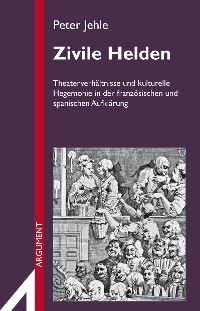Kitabı oku: «Zivile Helden», sayfa 3
1.1 Die moralische Ökonomie des öffentlichen Platzes
In London, das zur Zeit Shakespeares etwa 160 000 Einwohner hatte, traten bisweilen fünf Gruppen gleichzeitig auf, mit rasch wechselndem Programm. Man spielte bei Tageslicht, unter freiem Himmel. Einzelne Theater fassten, wie in Madrid, 2000 Zuschauer. In der Theatersaison 1605 suchten wöchentlich etwa 21 000 Londoner die Theater auf. »In Scharen mussten sie über die Themse nach Bankside übersetzen und nach den Finsbury-Feldern pilgern, denn die puritanisch gesinnten, theaterfeindlichen Stadtbehörden duldeten […] kein öffentliches Schauspielhaus im Stadtinnern.« (Weimann 1964, 194) Die Blüte des Theaters, der die Puritaner 1642 ein Ende bereiten, verdanke sich einer »vorkapitalistischen Ökonomie und Lebensweise« (195). Seine Besucher waren noch nicht »Opfer industrieller Arbeitsintensität und abstumpfender Arbeitsteilung«; noch keine »innerweltliche Askese« habe den Sinn für folk-drama, Maispiele und Schwertertanz verhunzt. Auch wenn Weimanns Blick auf das Theater Shakespeares durch einen romantischen Antikapitalismus getrübt ist, der die Ausbeutung der Arbeitskraft allein auf Seiten des Industriesystems wahrnimmt, als habe es in den vorindustriellen Verhältnissen keine gegeben, so ist doch der Versuch triftig, das Anderssein dieses Theaters durch seine Verwurzelung in der Tradition des Volkstheaters zu erklären. »Hofmann und Handwerker, Lehrling und Student, Kaufmann und Edelmann« (196) trafen sich ungeachtet des Abstandes, der sie im wirklichen Leben trennte.
Zwar ist auch in Paris das öffentliche Theater bereits seit Beginn des 17. Jahrhunderts zu einer dauerhaften Einrichtung geworden, aber ein fester Spielort allein garantiert nicht automatisch ein sicheres Auskommen. Das Hôtel de Bourgogne, das erste ständige Theater in Paris, musste an durchziehende Wandertruppen vermietet werden, bevor sich hier ab 1629 eine Truppe festsetzen konnte. Die Schwierigkeiten, sesshaft zu werden, hängen unter anderem damit zusammen, dass das öffentliche Theater noch kaum auf ein festes »Publikum« an einem Ort zählen kann. Es ist daher das Theater, das zu den Leuten kommen muss; die Schauspieler gehen an die Orte, wo viele zusammenkommen. Entsprechend ist Theater noch kaum ein ›autonomes‹ Ereignis: »la représentation […] est une manifestation collective de la vie de la cité, à laquelle tous participent« (Descotes 1964, 25). Die Schauspieler begleiten die Anlässe, zu denen die Straßen und Plätze von der Volksmenge in Besitz genommen werden: die kirchlichen Festtage, den Karneval sowie die Jahrmärkte und Messen, in denen der frühkapitalistische Waren- und Nachrichtenverkehr einen seiner Knotenpunkte hat. Während die Amateure der verschiedenen Bruderschaften (confréries) ihre Kunst ausschließlich im Rahmen der Liturgie oder der Feste ausüben, die sie mit ihren Späßen begleiten, gewinne der »Schauspieler« erst mit den zentralisierten Monarchien eine ›autonome‹ gesellschaftliche Funktion, unabhängig von den Anlässen des Alltagslebens (vgl. Duvignaud 1973, 44f). Die Priester selbst behalten sich die Rolle Jesu vor23, während die Spaßmacher und ›Narren‹, zumal die am Hof, zwar auf Dauer an ihre Funktion gebunden sind, diese ihnen jedoch kaum Spielraum lässt. Als eine Art »confesseur laïc« des Königs ist der Narr verpflichtet, diesem ein gutes Gewissen zu verschaffen (ebd., 48).
In Paris kann man einen Teil des Jahres auf der Messe verbringen. Die Foire Saint-Germain dauert in der Regel zwei Monate und beginnt am 3. Februar, zur Zeit des Karnevals; die Foire Saint-Laurent dauert etwa gleich lang und endet gewöhnlich am 29. September (vgl. Lagrave 1972, 32). Der ökonomische Kontext des Warenaustauschs findet sich wieder in Ausdrücken, die uns heute vor allem in Bezug auf das Theater geläufig sind: So heißt der Platz, wo sich die Kaufleute zum Geschäftsabschluss versammeln, »la Loge« (von ital. loggia); in den Niederlanden nennt man ihn »Börse« – nach der Patrizierfamilie van der Burse, die in ihrem Wappen drei Geldbeutel führte (ter buerse; vgl. Kulischer 1976, II 316). Die Börse macht aus der periodisch stattfindenden die »ewige, immerwährende Messe« (ebd., 314). Die Loge ist der den Kaufleuten speziell vorbehaltene Platz, der für die Dauer der Versammlungen abgesperrt wird, bevor man, in Lyon 1653, in ein eigenständiges Börsengebäude umzieht (ebd., 315). Und auch innerhalb des Theatergebäudes formieren die über einen separaten Eingang erreichbaren Logen – oft dauerhaft vermietet und abschließbar – eine Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit. Sie trennen die ›bessere‹ Gesellschaft von der im Parterre sich tummelnden Menge. Im Theater wie an der Börse ist das Tragen von Waffen verboten.
Der Reichtum, den der Warenaustausch den Kaufleuten verschafft, geht mit dem Elend der Vielen einher. Die Schauspieler unterscheiden sich kaum von den Zauberkünstlern, Kraftmenschen, Akrobaten, Jongleuren, Arzneiverkäufern und Zahnausreißern, kurz, all denen, die ihre besonderen Fähigkeiten oder Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen suchen. So wie die Schauspieler oft gezwungen sind, sich als Pillendreher und Verkäufer sonstiger Medizin durchzuschlagen (vgl. Mongrédien 1966, 26), so agieren die Zauberkünstler und Kraftmenschen zugleich als »Schauspieler«. Als der junge Jean-Baptiste Poquelin seine Tätigkeit als Anwalt nach kurzer Zeit abbrach, sich um 1642 endgültig dem Theater zuwandte und der Vater ihm jede Unterstützung entzog, nahm er eine Beschäftigung bei dem »opérateur« Barry an, dessen Elixiere er auf öffentlichen Plätzen schluckte, um vor einer staunenden Menge ihre Wirksamkeit unter Beweis zu stellen (vgl. Adam III, 210). Dieser arme »mangeur de vipères« – wie ihn die Gebrüder Béjart nannten –, der spätere Molière, kannte also das unsichere Los der Schausteller, als er – nach langen Wanderjahren in der Provinz – der Protektion des jungen Ludwig teilhaftig wurde und sich in Paris, gegen die Konkurrenz der anderen Truppen, festsetzen konnte.24
Schauspielerische Qualitäten sind nötig, wo immer es darum geht, Bekanntschaften zu machen, um ein karges Auskommen zu finden. »Tous les acteurs qui jouent leur rôle sur ce grand et mobile théâtre [Paris] vous forcent à devenir acteur vous-même.« (Mercier, Tableau, 147) Die Schausteller auf den Jahrmärkten, die gegen eine zahlreiche Konkurrenz die Aufmerksamkeit der Passanten erregen müssen, um ihnen etwas zu verkaufen, das sie nicht brauchen, bewegen sich in der Nachbarschaft der Vielen, die der endemischen Arbeitslosigkeit auf dem Land zu entkommen und auf der Straße ihren Lebensunterhalt zu finden suchen. Es herrscht hier eine »poétique« eigener Art (Farge 1992, 21), in der »les va-et-vient incessants de la foule, le bruit assourdissant, la saleté malodorante et la brutalité« (16) eine unentwirrbare Gemengelage bilden. Wie der Zuschauersaal im Theater ein gegliedertes Ganzes unterschiedlicher Räume darstellt, die nicht allen zugänglich sind, so die Stadt, in der der »canaille« der Zugang etwa zum Jardin des Tuileries, der den Reichen und Schönen vorbehalten ist, verschlossen bleibt (vgl. ebd., 71). Hingegen beherrscht sie die »cabarets«, d. h. die Kneipen, »prolongement évident du boulevard […], espace à la fois clos et ouvert, où se rencontrent ceux qui n’ont pas d’autre endroit pour prendre le plaisir d’être ensemble« (ebd., 73). Das Wirtshaus, dessen Hof nicht selten den Rahmen hergibt, in dem die Bühne für ein paar Tage aufgeschlagen wird, ist zugleich der Durchgangsort par excellence der Wandertruppen. Das Leben auf der Straße und an Orten, an denen dieses seine Fixpunkte hat, ist gekennzeichnet durch eine Gewalt, die unvermutet und jederzeit ausbrechen kann. Sie ist ein »phénomène massif, constant et surprenant par l’intensité de sa brutalité«, kennzeichnend für die kleinen Leute, die ihre Konflikte »sur le champ, à coups de poings, de pieds, ou avec les outils de son travail« austragen (124). Diese populare Form der Gewalt ist selten aktenkundig geworden, da sie sich innerhalb der Stände- und Klassenschranken hielt und nur dort zum Austrag kam, »où se joue un subtil rapport de forces entre les partenaires« (125): zwischen Käufern und Verkäufern, Mietern und Vermietern, Männern und Frauen.
Noch Goethe konfrontiert seinen Wilhelm Meister in Deutschland mit einer den Lebensbedingungen der Straße ähnlichen Situation: »Ist wohl ein kümmerlicheres, unsichereres und mühlseligeres Stückchen Brot in der Welt? Beinahe wäre es eben so gut, es vor den Türen zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen, von der Parteilichkeit des Direktors, von der Übeln Laune des Publikums auszustehen! Wahrhaftig, man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in der Gesellschaft von Affen und Hunden an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Pöbel zu tanzen.« (Sendung, 2. Buch, 7. Kap.)25 Mit Wilhelm Meister präsentiert Goethe, bezogen auf die deutschen Verhältnisse, die Gestalt, die eine Perspektive der Befreiung des Theaters aus der Nachbarschaft von »Affen und Hunden« entwickeln und den Schauspieler mit der zivilen Welt vereinbar zeigen kann. Aber hier wie im 17. und 18. Jahrhundert in Frankreich wird es nur wenigen gelingen, sich in die »gute« Gesellschaft hinaufzuarbeiten.
Inmitten der alltäglichen Notwendigkeiten des Sich-Durchschlagens finden wir auf den öffentlichen Plätzen zugleich die Elemente einer popularen Gegenordnung zu dem Block aus Reichtum, Macht und Privilegien. Seit Bachtins grundlegender Untersuchung über Rabelais und die Volkskultur im 16. Jahrhundert wissen wir, dass die öffentlichen Plätze in der »moralischen Ökonomie« des Volkes, d. h. in dessen »fest umrissenen und leidenschaftlich vertretenen Vorstellungen vom Gemeinwohl« (Thompson 1980, 70), eine besondere Rolle spielen: »La place publique était le point de convergence de tout ce qui n’était pas officiel, elle jouissait en quelque sorte d’un droit ›d’exterritorialité‹ dans le monde de l’ordre et de l’idéologie officiels, et le peuple y avait toujours le dernier mot.« (Bachtin 1970, 156) Mercier, 350 Jahre nach Rabelais, klärt uns freilich darüber auf, dass gerade während des Karnevals die Polizei ein Heer »informeller Mitarbeiter« unterhielt, die im Faubourg Saint-Antoine eine »allégresse publique, fausse et mensongère« entfachten (Tableau, 298).
Der Gedanke der Exterritorialität verweist darauf, dass die ideologischen Mächte, Kirche und Staat, aber auch die repressiven Mächte, Polizei und Armee, nicht überall und zu jeder Zeit gleichermaßen präsent sind. Welche Territorien von wem besetzt gehalten werden, steht nicht fest. An vielen Festtagen ziehen sich Staat und Kirche aus ›ihren‹ Stellungen zurück und überlassen die Herrschaft dem ›verrückt‹ gewordenen Volk und seinen Repräsentanten, den Narrenkönigen und -bischöfen. Umgekehrt werden die öffentlichen Plätze zur Inszenierung staatlicher Herrschaft genutzt, etwa bei Hinrichtungen, bei denen es sich um ein Ritual handelt »pour reconstituer la souveraineté un instant blessé« (Foucault 1975, 52). Das Volkstheater der öffentlichen Plätze hat sein Gegenstück im »Theater des Schreckens« (van Dülmen 1985). Was aber als gerecht zu gelten hat, bleibt der Obrigkeit nicht kampflos überlassen. Die im Volk lebendigen Rechtsvorstellungen können in Widerspruch geraten zur Strafpraxis der Obrigkeit. Das Militär vermag den Scharfrichter vor der aufgebrachten Menge nicht immer zu schützen: das Volk kann den Delinquenten unter Umständen selbst zur Strecke bringen und so seine Kompetenzen ›überschreiten‹, indem es sich mit den von der Obrigkeit ihm zugestandenen Anteil – dem Beschimpfen, Verhöhnen und Bespucken des Opfers – nicht zufrieden gibt. Es geht nicht nur darum, den Verbrecher an einer Flucht zu hindern, auch das Volk muss daran gehindert werden, den Verurteilten zu retten oder ihn selbst zu töten.26 Entscheidend ist, dass das Volk nur zuschaut. Aber selbst dann, wenn der öffentliche Platz zur Inszenierung des staatlichen Schreckenstheaters dient, ist nicht von vornherein entschieden, wer das letzte Wort haben wird.
Die öffentlichen Plätze sind strategische Orte der Hegemoniebildung – ein Aspekt, der bei Bachtin unterbelichtet bleibt, weil er die populare hegemoniale Gegenordnung weniger als einen Prozess im Handgemenge mit dem Gegner denn als fertigen Ausgangspunkt im Blick hat. Die Orte, an denen etwa die Jahrmärkte stattfinden, sind nicht nur Schauplatz einer karnevalesken Gegenordnung, sondern zugleich ein Karneval des Kommerzes.27 Immer wieder werden Jahrmärkte verboten oder in ihrer Dauer beschnitten, vor allem wenn die Obrigkeit den Eindruck hat, dass die kommerziellen Aktivitäten gegenüber den Volksbelustigungen wie etwa dem Marionettentheater, in dem kein Blatt vor den Mund genommen wird, ins Hintertreffen geraten (vgl. Starsmore 1975, 13). Indem das Volk dem von der Staatsmacht inszenierten Schreckenstheater beiwohnt, wird es an der Strafverfolgung, die in der Hand des Souveräns konzentriert ist, imaginär beteiligt. Die ›Wiederherstellung‹ der Ordnung wird ihm bildhaft vor Augen geführt. Aber wie bei allen ideologischen, auf die Beteiligung und Aktivierung der Subjekte setzenden Einbindungsstrategien, kann es zu einer Dynamik kommen, welche die Schranken durchbricht: Ob der Verbrecher gerettet oder durch das Volk selbst hingerichtet wird – in beiden Fällen wird die Auslagerung der Strafverfolgungskompetenz aus dem Gemeinwesen eingezogen und von unten wieder angeeignet.
Freilich stellt solche Aneignung das Gesellschaftssystem selbst nicht in Frage. Was hier als Volk den Ton angibt, entspricht weitgehend dem, was Hobsbawm als Verhaltensweisen des »Mob« – der ›kleinen Leute‹, ›menu peuple‹, ›popolo minuto‹ – in den vorindustriellen Großstädten analysiert hat, insbesondere denjenigen, die von einer höfischen Residenz lebten oder von einem Fürsten regiert wurden. Hier fand der »volkstümliche Legitimismus« (1959/1979, 158) den geeigneten Nährboden. Der Herrscher konnte mit enthusiastischer Gefolgschaft rechnen, wenn sein Handeln ›gerecht‹ war, d. h. wenn er den kleinen Leuten, die mit Gelegenheitsarbeiten eine prekäre Existenz bestreiten mussten, ein Auskommen sicherte. Daher das »merkwürdige Verhältnis« zum Herrscher, »das gleichermaßen von Parasitismus wie von Aufständen bestimmt war« (153). Die Zerlumpten und Elenden, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Paläste ihr Leben fristeten, sahen im Glanz der Reichen durchaus keinen Grund für ihre Misere. Wenn fürs Existenzminimum gesorgt war, war alles in Ordnung. Der Aufstand dient dazu, das gestörte symbiotische Verhältnis wieder ins Lot zu bringen; man verlangt einen König, der seine Pflicht tut, so wie der popolo minuto von Neapel von seinem Heiligen verlangt, dass er ihn unterstützt. Die Aspirationen des kleinen Mannes sind nicht darauf gerichtet, »die Bedürfnisse und die Erfordernisse produktiver Klassen zu befriedigen« (Gramsci, Gef 9, H. 22, § 2, 2065). Mit der Dialektik von Aufstand und Parasitismus, Enthusiasmus der Kritik und Enthusiasmus der Zustimmung ist es erst vorbei, wenn mit dem Aufstieg des Bürgertums und der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, die den ›Tagedieb‹ in den Verkäufer seiner Arbeitskraft verwandeln, eine neue, ›politische‹ Strategie gelernt werden muss: Die modernen Arbeiterbewegungen treten an mit der Überzeugung, dass allein Organisation und Solidarität28 die Lebensverhältnisse nachhaltig und dauerhaft verbessern können.
Aus der komplementären Zuordnung von Alltag und Fest holt die Obrigkeit einen Teil des ideologischen Zements, der ihre Herrschaft sichert: Die Eroberung der Staatsmacht von unten ist in die zeitlichen Schranken der Narrenherrschaft verschoben; die Verrücktheit des Volkes, die imaginäre Entmachtung der Herren, wird zu einem Stützpunkt ihrer Führung. Dennoch sind alle diese zeitlich begrenzten und verschobenen Formen der Wiederaneignung von Vergesellschaftungskompetenzen umkämpft. Sie können, in einer Situation sozialer Notlage, zu Kristallisationspunkten von Widerstand werden. Schlechte Ernten hatten die Bauern und die städtischen Handwerker von Romans 1580 dazu gebracht, die Entrichtung des Zehnten und der taille zu verweigern, die besonders verhasst war, weil der Grundherr sie nach freiem Ermessen bestimmen konnte (vgl. Kulischer I/121). Sie bewaffneten sich und warfen die Grundbücher ins Feuer. Der Karneval wird in diesem Kontext zum Widerstand gegen die Obrigkeit: Paumier, der Anführer der Aufständischen, saß »mit einem Bärenfell bekleidet im Sessel des Bürgermeisters und verzehrte Delikatessen« (Kamen 1982, 133). In dem Bild sind die Überwindung des Hungers und die Ablehnung der schlechten Obrigkeit, die ihrer Pflicht gegenüber den kleinen Leuten nicht nachkommt, miteinander verdichtet. Am Vorabend des Fastnachtsdienstages werden die Führer der Aufständischen und ein Großteil ihrer Gefolgschaft massakriert. Der Alltag repressiver Herrschaftssicherung setzt dem kurzen Sonntag der Anarchie ein jähes Ende.
Am Beispiel von Hungerrevolten im 18. Jahrhundert in England hat Thompson gezeigt, dass es sich hier nicht nur um blinde Reaktionen, einen tumultartigen Aufstand handelt, der die Wiederherstellung der Ordnung von oben erwartet. Es geht auch um die Wiederaneignung der den kleinen Leuten entzogenen Kompetenzen, etwa derjenigen der Preisfestsetzung. Die Proteste »bewegten sich im Rahmen eines volkstümlichen Konsenses darüber, was auf dem Markt, in der Mühle, in der Backstube usf. legitim und was illegitim sei« (Thompson 1980, 69). Im Kern ging es, worauf auch Hobsbawm hinweist, um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Die Spitzenwirker in Horniton, »die 1766, nachdem sie den Farmern das Korn weggenommen und zu einem volkstümlichen Preis auf dem Markt verkauft hatten«, brachten »diesen nicht nur das Geld, sondern auch die Säcke zurück« (ebd., 103). Was gerecht ist, wird nicht nur mit Worten gefordert, sondern praktisch vorgeführt. Die Aufständischen inkarnieren eine Welt, in der die Preise gerecht sind und alle ihr Auskommen finden. Im Moment des Aufstands wird die Utopie Wirklichkeit.
Das Theater der Wandertruppen ist eine Einrichtung, in der die imaginäre Herrschaft des Volkes zur Zeit des Karnevals oder des Aufstands übers Jahr hinweg erinnert wird. Seine zentrale Gestalt ist deshalb der Narr, der zu seinem »eisernen Bestand« gehört (Weimann 1967, 48). Er konzentriert in sich die Situation der verkehrten Welt, in der alle zu Narren werden. »Les spectateurs n’assistent pas au carnaval, ils le vivent« (Bachtin 1970, 15). Unter Bedingungen der alltäglichen Ausbeutung und Erniedrigung führt der Narr, wie alle die plebejischen Helden von Eulenspiegel bis Schwejk, »die Kunst des Überlebens« vor (Haug 1973, 69). Seine Fähigkeit, die Reaktionen der um die Bühne versammelten Menge spontan aufzunehmen und in sein Spiel einzubauen, bewirkt eine besondere Nähe von Schauspielern und Zuschauern. Seine unverhüllte Fresslust ist ein Angriff auf die Zufriedenheit der Satten, seine Feigheit ein Angriff auf die Moral der Aristokraten (vgl. Weimann 1967, 51).
Der Narr heißt im Französischen »le fou«, der »Verrückte«. Er ist vom Standpunkt der etablierten Ordnung ein gefährlicher Verrückter, weil es doch ›verrückt‹ wäre, wenn sich die Verhältnisse ändern ließen. Er bringt die Menge zum Lachen – keinem isolierten Lachen, sondern einem »rire de fête«, einem »rire général«, das alle ansteckt, die Lachenden selbst eingeschlossen: »le monde entier paraît comique« (Bachtin 1970, 20). Die Wirkung dieses Lachens hat Bachtin als »rabaissement«, als eine symbolische Form der Wiederaneignung des entfremdeten Gemeinwesens beschrieben (37). Es befreie nicht nur von der »censure extérieure, mais avant tout du grand censeur intérieur, de la peur du sacré, de l’interdit autoritaire, du passé, du pouvoir, peur ancrée dans l’esprit de l’homme depuis des miliers d’années« (101). Bachtin bezieht seine Aussagen auf die Renaissance, vor allem auf Rabelais, von dem Auerbach sagt, es gebe bei ihm kein »ästhetisches Maß«, alles vertrage sich mit allem, »der gröbste Schwank ist angefüllt mit Gelehrsamkeit, und philosophisch-moralische Erleuchtung quillt aus obszönen Worten und Geschichten« (1946, 265). Die Gelehrsamkeit, die sich in solcher ›Stilmischung‹ den Spiegel vorhalten lassen musste – Auerbach weist darauf hin, dass Gargantua und Pantagruel für Lesende, also Gebildete bestimmt waren –, wird sich aus dieser Nachbarschaft befreien, ähnlich wie der Schauspieler, der den Possenreißer neben sich nicht mehr erträgt. Der Narr als Organisator solch unbändigen Lachens ist mit dem sich entwickelnden literarischen Theater nicht vereinbar; er wird, wie rund 100 Jahre später sein deutscher Bruder Hanswurst, von der Bühne vertrieben.
Unter welchen Bedingungen letzterer im bürgerlichen Theater wieder verwertbar wird, zeigt ein Blick auf Justus Mösers Konstruktion des »Grotesk-Komischen«, in dessen Reich Harlekin – gegen die »Herren Gelehrten«, die »nach Gründen« ausrechnen, ob seine Vorstellungen »gefallen können« (1761/1968, 10) – das Zepter führt. In Frontstellung gegen seinen plebejischen Verwandten, »Hanß Wurst« – der »nie von meiner Familie gewesen« (28) –, beansprucht der mösersche Harlekin eine staatstragende Funktion: In seiner »komischen Republik« will er das Amt eines »Controlleurs der Sitten« (27) bekleiden, indem er dasjenige, »was man in der Malerey Karikatur nennt, und welches in einer Übertreibung der Gestalten besteht« (21), auf die Bühne transponiert. Wer von der Großmacht des Schönen geduldet sein will, muss bescheiden auftreten: Wie die »groteske Malerey an keinem Hauptgebäude leicht Platz findet«, so verlange auch er nur ein »Nebenzimmer auf der Bühne« (24), ohne den akkreditierten Kunstformen – er nennt Oper, Trauerspiel, die »eigentliche Komödie«, das rührende Lustspiel (11) – den ihnen gebührenden Platz zu bestreiten. Doch indem er sich als einen »nothwendigen und angenehmen Bürger« (12) vorstellt, schreibt er dem »Grotesk-Komischen« einen legitimen ästhetischen Status zu. Einmal ausgestattet mit den niederen Weihen, ›durchläuft‹ das Grotesk-Komische die verschiedenen Abteilungen im Reich des Schönen und wird im wörtlichen Sinne zum ›Diskurs‹. So kann der Literaturhistoriker Friedrich Karl Flögel zwanzig Jahre später bereits eine »Geschichte des Grotesk-Komischen« (1788/1862) bieten, in die alles eingemeindet wird, was die dem ›guten Geschmack‹ abgewandte Seite der Geschichte hervorgebracht hat und sich vorderhand nur aus sicherem Abstand – wie Raubtiere hinter Gittern – betrachten lässt.