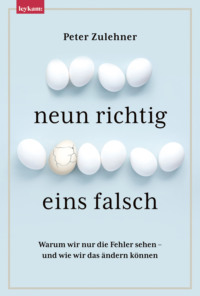Kitabı oku: «Neun richtig, eins falsch.», sayfa 3
FAZIT: WIR KENNEN ES NICHT ANDERS
Unsere Verhaltensmuster setzen sich durch ihre permanente Wiederholung fest. Unser Umgang mit richtig oder falsch, der Stellenwert, dem wir positiv oder negativ beimessen und unsere Gewichtung von »Grün« und »Rot« ist erlernt, tief in uns eingeprägt und steuert unsere persönliche Wertewelt. Wir leben und wir führen fort, was wir von klein auf gelernt haben: Wir haben gelernt, dass es im Leben darum geht, auf das Negative zu fokussieren, Falsches auszumerzen, besser werden zu müssen und so wenige Fehler wie möglich zu machen. Der Preis, den wir dafür bezahlen, ist der, dass wir für die positiven Dinge kaum mehr einen Blick und vor allem kein Sensorium mehr haben. Wir kennen es nicht anders, wir sind daran gewöhnt.
Die Gegenspieler eines positiven Miteinanders und wie Sie ihnen mit wirksamen Entstörungsmaßnahmen den Nährboden entziehen
»Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.«
Albert Einstein, deutscher Physiker, 1879 – 1955
Das Gegenteil von einem guten Miteinander ist ein Gegeneinander. Weil es nicht für jeden von uns einen eigenen Planeten mit all den bekannten und gewohnten Annehmlichkeiten gibt, sollte es uns allen ein Anliegen sein, möglichst gut miteinander auskommen. Wir Menschen sind soziale Wesen und von dem Moment an, wenn wir auf die Welt kommen, auf andere angewiesen. Nach der Geburt könnten wir allein nicht überleben und wir sind, um uns gesund – sowohl im körperlichen wie auch im psychischen Sinne – entwickeln zu können, auf die Zuwendung anderer Menschen und auf die Lernerfahrungen angewiesen, die uns andere ermöglichen. Dennoch machen wir einander so oft unnötig das Leben schwer. Die zu diesem Zweck ausgerichteten Praktiken unserer auf das Negative und das Falsche gepolten Mitmenschen haben sich mit zunehmender Zivilisation verfeinert. Herabsetzung, Entwürdigung und Gegeneinander finden vorwiegend nicht mehr mithilfe primitiver Formen von Gewalt statt, sondern wurden und werden zunehmend durch subtilere, psychologische Methoden ersetzt, die alle miteinander die Funktion haben, das eigene Selbst zu schützen, es anzuheben und sich damit über andere zu stellen. Neid ist dabei die häufigste Triebfeder vieler solcher Handlungen.
Mir ist es wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, in wie vielen unserer Lebensbereiche wir durch unseren Fokus auf das Negative mit dem Gegenteil eines guten Miteinanders konfrontiert sind. Ich möchte Ihnen meine eigenen Erfahrungen zur Verfügung stellen und Werkzeuge in die Hand geben, mittels derer Sie sich einfach und gelungen gegen die negative Fokussierung abgrenzen und mit positiv ausgerichteten Verhaltensweisen effizient gegensteuern können. Permanenter Negativität ausgesetzt zu sein, fügt uns Schaden zu. Das Ausmaß des Schadens in Form von Verletzungen ist unterschiedlich hoch: Manchmal sind es kleine Abwertungen in der Gestalt von Unhöflichkeit und Respektlosigkeit, die sich schnell überwinden lassen, aber es gibt auch über Jahre und gar jahrzehntelang andauernd ausgeübte destruktive Handlungen an uns, die auf Dauer unseren Selbstwert zersetzen und uns körperlich und seelisch krank werden lassen. Auch das bewusste Vorenthalten von Lob, Anerkennung oder Wertschätzung kann uns krank machen. Das kann Verbitterung oder Aggression zur Folge haben oder es kann passieren, dass wir eine deutliche Reaktion zeigen und auf diese Weise signalisieren, dass wir mit der Situation unzufrieden sind – wir machen uns unbequem und werden selbst zu Gegenspielern eines guten Miteinanders. Was ich mit dem Sich-Unbequem-Machen meine, zeichne ich für Sie mit einem Bild aus der Kindererziehung nach:
 Der Einjährige und der Fünfjährige sitzen auf der Couch im Wohnzimmer. Der Einjährige hat Geburtstag. Mama, Papa, Onkel, Tante, Opa, Oma: Alle sind da und fokussieren sich auf den Einjährigen. »Wie du lieb lachst«, »Du hast heute Geburtstag, schau was ich dir mitgebracht habe«, »Wie groß du schon bist«, alle möglichen liebevollen Wortmeldungen und Komplimente regnen auf den Kleinen herab. Die gesamte Zuwendung konzentriert sich auf den Einjährigen. Der Fünfjährige fühlt sich zu wenig beachtet und sieht sich zum Handeln gezwungen. Er gibt in einem vermeintlich unbeobachteten Augenblick dem Einjährigen einen Stoß, der natürlich schreit und zu weinen beginnt. Im selben Moment gehört dem Fünfjährigen die gesamte Aufmerksamkeit von Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante. Der Fünfjährige musste zwar damit rechnen, dass nicht alle Reaktionen angenehm sein werden, denn die Mama wird ihn in jedem Fall kurz rügen. Aber er folgt einem inneren Antrieb, und jede Aufmerksamkeit ist besser als gar keine Aufmerksamkeit! Der elterliche Tadel geht schnell vorüber, und rasch wird umgeschwenkt auf einen liebevollen Tonfall und es regnet Wertschätzung und auf ihn nieder: »Sei doch nett zu deinem kleinen Bruder«, »Du bist doch schon so groß«, »Du gehst ja schon bald in die Schule«, »Bald hast du Geburtstag und dann bekommst du Geschenke und eine Torte mit Kerzen«, »Auf deiner Torte sind dann schon viele Kerzen« …
Der Einjährige und der Fünfjährige sitzen auf der Couch im Wohnzimmer. Der Einjährige hat Geburtstag. Mama, Papa, Onkel, Tante, Opa, Oma: Alle sind da und fokussieren sich auf den Einjährigen. »Wie du lieb lachst«, »Du hast heute Geburtstag, schau was ich dir mitgebracht habe«, »Wie groß du schon bist«, alle möglichen liebevollen Wortmeldungen und Komplimente regnen auf den Kleinen herab. Die gesamte Zuwendung konzentriert sich auf den Einjährigen. Der Fünfjährige fühlt sich zu wenig beachtet und sieht sich zum Handeln gezwungen. Er gibt in einem vermeintlich unbeobachteten Augenblick dem Einjährigen einen Stoß, der natürlich schreit und zu weinen beginnt. Im selben Moment gehört dem Fünfjährigen die gesamte Aufmerksamkeit von Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante. Der Fünfjährige musste zwar damit rechnen, dass nicht alle Reaktionen angenehm sein werden, denn die Mama wird ihn in jedem Fall kurz rügen. Aber er folgt einem inneren Antrieb, und jede Aufmerksamkeit ist besser als gar keine Aufmerksamkeit! Der elterliche Tadel geht schnell vorüber, und rasch wird umgeschwenkt auf einen liebevollen Tonfall und es regnet Wertschätzung und auf ihn nieder: »Sei doch nett zu deinem kleinen Bruder«, »Du bist doch schon so groß«, »Du gehst ja schon bald in die Schule«, »Bald hast du Geburtstag und dann bekommst du Geschenke und eine Torte mit Kerzen«, »Auf deiner Torte sind dann schon viele Kerzen« …
Das Sich-Unbequem-Machen ist eine sehr übliche Taktik, zu der nicht nur unsere Kleinsten greifen, denn sie garantiert Aufmerksamkeit für die eigenen Anliegen. Vielleicht kennen Sie die Situation, wenn der Mitarbeiter im für Sie denkbar ungünstigsten Zeitpunkt mit einer Forderung auf Sie zukommt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Mitarbeiter so gut wie nie mit ihrer Kündigung drohen, wenn das Fahrwasser gerade etwas ruhiger ist und der Vorgesetzte ein paar Tage hat, an denen er ein wenig Luft zum Abarbeiten verschiedener Sachen hat. Sie drohen mit ihrer Kündigung in einem Moment, wo der Vorgesetzte gerade nicht weiß, wo ihm der Kopf steht und welches Projekt er zuerst in Angriff nehmen soll. Ein Partner, der verletzt ist, macht sich auch nicht dann unbequem, wenn beide gerade in Ruhe beim Essen sitzen und gemütlich ihre Beziehung reflektieren oder über den nächsten Sommerurlaub sprechen, sondern er stellt den anderen beispielsweise beim Essen mit Freunden bloß, um seiner Verletzung Ausdruck zu verleihen. Das Sich-Unbequem-Machen ist der erste Schritt, mit dem wir signalisieren, dass uns am und im Miteinander (sei es eine Verhaltensweise, eine Situation, ein falsches Wort am falschen Platz und so weiter) etwas stört oder dass uns daran etwas nicht gefällt. Wenn wir damit nicht weiterkommen, lassen wir uns andere Taktiken einfallen, um die Lage zu unseren Gunsten zu drehen. Wir verfeinern die Methoden oder wir verstärken sie, je nachdem. Und während wir uns noch darüber den Kopf zerbrechen, wie wir das Gegenüber endlich zu einem verträglicheren Verhalten bringen können, sind wir schon längst selbst Teil der Negativspirale, ohne dass es uns überhaupt auffällt.
DAS PERSÖNLICHE WERTEGERÜST – IHR KOMPASS FÜR EIN VERLETZUNGSFREIES NAVIGIEREN IM MITEINANDER
»Wer seine Grenzen kennt, ist schon ein halber Weiser.«
John Galsworthy, englischer Erzähler, Sozialkritiker und Dramatiker, Nobelpreis für Literatur 1932, 1867 – 1933
Permanenter Negativität ausgesetzt zu sein, fügt uns Schaden zu. Wenn wir aus verschiedenen Gründen passiv sind, die Situation über uns ergehen lassen und durchtauchen, lassen wir uns sehenden Auges eine noch tiefere Verletzung zufügen. Wir dürfen nicht zulassen, was uns schadet. Das sagt sich leicht dahin, das ist mir bewusst. Insbesondere, weil wir viele der Widersacher eines guten und wertschätzenden Miteinanders von klein auf kennengelernt haben. Sie gehören dazu, sie sind zur Normalität für uns geworden. Oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir den äußeren Umständen nicht einfach ausgeliefert sind, sondern sogar sehr großen Einfluss darauf haben, welchen Verlauf sie nehmen. Wir haben die Wahl: Was lassen wir zu und was nicht? Was lassen wir mit uns machen und was nicht? Und außerdem: Wie und mit welchen Mitteln halten wir dagegen?
Was wir zulassen und was nicht ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Mitarbeiter, die haben kein Problem damit, wenn sie vom Vorgesetzten bloßgestellt oder zum »Abteilungsbutler« degradiert werden, aber es gibt auch Mitarbeiter, die reagieren beim kleinsten Witz schon sehr allergisch (und der muss nicht einmal auf sie bezogen sein, sondern da reicht es schon, wenn es um ein Thema geht, über das sie einfach nicht lachen können, auch wenn der Rest der Kollegenschaft das kann, und zwar sehr herzhaft). Es gibt Mitmenschen, die stört es nicht, wenn man sie auf eine ihrer Schwächen anspricht, aber es gibt auch welche, die sehr frontal und angriffig aus der Deckung kommen, wenn das passiert.
Was wir zulassen und was nicht, das müssen wir klar und deutlich für uns definieren. Dafür brauchen wir in unserer Wertelandschaft und innerhalb unseres Selbstwertgefühls eine genau erkennbar gezogene Linie, und sie gilt es, im Fall einer Grenzverletzung zu verteidigen.
Wie wir uns zur Wehr setzen, ist ebenfalls sehr unterschiedlich und auch dieses Wie ist etwas, das wir fest umrissen für uns abstecken müssen. Man muss die Regeln kennen, wenn man sie brechen will, heißt es. Das ist – umgelegt auf unser Thema – ein sehr nützlicher Gedanke: Wir müssen die zur Verfügung stehenden und für uns infrage kommenden Methoden und Taktiken zur Gegenwehr kennen und mit ihnen vertraut sein. Nur so können wir im Fall einer Grenzverletzung schnell und sicher entscheiden, welche die richtige ist und wie wir wirksam agieren und reagieren können. Das Sich-Unbequem-Machen mag sich im ersten Moment befreiender und richtiger anfühlen, als eine verletzende Situation über sich ergehen zu lassen – aber mit großer Sicherheit wird der Nutzen des Sich-Unbequem-Machens nicht von Dauer sein. Um nicht in einer Endlosschleife an wehrhaftem Aktionismus zu enden, der nichts an der kränkenden oder störenden Situation ändert, müssen wir wissen, wie und mit welchen Methoden wir effizient, gewalt- und aggressionsfrei vorgehen können, um zu einem guten und wertschätzenden Miteinander zu gelangen. Ob eine Gegenwehr nachhaltig erfolgreich ist, hängt vom Wie ab. Wie setzen wir uns sinnvoll zur Wehr – das ist die Königsdisziplin in der wirksamen Verteidigung unserer Werte. Ich werde Ihnen auf den folgenden Seiten anhand einiger Erzählungen und Beispiele zeigen, wie das geht.
 Ein Architektenteam kam zu einem Meeting bei einem Immobilienverwalter, der bei den Architekten eine Planung in Auftrag gegeben hatte. Die Tochter des Immobilienverwalters arbeitet in diesem Unternehmen als Prokuristin. Die Architekten hatten mit der Prokuristin ein paar Dinge vorbesprochen, wobei es offensichtlich zu einem Missverständnis gekommen war. Worum es im Detail ging, ist an dieser Stelle nicht wichtig. Der Immobilienverwalter wollte jedenfalls wissen, wie es zu dieser Fehlinformation gekommen war, worauf die Architekten ihm sagten, dass sie offenbar beim Vorgespräch mit der Prokuristin etwas falsch verstanden haben mussten. Woraufhin der Immobilienverwalter sagte: »Was habe ich da nur für eine Missgeburt in die Welt gesetzt?!« Alle Anwesenden blieben passiv. Die Tochter wehrte sich nicht, die Architekten reagierten ebenfalls nicht (denn die hätten theoretisch sagen können, dass sie in einer Atmosphäre, in der die 52-jährige Tochter des Auftraggebers von selbigem als »Missgeburt« bezeichnet wird, nicht über Aufträge sprechen möchten – aus meiner Sicht, und das möchte ich festhalten, wäre das sogar ihre Pflicht gewesen). »Was habe ich da nur für eine Missgeburt in die Welt gesetzt?!« Der Satz stand im Raum und blieb unkommentiert. Nichts ist passiert – nach außen hin.
Ein Architektenteam kam zu einem Meeting bei einem Immobilienverwalter, der bei den Architekten eine Planung in Auftrag gegeben hatte. Die Tochter des Immobilienverwalters arbeitet in diesem Unternehmen als Prokuristin. Die Architekten hatten mit der Prokuristin ein paar Dinge vorbesprochen, wobei es offensichtlich zu einem Missverständnis gekommen war. Worum es im Detail ging, ist an dieser Stelle nicht wichtig. Der Immobilienverwalter wollte jedenfalls wissen, wie es zu dieser Fehlinformation gekommen war, worauf die Architekten ihm sagten, dass sie offenbar beim Vorgespräch mit der Prokuristin etwas falsch verstanden haben mussten. Woraufhin der Immobilienverwalter sagte: »Was habe ich da nur für eine Missgeburt in die Welt gesetzt?!« Alle Anwesenden blieben passiv. Die Tochter wehrte sich nicht, die Architekten reagierten ebenfalls nicht (denn die hätten theoretisch sagen können, dass sie in einer Atmosphäre, in der die 52-jährige Tochter des Auftraggebers von selbigem als »Missgeburt« bezeichnet wird, nicht über Aufträge sprechen möchten – aus meiner Sicht, und das möchte ich festhalten, wäre das sogar ihre Pflicht gewesen). »Was habe ich da nur für eine Missgeburt in die Welt gesetzt?!« Der Satz stand im Raum und blieb unkommentiert. Nichts ist passiert – nach außen hin.
Es ist wichtig zu erkennen, wann man etwas im Raum stehen lassen kann und wann eine sofortige Reaktion angebracht ist. Es wird Menschen geben, die eine Beleidigung tatsächlich nicht kränkt, aber es wird welche geben, bei denen eine tiefe Verletzung die Folge ist. Obiges Beispiel habe ich mir nicht etwa selbst ausgedacht, es handelt sich um eine wahre Begebenheit, die sehr gut zeigt, was ich meine. Keiner der Anwesenden hätte diese Kränkung einfach im Raum stehen lassen dürfen – das ist eine destruktive und beleidigende Aussage, die ihresgleichen sucht. Ich kann mir beim allerbesten Willen weder vorstellen, dass sie nicht zutiefst verletzend ist, noch, dass jemand anderer so einen Satz aus dem Mund eines Vaters oder irgendeiner anderen Person für akzeptabel halten könnte. Wer sich aber nicht genau darüber im Klaren ist, wo seine individuellen Grenzen sind und wer nicht einschätzen kann, wann ein Zuviel erreicht ist, wird zu keiner adäquaten Reaktion fähig sein. Wer sein Wertegerüst, seine wunden Punkte und Schwächen nicht kennt, ist Negativität weitgehend schutzlos ausgeliefert und wird nicht angemessen gegensteuern können.
Wer oder was hält Sie davon ab, Verletzungen entgegenzuwirken? Falls Sie sich fragen, wann es an der Zeit ist, aus den Startblöcken zu kommen und wie Sie genau erkennen können, dass ein Punkt erreicht ist, an dem Sie Ihre Grenzen sichtbar machen, sichern und verteidigen müssen, möchte ich Ihnen ein paar Gedankenstützen in Form von unbestechlichen Fragen in die Hand geben, die Ihr Wertegerüst praktisch erdbebensicher machen. Das besonders Gute ist, dass Sie die ehrliche Beantwortung dieser Fragen davon abhalten wird, sich selbst zu manipulieren und Gründe dafür zu suchen, untätigbleiben zu können. Ich möchte nicht verschweigen, dass die Fragen ein wenig unangenehm sein können, insbesondere, weil schonungslose Ehrlichkeit gefragt ist. Behalten Sie Ihr Ziel fest im Blick – Sie möchten nicht mehr verletzt werden, Sie halten an Ihren Werten fest, Sie fordern ein wertschätzendes Miteinander ein, Sie möchten glücklich sein … – und fragen Sie sich:
 Wer oder was hält mich davon ab, Verletzungen entgegenzuwirken?
Wer oder was hält mich davon ab, Verletzungen entgegenzuwirken?
Auf diese Frage gibt es in der Regel nur eine Antwort: Sie selbst sind es, Sie haben aus unterschiedlichen Gründen entschieden, untätig zu bleiben. Es ist im ersten Moment eventuell schmerzlich, wenn man sich das eingestehen muss, aber es ist auch eine ganz besonders gute Nachricht! Denn es bedeutet auch, dass es an Ihnen liegt, Veränderung herbeizuführen!
Warum leben Sie nicht Ihre Wahrheit und Ihre Werte?
 Bitte fragen Sie sich: Wer oder was hält mich davon ab, meine Wahrheit und meine Werte zu leben und diese einzufordern, wenn ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen?
Bitte fragen Sie sich: Wer oder was hält mich davon ab, meine Wahrheit und meine Werte zu leben und diese einzufordern, wenn ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen?
Diese Frage ist mir seit Jahrzehnten ein zentrales Anliegen und prägt mein gesamtes Tun. Die Antwort auf diese Frage ist in der Regel dieselbe wie bei jener, wer oder was uns davon abhält, Verletzungen entgegenzuwirken (siehe Seite 45): Wir selbst haben entschieden, gegen unsere eigene Wahrheit, gegen unsere eigenen Werte zu leben und wir selbst sind es, die wir uns dagegen entschieden haben, diese konsequent einzufordern. Warum tun wir das, warum handeln wir so selbstverletzend? Meistens, weil wir uns vor schlimmen oder unangenehmen Konsequenzen fürchten, oder diese als Ausrede verwenden, denn Veränderung ist normalweise nichts, was uns sehr behagt. Sich das einzugestehen, mag im ersten Moment vielleicht unangenehm und schmerzlich sein, aber es ist wie gesagt auch eine ganz besonders gute Nachricht! Denn Sie haben es in der Hand, Veränderung herbeizuführen! Die Konsequenzen, vor denen wir uns fürchten, sind es meistens, die uns vor einer Entscheidung erstarren lassen wie das Kaninchen vor der Schlange. Aber aus langjähriger Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass nichts mehr stimmt als der Spruch: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Was ist das Schlimmste, das Ihnen passieren kann?
Damit Sie beantworten können, ob Sie bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, müssen Sie die Konsequenzen natürlich kennen. Die Frage scheint auf den ersten Blick daher unbeantwortbar, denn Sie können bei bestimmten Situationen und Konstellationen nicht alle Möglichkeiten erfassen, da sich die meisten davon völlig Ihrem Einflussbereich entziehen und von der Reaktion eines Gegenübers (oder gleich mehreren) abhängen. Sie müssen aber auch gar nicht alle Konsequenzen kennen, sondern nur die für Sie wesentlichen, nämlich jene, die Sie nicht ertragen würden.
 Bitte fragen Sie sich: Was ist das Schlimmste, das mir passieren kann – und halte ich das aus?
Bitte fragen Sie sich: Was ist das Schlimmste, das mir passieren kann – und halte ich das aus?
»Das Schlimmste« passiert meistens nicht, und in den allermeisten Fällen ist »das Schlimmste« außerdem recht gut auszuhalten und weitgehend problemlos zu ertragen. Sobald man es nämlich visualisiert, verliert auch das größte Schreckensszenario seine angsteinflößende und hemmende Wirkung.
 Mit einem meiner ehemaligen Vorgesetzten war ich ein paarmal in so einer Situation. Er verlangte, um nur ein Beispiel zu nennen, etwas von mir, das ganz klar mein Wertegerüst verletzte: Jemanden unter dem Vorwand zu kündigen, er würde schlechte Arbeit leisten, de facto war er meinem Vorgesetzten aber schlichtweg unsympathisch.
Mit einem meiner ehemaligen Vorgesetzten war ich ein paarmal in so einer Situation. Er verlangte, um nur ein Beispiel zu nennen, etwas von mir, das ganz klar mein Wertegerüst verletzte: Jemanden unter dem Vorwand zu kündigen, er würde schlechte Arbeit leisten, de facto war er meinem Vorgesetzten aber schlichtweg unsympathisch.
Auch da habe ich mir die Frage gestellt:
»Was ist das Schlimmste, das mir passieren kann?«
(Ich verliere meinen Job.)
»Halte ich das aus?«
(Völlig klar, dass ich das aushalte, denn ich habe keine Sorge, wieder eine Beschäftigung zu finden.)
Vor mittlerweile drei Jahrzehnten klopfte meine heutige Ghostwriterin an meine Bürotür, ohne Termin, einfach nur, um bei mir zu deponieren: »Herr Zulehner, ich möchte gern für Sie arbeiten!« Sie war nicht glücklich in ihrer Abteilung, hatte aber das Studium noch nicht abgeschlossen und war damit in Wahrheit nicht ausreichend qualifiziert, um in meinem damaligen Team zu arbeiten.
Vielleicht hat sie sich damals gefragt:
»Was ist das Schlimmste, das mir passieren kann?«
(Er sagt nein.)
»Halte ich das aus?«
(Natürlich. Das Schlimmste wäre, ich hätte nicht gefragt.)
Ich habe mich damals gefragt:
»Was ist das Schlimmste, das mir passieren kann?«
(Dass sie ihren Job nicht gut macht und ich mir dann jemand anderen für die Position suchen muss.)
»Halte ich das aus?«
(Natürlich halte ich das aus.)
Ich verrate Ihnen, wie die Geschichte ausgegangen ist: Wenige Monate später war sie ein hochgeschätzter und wertvoller Teil meines Teams, und dass ich damals so entschieden habe, freut mich bis zum heutigen Tag.
Neben dem Aspekt, dass wir uns häufig völlig unbegründet vor schlimmen Konsequenzen fürchten, ist ein weiterer wichtiger Blickpunkt im persönlichen Wertegerüst jener, dass es hier kein Richtig und kein Falsch gibt. Es ist Ihr Wertegerüst und trägt Ihre persönliche, individuelle Note, Ihre Handschrift. Mir ist beispielsweise Pünktlichkeit sehr wichtig. Pünktlichkeit gehört zu meinem Wertegerüst und ich fordere Pünktlichkeit auch ein. Ich kenne viele Menschen, für die Pünktlichkeit keinen besonderen Wert darstellt, unter ihnen Führungskräfte, denen es beispielsweise egal ist, wann die Mitarbeiter in der Früh ins Büro kommen, solange sie nur ihre Arbeit machen. Beides ist richtig. Mir ist Pünktlichkeit wichtig, daher lebe ich sie und fordere sie auch ein. Wem Pünktlichkeit nicht wichtig ist – wer selbst vielleicht dafür bekannt ist, grundsätzlich zu spät zu kommen – , wird es dagegen schwer haben, wenn er sie bei anderen einfordern möchte. Walk the talk heißt es im Amerikanischen, vorleben also, was man selbst für wichtig und richtig hält.
Persönliche Werte, Einstellungen, Haltungen sind wesentliche Treiber unseres Verhaltens. Werte sind das, was wir als erstrebenswert erachten und moralisch, ethisch, menschlich für gut befinden. Wir bekommen sie vorgelebt und vermittelt, und wir prägen im Laufe unseres Lebens selbst Werte aus. An Werten, die uns nützlich erscheinen, orientieren wir uns, wir übernehmen sie oder behalten sie bei. Andere stören uns möglicherweise und wir legen sie ab. Wer von seinen Eltern beispielsweise vorgelebt bekam, dass Pünktlichkeit keinen besonderen Wert darstellt, ist vielleicht im Zuge des Erwachsenwerdens damit konfrontiert worden, dass Unpünktlichkeit sozial tendenziell unverträglich ist und erhebt Pünktlichkeit irgendwann zu einem Teil seines eigenen Wertesystems. Wer streng religiös erzogen worden ist, kommt vielleicht im Laufe seines Lebens darauf, dass Religiosität für ihn keinen besonderen Wert darstellt – oder umgekehrt.
Die bewusste und regelmäßige Auseinandersetzung mit seinem persönlichen Wertesystem ist wichtig. Nur so wissen wir, wer wir sind, auf welche Weise wir durchs Leben gehen wollen und wo wir unsere individuellen Grenzen ziehen möchten – und wann der Punkt erreicht ist, diese nötigenfalls zu verteidigen. Das persönliche Wertegerüst funktioniert wie ein innerer Kompass, der uns bei Entscheidungen hilft, uns zu einem besseren und positiveren Miteinander führt und uns sicherer und stabiler macht in Situationen, in denen unsere Grenzen überschritten werden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.