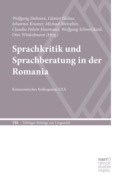Kitabı oku: «Spannung und Textverstehen», sayfa 3
2.2.4 Zillmann
Positive und negative Ausgänge. Der US-amerikanische Psychologe Dolf Zillmann greift bei seiner Suspense-Definition auf mögliche zukünftige Entwicklungen der Geschichte zurück und untersucht diese innerhalb des Mediums Film. Dabei unterscheidet er zwischen solchen Ausgängen, die einen Anreiz darstellen, und solchen Ausgängen, die eine Bedrohung darstellen. Als Anreiz dient häufig eine soziales, finanzielles oder erotisches Gut. Die Bedrohung ergibt sich in der Regel dadurch, dass der Protagonist einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt ist, Leib und Leben sind bedroht. Als Beispiel nennt Zillmann eine Schiffskatastrophe oder die Besteigung eines Berges, in beiden Fällen befinden sich Figuren in lebensbedrohlichen Situation. Häufig sind Bedrohung und positiver Anreiz aneinander gekoppelt. Sollte die jeweilige Figur den negativen Ausgang abwenden können, so erhält sie gleichzeitig eine Belohnung.38
Suspense kommt ohne die positive Dimension aus. Um ein möglichst intensives Suspenseerlebnis zu bieten, müssen Geschichten nach Zillmann folgende Kriterien erfüllen:39
Geschichten müssen mögliche negative Ausgänge suggerieren
Gemochte Protagonisten (liked protagonists) oder eine substitute entity40 müssen betroffen sein von möglichen negativen Ausgängen, damit diese Ausgänge gefürchtet werden von den Rezipienten
Die Wahrscheinlichkeit, dass negative Ausgänge eintreten, muss hoch sein aus der Perspektive des Rezipienten
Bei der Negativität von Ausgängen differenziert Zillmann zwischen verschiedenen Graden. So ist beispielsweise der mögliche Tod auf einem höheren Negativitätsniveau angesiedelt als der Verlust von Eigentum oder die soziale Isolation. Um das Suspenseerleben zu ermöglichen, müssen die antagonistischen Kräfte den gemochten Protagonisten glaubwürdig schädigen können. Die Gefahr kann an dritten Parteien demonstriert werden, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Suspense setzt nach Zillmann nicht voraus, dass Moral im Spiel, womit er sich explizit gegen Carroll richtet.41
Bei der Erzeugung von Suspense spielen die Angst und die Hoffnung von Rezipienten eine zentrale Rolle. Die negativen Konsequenzen für einen Protagonisten werden gekoppelt an die Angst, dass ein erhofftes Ereignis nicht eintreten und dass ein unerwünschtes Ereignis eintreten wird. Zugleich werden sie gekoppelt an die Hoffnung, dass ein bevorzugter Ausgang eintreten wird, dass ein unerwünschtes Ereignis für den Protagonisten nicht eintreten wird und dass negative Ereignisse für antagonistische Figuren eintreten werden. Beide sind als affektive Reaktionen eng aneinander gebunden, es handelt sich um zwei Seiten einer Medaille.42
Zillmann zufolge kann der Suspenseeffekt mit körperlichen Reaktionen einhergehen. Als mögliche Reaktionen nennt er Schweißausbrüche und Fingernägelkauen. Der Rezeption kann von Rastlosigkeit und Unruhe begleitet werden. Zum Teil lässt sich der Rezipient dazu hinreißen, zu applaudieren, wenn sich die Handlung zum Positiven für den Protagonisten auflöst.43
Dem Rezipienten weist Zillmann die Rolle eines Zeugen zu. Auf der Leinwand dargestellte Handlungen und Ereignisse wirken sich weder positiv noch negativ auf seinen Alltag aus. Auch umgekehrt besitzt er keinen Einfluss auf die Textwelt, die Entwicklungen im Film bleiben vom Rezipienten unberührt.44
Hoffen, Bangen und die Einstellung zum Helden. Hoffnung und Angst hängen stark mit der Einstellung des Rezipienten zum Protagonisten zusammen. Diese Relation zum Protagonisten beschreibt Zillmann als Empathie (ein identifikatorisches Verhältnis weist er zurück, weil die Figuren und Leser über verschiedene Wissensbestände verfügen und daher auch verschiedenen Emotionen ausgesetzt sein können).45
Diese affektiven Dispositionen basieren nach Zillmann auf soziopsychologischen Prozessen, die je nach der emotionalen Beziehung zu den Figuren variieren. Leidet eine gemochte Figur, so leidet auch der Rezipient. Freut sich diese Figur, so überträgt sich das positive Gefühl auf den Leser bzw. Zuschauer. Antipathie gegenüber einer Person führt zu einer entgegengesetzten emotionalen Reaktion. Die Freude des Antagonisten verursacht negative, sein Leiden positive Emotionen. Die Wahrnehmung von positivem und negativem Ausgang kehrt sich also um, wenn sich die Einstellung zu den Figuren umkehrt. So kann das gleiche Ereignis beim Zuschauer verschiedene Reaktionen hervorrufen – je nachdem, in welcher Relation er zu einzelnen Figuren steht.46
Mit der Relation ändert sich auch die Bewertung von negativen und positiven Ausgängen einzelner Figuren. Eine negative Konsequenz für einen Antagonisten wird vom Rezipienten als positiv empfunden. Eine negative Konsequenz, die den Protagonisten betrifft, wird als negativ eingestuft. Es gibt also negative Konsequenzen für Figuren, die je nach der Einstellung der Rezipienten als positiv und negativ eingeordnet wird.47
Suspense, Euphorie und Disphorie. Von der Relation zum Protagonisten und vom negativen Ausgang hängen Euphorie- und Disphorie-Reaktionen ab. Euphorie entsteht, wenn eine Gefahr für einen gemochten Protagonisten verringert oder abgewendet wurde. Sie steigt, je größer der Schaden für den Antagonisten und der Nutzen für den Protagonisten ist. Mit der Disphorie-Reaktion verhält es sich umgekehrt. Sie steigt zum Beispiel, wenn eine negative Konsequenz eintritt. In Geschichten nehmen mögliche negative Emotionen den Großteil der Zeit ein, bis am Ende eine positive Auflösung erfolgt. Das bedeutet, dass viele Episoden häufig mit Disphorie beladen sind, dass das finale Ende jedoch Euphorie erzeugt.48
Zugleich beeinflusst auch der Beitrag des Protagonisten zum Ausgang die Euphorie- und Disphorieintensität. Die Disphorie steigt, wenn der Protagonist die negativen Folgen selbst herbeiführt. Die Euphorie ist größer, je stärker der Protagonist zur Lösung des Problems bzw. zur Abwendung des negativen Ausgangs beigetragen hat. Handelt es sich um einen inaktiven Protagonisten, so steigt die Euphorie nur marginal.49
Daraus leitet Zillmann praktische Implikationen für den Anfang und das Ende von Geschichten ab: Zu Beginn einer Geschichte sollte der Protagonisten in ein positives Licht gerückt und der Antagonist negativ darstellt werden. Erst danach kann begonnen werden, den Protagonisten mit Gefahrensituationen zu konfrontieren. Die Auflösung verläuft optimal, wenn der Protagonist das Böse selbst (allein) besiegt und dafür belohnt wird.50
Die Gewichtung der Wahrscheinlichkeit negativer Ausgänge und der Einstellung gegenüber den Figuren. In einer experimentellen Studie haben Comisky und Bryant die Faktoren Relation zur Figur und die Wahrscheinlichkeit des negativen Ausgangs kombiniert und den Einfluss auf das Suspenseempfinden untersucht. Verschiedenen Gruppen ihres Experiments haben sie die gleiche Filmsequenz vorgespielt. Dabei wurde die jeweilige Vorstellung durch einen Kommentar des Erzählers eingeleitet, der von Gruppe zu Gruppe verschiedene Informationen über die Überlebenschancen des Helden enthielt und den Protagonisten entweder in einem neutralen, in einem positiven oder in einem sehr positiven Licht erscheinen ließ. Die Auswertung dieses Experiments ergab, dass die Wahrscheinlichkeit des Ausgangs den Hauptteil bei der Suspensebildung ausmacht. Je geringer die Chance des positiven Ausgangs, desto höher der Suspense. Die hohe positive Relation zum Protagonisten steigert die Spannung zwar, sie besitzt allerdings einen geringen Teil an der Spannungsbildung.51
2.2.5 Wulff
Eine konstruktivistische Zeichen- und Textdefinition.
Die Funktion von Text ist, den Textverarbeitungsprozess zu strukturieren und kontrollieren, und nicht so sehr, ein Thema oder eine Geschichte als ein wohlgeformtes, ganzheitliches Gebilde zu exponieren.52
Der deutsche Filmwissenschaftler Hans J. Wulff legt für die Analyse von Suspense die konstruktivistische Kernannahme zugrunde, das dem Rezipient eine aktive Rolle bei der Bedeutungskonstitution von narrativ-audiovisuellen Texten zukommt. Denken und Wahrnehmung vollziehen sich bei der Rezeption von audiovisuellen Texten demnach aktiv und mit dem Ziel, eine kohärente (Text-)Welt zu konstruieren (auch konstruktivistisches Rezeptionsmodell). Der audiovisuelle Text stellt Szenen, Situationen und Sequenzen bereit, die der Rezipient kognitionsgestützt verarbeitet. Diese nutzen den Kohärenz- und Ganzheitswunsch des Rezipienten gezielt aus.53
Um Suspense zu erzeugen, muss der Text dem Zuschauer Informationen bieten, aus denen dieser zukünftige Entwicklungen und die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens erschließen kann. Bei der Analyse von Suspense darf weder die textuelle noch die kognitive Seite vernachlässigt werden. Der Text gilt dieser Auffassung nach als ein instruktionales Gebilde.54
Die Spannungskonstruktion wird darum gefaßt als eine Sequenz von Textinformationen, die eine dazugehörige Sequenz von Verarbeitungsoperationen des Zuschauers erforderlich macht und diese steuert; diese beiden Komponenten bilden zusammen einen Untersuchungsgegenstand.55
Als typischen Fall beschreibt er, wie der Protagonist im Gebirge an einer Steilwand in einem Seil hängt und wie sein Seil über eine scharfe Bergkante reibt. Auf der Basis dieser Informationen bildet der Zuschauer die Hypothese, dass das Seil reißen könnte und dass die Figur in die Tiefe stürzt und stirbt.56
Die jeweiligen Erwartungen ergeben sich aus einzelnen Text-Informationen und verschiedenen Bereichen des Wissen:
Nun spielen schematisierte Wissensbestände […] eine zentrale Rolle, seien es nun stofflich orientierte Einheiten des Wissens (wie Gegenstands-Frames oder situationale Skripten) oder aber syntaktsiche Bauformen des Textes (wie z.B. Alternationsmontage) oder semantosyntaktische Prinzipien der Textbildung (wie sie in den verschiedenen Geschichtengrammatiken zu beschreiben versucht werden).57
Auf dieser Grundlage generiert der Rezipient Wulff zufolge Hypothesen, die sich auf der Mikro- und Makroebene ansiedeln und die auf beiden Ebenen Spannung erzeugen.58 Suspense entsteht nach Wulff durch possible and probable developments in the plot, which often cannot even be proven on the surface of the film.59
Neu einlaufende Informationen sollten nicht nur als Tatsache verarbeitet werden sondern auch als starting point von zukünftigen Entwicklungen hinsichtlich einer Geschichte, sozialen Situationen oder einer Folge von Ereignissen gesehen werden.60
Wulff betont – ähnlich wie Zillmann –, dass die antizipierten Entwicklungen keine beliebigen sein dürfen, der Zuschauer muss einen negativen Ausgang antizipieren. Deshalb sollten die textuellen Erzeugnisse die Aufmerksamkeit der Rezipienten in Richtung Probleme, Gefahren und Hindernisse manipulieren, die auf diese Weise mögliche Entwicklungen andeuten und diesen gleichzeitig Wahrscheinlichkeitsgrade suggestiv zuordnen. Der Text suggeriert lediglich ein Ensemble alternativer Möglichkeiten bzw. ein Feld möglicher Entwicklungen.61 Die negativen Aspekte müssen sich nicht konkretisieren.62
Textuelle Elemente, die dazu dienen, mögliche zukünftige Entwicklungen anzudeuten, bezeichnet Wulff Kataphora. Wulff unterscheidet darüber hinaus zwischen Textsegmenten, die das Problem präzisieren, und Textsegmenten, die den Problemraum in eine andere Richtung lenken. Letztendlich kann der Rezipient eine Reihe möglicher Entwicklungen mental konstruieren, die durch neu einlaufende Textsegmente erweitert werden können. Die Textwelt wird dabei nicht vollständig realisiert, die Textebene umfasst nur relevante Aspekte. Es gibt auf der Textebene eine Selektion.63
Auch der Rezeptionsprozess vollzieht sich selektiv. Nur problembezogenem wird Aufmerksamkeit geschenkt. Wulff spricht in diesem Zusammenhang auch von einer metarezeptiven Hypothese der Rezipienten.64
2.3 Zwischenfazit
Auf einer fundamentalen Ebene befinden sich textexterne Überlegungen zu Spannung. Dabei wird Spannung auf den Zeigarnik-Effekt zurückgeführt oder durch das rezipientenseitige Bedürfnis nach Kontrolle begründet. Diese Ansätze vernachlässigen Strukturmerkmale von Texten, daher entziehen sie sich der linguistischen Analyse und werden deshalb nicht weiter berücksichtigt.
Auf einem rezeptionstheoretischen Fundament charakterisiert Sternberg die Spannungsleerstellen des Curiosity, des Suspense und vom Puzzle, die er auch als rezipientenseitige Fragen beschreibt. Beim Curiosity gibt es einen Vergangenheitsbezug, beim Suspense steht eine zukunftsgerichtete Leerstelle im Zentrum. Er konzentriert sich auf schriftsprachliche Texte.
Sternbergs Ansatz dient als Anknüpfungspunkt für das Forscherteam um Brewer. Sie orientieren sich an dem Verhältnis zwischen Plot-Story-Ebene und an der Terminologie und beschreiben die Typen Suspense und Curiosity. Beim Suspense kommt zusätzlich die Frage hinzu, wie sich das Verhältnis zwischen dem Wissen der Rezipienten und dem Wissen der Figuren gestaltet, ein Aspekt der in der Hitchcockschen Suspensedefinition entscheidend ist und der in den anderen Ansätzen keine Rolle spielt. Die rezeptionstheoretische Terminologie wie Leerstelle und die damit verbundenen Fragen gehen dabei verloren. Die zeitliche Dimension ist vorhanden, wenn auch wie bei allen anderen Autoren außer Carroll stillschweigend. Brewer abstrahiert in seinen Forschungen von einer konkreten Modalität.
Carroll untersucht das Curiosity und den Suspense im Film, die gemeinsam fictions of uncertainty konstituieren. Beim Curiosity steht eine Frage im Zentrum, die mehrere Antworten zulässt, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Den Suspense beschreibt er als das Stellen von Fragen, von denen eine als moralisch gut und zugleich unwahrscheinlich gilt und die andere als moralisch schlecht und wahrscheinlich gilt. Die Antworten schließen sich logisch aus. Unabhängig von Sternberg kommt Carroll zu dem Schluss, dass sich der Suspense (zukunftsbezogen) und das Curiosity (vergangenheitsbezogen) in zeitlicher Hinsicht unterscheiden.
Zillmann konzentriert sich im Rahmen seiner psychologischen Theorie nur auf den filmischen Suspense. Seinem Ansatz nach entsteht dieser dramatische Effekt durch negative Konsequenzen für gemochte Helden, die vom Rezipienten für sehr wahrscheinlich erachtet werden. Bei den negativen Konsequenzen spielt die von Carroll postulierte moralische Dimension keine Rolle, er grenzt sich in diesem Punkt explizit von Carroll ab. Die Arbeiten von Sternberg und von Brewer besitzen im Rahmen von Zillmanns Arbeiten keinen Einfluss.
Wulff ergänzt Zillmanns Analyse um eine kognitive Dimension, der zufolge sich die Erwartung eines negativen Ausgangs ergibt aus Textinformationen und Schemata, die durch Relevanzerwägungen zu einander in Beziehung gesetzt werden. Die Ergebnisse der anderen Autoren spielen bei ihm keine Rolle. Im Zentrum steht der filmische Suspense.
Wulff ist der einzige Autor, der die kognitive Dimension der Spannung in seine Überlegungen mit einbezieht. Damit entwickelt er das Fundament, um die Ziele dieser Arbeit zu erreichen. Er gibt den Anstoß, um den Suspense und andere Spannungstypen aus einer kognitionslinguistisch orientierten Perspektive zu beleuchten, wobei neben lokalen Aspekten auch die globale Dimension ergänzt werden soll, um zu einem umfassenden Bild zu gelangen.
II Grundlagen einer Theorie des Textverstehens
If someone said, ’It’s raining frogs‘, your mind would swiftly fill with thoughts about the origins of those frogs, about what happens to them when they hit the ground, about what could have caused that peculiar plague, and about whether or not the announcer had gone mad. Yet the stimulus for all this is just three words. How do our minds conceive such complex scenes from such sparse cues? The additional details must come from memories and reasoning.65
Sprachliche Kommunikation besitzt einen elliptischen Charakter. Auf der Basis einer geringen Anzahl textueller Signale (sparse cues, stimulus) wird eine Vielzahl rezipientenseitiger Aktivitäten stimuliert, die sich nähren aus den im Zitat benannten Bereichen des Wissens (memory) und der Inferenzen (reasoning), die die Grundlage bilden für die Konstruktion eines mentalen Modells (hier scenes). Im Folgenden werden diese drei Hauptfelder kognitiv orientierter Disziplinen vorgestellt. Damit rückt dieser Teil die repäsentationalen und prozedualen Aspekte des Textverstehens ins Zentrum, die sich aus kognitionsorientierten und psycholinguistischen Ansätzen ergeben.
In Kapitel 3 werden Frame- und Schema-theoretische Ansätze integrativ vorgestellt, die auch Wissen über Textsorten mit einschließen. Dabei werden zentrale Begriffe wie Leerstelle, Füllwert, Prototypikalität etc. eingeführt. Zunächst werden diese Entitäten unabhängig von sprachlichen Aspekten als fundamentale Einheiten der Kognition beschrieben.
In Kapitel 4 wird eine Vielzahl mentaler Prozesse vorgestellt, die auf den kognitiven Strukturen basieren. Dabei wird zunächst der für diese Arbeit zentrale Begriff der Inferenz definiert. Nachdem ein kompakter Einblick in die Welt der Inferenzen in der klassischen Philosophie gegeben wurde, werden die Ansätze zu verstehensnotwendigen Inferenzen aus der Textverstehenstheorie vorgestellt. Dabei werden zunächst Inferenzen auf Wortebene vorgestellt, wobei der Satzkontext in der Regel eine wichtige Rolle spielt. Dann werden Inferenzen vorgestellt, die angrenzende Sätze verbinden. Im Anschluss werden Inferenzen beschrieben, die sich auf größere Diskurssegmente eines Textes beziehen und diese vorstellen. Der Aufbau folgt also der Komplexität des zugrunde liegenden Textmaterials. Darüber hinaus wird eine weitere Klasse von Inferenzen vorgestellt, die sogenannten elaborativen Inferenzen. Diese besitzen keine kohärenzstiftende Funktion. Das Kapitel endet mit einer Klassifikation von Inferenzen und mit der Beschreibung von Leserzielen, die einen Grund dafür liefern, warum Rezipienten überhaupt eine derartige Aktivität bei der Textrezeption zeigen.
Während diese Prozesse in Kapitel 4 auf der Ebene einzelner Sätze, Satzpaare und kurzer Abschnitte beschrieben werden, fasst Kapitel 5 komprimiert zusammen, was die Textverstehensforschung im Bereich der mentalen Repräsentation umfangreicherer Texte anbietet, deren Konstruktion auf einer wiederholten Anwendung der in Kapitel 4 vorgestellten Prozesse basiert.
3 Wissen
Im Folgenden wird eine Reihe von kognitiven Ansätzen integrativ vorgestellt. Dabei wird das kognitive System zunächst isoliert betrachtet. Dieser Schritt ergibt sich aus dem Cognitive Commitment, das besagt, dass es sich bei den Verarbeitungsprozessen nicht um sprachspezifische Mechanismen handelt sondern um allgemeine mentale Operationen.1
3.1 Wissensrahmen
Kognitionsbezogene Theorien zum Wissen wurden in verschiedenen, zum Teil relativ autonomen Wissenschaftsdisziplinen entwickelt und in Abhängigkeit von der jeweiligen Forschungsunternehmung und den damit verbundenen Erkenntnisinteressen unterschiedlich akzentuiert – letztendlich mit konvergierender Evidenz, was sich niederschlägt in einer zunehmenden wechselseitigen Rezeption und in einer verstärkten gegenseitigen Beeinflussung. Marvin Lee Minsky – Frame-Pionier, Mathematiker und Informatiker – stellt eine allgemeine Theorie auf und verweist auf eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene, die sein Ansatz explanatorisch bewältigen kann und die hauptsächlich auf der Ebene der visuellen und sprachlichen Verarbeitung liegen. Der Linguist Fillmore bezieht sich überwiegend auf die Wort- und Satzebene, erkennt allerdings ein globales Anwendungspotential. Forscher wie der US-Psychologe Rumelhart richten ihre wissenschaftlichen Aktivitäten auf umfangreichere Texte wie zum Beispiel Geschichten. So erwachsen aus einer kognitionszentrierten Perspektive Erklärungsmöglichkeiten für eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene. Sie erweist sich als global anwendbar und besticht durch ihre unifizierende Kraft.
Trotz terminologischer und theoretischer Unterschiede zwischen den Ansätzen weisen die Theorien starke strukturelle und funktionale Parallelen auf, worauf bereits Rumelhart in seinem Artikel „Schemata: The Building Blocks of Cognition“ hinweist.2 Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum Fillmore Begriffe wie Schema, Frame etc. in einem seiner zentralen und mehrfach veröffentlichten Aufsätze „Frame Semantics“ gleichsetzt.3
Terminologische Inhomogenitäten. In der Literatur zur Untersuchung von Wissen finden sich eine Reihe konkurrierender Begriffe, die erhebliche Schnittmengen aufweisen und deshalb kaum auseinanderzuhalten sind. Die Begriffe variieren nicht nur von Autor zu Autor, sondern zum Teil auch innerhalb des Œuvres eines Autors. So bezeichnen Sanford und Garrod das Wissen als scenarios ,4 Minsky spricht von frames.5 Bei Fillmore werden verschiedene Theorieversionen begleitet von verschiedenen terminologischen Präferenzen. In seinen theoretischen Vorarbeiten spricht Fillmore (1971) von Kasusrahmen,6 Fillmore (1975) von scene,7 Fillmore (1977a) von scenes,8 Fillmore (1977b) von schemata, 9 Fillmore (2006) wieder von frames.10 So soll ohne die folgenden Begriffe bereits andeutungsweise beschrieben zu haben, zunächst darauf hingewiesen werden, dass konkurrierende technische Ausdrücke alle Ebenen der Beschreibung durchdringen. Der Dichotomie von Slot und Filler stehen Alternativen gegenüber wie attributes und values bei Barsalou, terminals und instances bzw. assignments bei Minsky, Rumelhart spricht von variables und values.11
Als Kriterien für terminologische Entscheidungen dienen in dieser Arbeit die semantische Durchsichtigkeit und die Etabliertheit eines Begriffs. Die transparenteste und eingängigste Alternative zu Frame, Schema etc. bietet der Ausdruck Wissensrahmen, den Busse gebraucht. Er vermeidet die Ebenenmischung der grammatischen Oberflächenstruktur mit der Tiefendimension und beugt so terminologisch bedingten Missverständnissen vor, die möglicherweise mit Begriffen wie Kasusrahmen einhergehen.12 Slot und Filler werden in dieser Arbeit als Leerstellen und Füllwerte aufgenommen, wie es sich in der deutschsprachigen Diskussion etabliert hat (zum Beispiel bei Ziem (2008)). Hinsichtlich der übrigen Begriffe werden terminologische Entscheidungen an der jeweiligen Stelle getroffen, die den oben genannten Kriterien entsprechen.
Wissensrahmen. Denkt man an einen Kindergeburtstag, so gelangt man zu einer Ansammlung epistemischer Elemente. Es gibt eine bestimmte Kleiderordnung, jeder Gast bringt ein Geschenk mit, es gibt ein Unterhaltungsprogramm mit einer Reihe von Aktivitäten, die zum Beispiel Topfschlagen mit einschließen. Ein Kindergeburtstag findet tagsüber statt und umfasst einen längeren zeitlichen Abschnitt. Deshalb kommen eher ein Samstag oder ein Sonntag für diese Art von Veranstaltung in Frage als ein Wochentag, dessen Struktur und Organisation durch den Schulalltag maßgeblich geprägt ist.13 Bei diesem abgerufenen Komplex handelt es sich um einen Wissensrahmen, der in prototypischer Weise Wissenselemente im Gedächtnis organisiert und der das Potential besitzt, eine Vielzahl möglicher Entitäten mental repräsentieren zu können.14
Rahmen, Leerstellen und Prototypikalität: Wissensrahmen verfügen über Leerstellen.15 Diese sind standardmäßig mit ihnen verbunden und lassen sich durch Fragen paraphrasieren, die situationsabhängig mit Füllwerten besetzt werden können.16 Wissensrahmen vergleicht Minsky mit einem Skelett und mit einem Bewerbungsbogen. Beide geben eine grobe Struktur vor und müssen mit konkretem Material gefüllt werden. Ein Wissensrahmen ist a sort of skeleton, somewhat like an application form with many blanks or slots to be filled.17 Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Leerstelle gemeinsam auftritt mit einem Wissensrahmen, desto höher ist der Grad der Prototypikalität einer Leerstelle. Barsalou spricht auch von Attributsystematizität und verdeutlicht es an dem Konzept VOGEL. Der Rezipient würde demnach Leerstellen für die Größe, die Farbe und den Schnabel konstruieren.18 Ähnlich sollte es sich mit dem Rahmen zu WEIN verhalten, prototypische Leerstellen könnten den Jahrgang, die Herkunft, die geschmackliche Richtung etc. betreffen. Mögliche Füllwerte wären zum Beispiel 1982, BORDEAUX, TROCKEN.
Rahmenlose Informationen und informationslose Rahmen: Rahmenlose Informationen streben danach, in einen Rahmen eingebettet zu werden. So werden sie zu anderen Wissenselementen in Bezug gesetzt und stellen keine atomaren Einheiten dar. Informationslose Rahmen (d.h. Rahmen mit Leerstellen) streben nach Sättigung.19 In seiner einfachsten Form wird der Drang zur Auffüllung leerer Endpunkte als eine Art Unwohlgefühl oder Hunger erscheinen.20 Leerstellen können auf zweierlei Weise durch Füllwerte gesättigt werden. Einerseits kann dies in einem Top-Down-Prozess geschehen durch typischerweise zum Wissensrahmen gehörende Elemente. Man spricht auch von Standardwerten (englisch default values, default assignments).21
’Default assumptions fill our frames to represent what’s typical‘. As soon as you hear a word like ’person‘, ’frog‘, or ’chair,‘ you assume the details of some ’typical‘ sort of person, frog, or chair. You do this not only with language, but with vision, too.22
Zum Bereich der wissensbasierten Instantiierungen gehören auch Default-Annahmen mit antizipatorischem Charakter. (In Kapitel 4 werden diejenigen Inferenzen, Elaborationen und Erwartungen vorgestellt, die bei der Textrezeption systematisch auftreten.) Diese aus epistemischen Agglomerationen generierten Erwartungen richten sich zeitlich auf zwei Dimensionen. Einerseits auf zukünftige Ereignisse bzw. zukünftig wahrnehmbare Daten. Sieht oder liest jemand zum Beispiel, dass sich eine Person eine Fahrkarte kauft, so generiert er die Hypothese, dass die Person mit einem Zug fahren wird.23 Auf der anderen Seite richten sich Erwartungen auf Daten, die zwar zum Zeitpunkt der Hypothesenherstellung gegeben sind, die allerdings in diesem Augenblick nicht wahrgenommen werden bzw. nicht wahrnehmbar sind. Sieht eine Person zum Beispiel eine Lampe, so elaboriert sie die Tatsache, dass diese Lichtquelle über einen Knopf verfügt, der dem An- und Ausschalten dient.24 In Anlehnung an diese Beschreibung lassen sich auch Erwartungsbrüche formulieren, die auftreten, sobald die Daten mit den wissensinduzierten Hypothesen nicht übereinstimmen.25
Die aus dem prototypischen Wissen generierten Standardwerte können also einen hypothetischen Status besitzen.26 Ein Standardwert wird aufrechterhalten, wenn dieser mit dem perzeptuellen Input übereinstimmt oder wenn kein sensorisches Datum dem Standardwert widerspricht. Sollten sich nicht kompatible Füllwerte ergeben aus dem sensorischen oder aus dem textuellen Input (die zweite Möglichkeit der Sättigung), so sind diese auf Bottom-Up-Prozessen basierenden Füllwerte privilegiert gegenüber wissensgestützten und verdrängen die prototypische Instantiierung.27
Indem kognitionsbasierte Theorien verschiedener Disziplinen die Prototypikalität in ihren Ansätzen integrieren, übernehmen sie zentrale Gedanken der Prototypentheorie, wie sie von Rosch beschrieben werden. So hebt Barsalou explizit hervor, dass es sich bei einem Wissensrahmen und den damit verbundenen Elementen nicht um eine Konjunktion unverzichtbarer Bestandteile handelt. Vielmehr handelt es sich um Elemente, die nicht alle gleichermaßen realisiert sein müssen. Das führt dazu, dass wissensbasierte Instantiierungen durch perzeptuelle Stimuli korrigiert werden können. (Siehe dazu Absatz 4.) Durch die Adaption des Prototypenbegriffs wird zugleich die Annahme der kulturabhängigen bzw. relativen Intersubjektivität als tragende Säule in den Theoriekomplex installiert, die Barsalou daran erläutert, dass eher Menschen aus Ländern Katalysatoren (smog device) in ihrem Wissen über Fahrzeuge aufnehmen sollten, in denen diese üblich sind.28 Diese stillschweigend vorausgesetzte Annahme der Intersubjektivität schimmert auch in Minsky’s Frame-Theorie als einem Common-Sense-Ansatz durch, er beschreibt seinen Ansatz auch als eine Theorie des everyday bzw. ordinary thinking.29 Darüber hinaus erlaubt es der Prototypikalitätsgedanke, das Verhältnis zwischen Rahmen und den Elementen auf einer Prototypikalitätsskala abzubilden. Bei einer Zugfahrt würde der Kauf eines Tickets oder das Einsteigen in das Fahrzeug zu den zentralen Elementen zählen. Als optionales und eher periphereres Rahmenelement käme zum Beispiel der Erwerb einer Zeitung am Bahnhofskiosk in Frage.30 Die zentralen Elemente eines Rahmens nennt Barsalou strukturelle Invarianten.31
Rahmenwahl, Rahmenverwerfung und der sensorische Input. Ebenso wie wissensbasierte Instantiierungen von Leerstellen durch sensorischen Input korrigiert werden können, muss sich die Wahl eines Rahmens an der Realität messen lassen. Das Auftreten einer Anomalie kann sich als ein Indiz dafür entpuppen, dass der gesamte Rahmen unpassend gewählt ist bzw. dass der Wissensrahmen sich für die Integration der sensorischen oder textuellen Daten als inadäquat erweist. Das kann zum Beispiel zu einer von Minsky beschriebenen Spezialfallanpassung führen. Die Daten werden dabei von einem spezielleren Rahmen akkommodiert, der eine geringfügig abweichende Konfiguration der Informationen erlaubt. Eine solche Spezialfallanpassung veranschaulicht Minsky am STUHL-Rahmen. Dieser kann in einen SPIELZEUGSTUHL-Rahmen überführt werden, wenn eine Anomalie auftritt wie zum Beispiel eine Abweichung von der prototypischen Größe. Sollte sich ein Stuhl als wesentlich kleiner erweisen, so kann der STUHL-Rahmen mit einem SPIELZEUG-Rahmen korreliert werden, was zur Konstruktion eines SPIELZEUGSTUHL-Rahmens führt. Sollte keine Möglichkeit der Anpassung gefunden werden, so kann der vollständige Rahmen verworfen werden oder es können neue Rahmen konstruiert werden, bei denen Bestandteile bereits vorhandener Rahmen rekrutiert und in einem amalgamierten Wissenskomplex zusammengeführt werden. Bei inadäquater Rahmenwahl bieten sich dem kognitiven System also verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, die die Kompatibilität zwischen Rahmen und sensorischen Daten anstreben.32