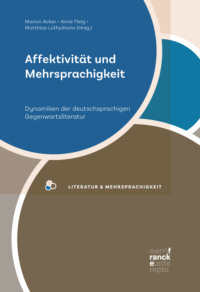Kitabı oku: «Affektivität und Mehrsprachigkeit», sayfa 6
Der dritte Teil des Gedichts (Vers 39 bis 67) setzt dieses ‚Thema‘ fort, indem er teils abstoßende Körperlichkeit aufruft: „Steißbein knall- / blasen / verschwitzt hat o Pfaffengekrös […] Geschwür im Gelenk“, heißt es, und später: „Schierling in Haut gepurpur schwillt auf Würmlein und Affe hat Hand / und Gesäß“. Auch auf Suchtverhalten kommt der Text zu sprechen: „blau immer blau […] Bier bar“. Diese Körperlichkeit steht weiterhin im Kontrast zum zivilisierten Personal („Pfaffe“, „Blumenpoet“) – ähnlich, wenn der tierische „Eckzahn“ in die Nähe des „Dichter[s]“ gerückt wird. Diese Kontrastierung findet ihren Höhepunkt kurz vor dem Ende des Gedichts in den Worten „Dytiramba toro und der Ochs und der Ochs“, in denen eine Form der poetischen Begeisterung mit dem Kinderreim des Beginns („birribum birribum saust der Ochs im Kreis herum“) in Verbindung gebracht wird: Der Dithyrambus als Erscheinungsform kulturkonstitutiver Rituale wird mit tierischem Wahnsinn („toro“ bzw. „Ochs“ verhalten sich ganz und gar artuntypisch) bzw. mit konsequenzlosem kindlichem Unsinn in eins gesetzt – was allerdings vielleicht insofern durchaus passend und insofern weniger kontrastiv ist, als der Dithyrambus sich den Wahn ja immer schon zunutze macht.
Es scheint mir kein Zufall, dass gerade in diesem dritten Teil des Gedichts eine starke Einmischung exotischer Lautfügungen und Afrikanismen zu beobachten ist: Zahlreiche pränasalierte Konsonanten sowie die annähernde Gleichverteilung von Vokalen und Konsonanten sollen wohl ‚afrikanisch‘ anmuten und sind es teilweise tatsächlich.11 Der Schlussteil des Gedichts vollzieht so zunehmend auch auf der Ebene von Lautlichkeit und Sprachigkeit, was der Mittelteil durch die Exposition des Geschehens um Pfarrer, Großmutter usw. bildlich entwirft: die Einebnung von Hierarchien, wie sie für die kriegführenden Parteien konstitutiv waren, im Sinne eines literarischen Primitivismus. So lässt sich der Titel „Ebene“ verstehen: Es geht um den Versuch einer Verflachung der Zivilisationsarchitektur und ihren Sinndimensionen.12 Die Anklänge an eine Poetik des Primitivismus stellen dann den Versuch dar, kulturkonstitutive, allenfalls affektiv gesteuerte, insgesamt aber ihrer Selbstorganisation überlassene sprachliche Kreativität freizusetzen – wie sie dann womöglich in der Aufführungssituation auch ausgelebt werde konnte. Dabei bleibt aber die Auflösung des Affekts in Unverbindlichkeit und Unsinn – „birribum birribum saust der Ochs im Kreis herum“ – entscheidend. Es handelt sich keineswegs um eine anti-moderne Form des Primitivismus, sondern um eine solche, der die für das Modernebewusstsein konstitutive zeitliche Dichotomie zwischen Moderne und Vormoderne schlicht gleichgültig ist: Es geht weder darum, zurück vor eine fatale Epochenschwelle, noch darum, über die verdorbene Gegenwart hinaus zu gelangen.
In BallBall, Hugos „Totenklage“, einem der Lautgedichte, in denen der Autor, wie bereits zitiert, angeblich „in Bausch und Bogen auf die […] verdorbene und unmöglich gewordene Sprache“13 verzichtet, ist ebenfalls eine Botschaft aus Afrika eingeschrieben.
Totenklage
Ombula
Take
Biti
Solunkola
tabla tokta tokta takabla
taka tak
tabula m’balam
tak tru – ü
wo–um
biba bimbel
o kla o auwa
kla o auwa
kla– auma
o kla o ü
kla o auma
klinga– o – e–auwa
ome o-auwa
klinga inga M ao– Auwa
omba dij omuff pomo– auwa
tru–ü
tro–u–ü o–a–o–ü
mo-auwa
gomun guma zangaga gago blagaga
szagaglugi m ba–o–auma
szaga szago
szaga la m’blama
bschigi bschigo
bschigi bschigi
bschiggo bschiggo
goggo goggo
ogoggo
a–o–auma
Das erste Wort des Gedichts, „ombula“, lässt sich, den Angaben der neuen kritischen Ausgabe zufolge,14 mit dem Verb „omboleza“, Suaheli für ‚beklagen‘, ‚betrauern‘, in Verbindung bringen, und auch einige der weiteren Worte aus dem Suaheli, die in dieser Ausgabe verzeichnet sind, passen zu einer Totenklage, etwa „taka“, ‚wollen, wünschen, verlangen‘ in Verbindung mit „m’balam“, das nach dem Wort ‚mbali‘, ‚weit, entfernt‘ klingt, und „omba“, ‚bitten, beten, beschwören‘.
Dem Auftakt der „Totenklage“, der von einer hohen Dichte afrikanischen und anderen außereuropäischen Sprachmaterials gekennzeichnet ist, folgt eine Fortsetzung, die in ihrer Lautmalerei dem Deutschen alles in allem recht nahe steht. Das beginnt mit der Einführung eines deutschen Umlauts in „tru – ü“, setzt sich fort in der Anspielung auf den Schweizer Ort Auw unweit von Zürich und mündet in ein ausgedehntes Spiel mit den Silben „kla“, „o“, „au“ und „kling“, die, der Titel legt es nahe, als buchstäblich im Hals steckenbleibende ‚Klage‘, als Klage- und Schmerzlaute sowie als ebenfalls abbrechendes ‚klingen‘ interpretiert werden können. Nach einer kurzen Wiederaufnahme der afrikanischen Tonspur durch „omba“ geht das Gedicht in eine Passage über, deren Sprachigkeit weniger klar ist. Anklänge an deutsche Wörter finden sich allenfalls in „blagaga“ – einer Kombination von Morphemen, die Belanglosigkeit bzw. Verrücktheit assoziieren – und gegen Ende in dem sechsmal wiederholten Morphem „bschi“, bevor die Klage zum Schluss in ein Jandl’sches ‚ogottogottogott‘ überzugehen scheint. Anders als in Ernst Jandls berühmtem Gedicht aber hat dieser Schluss nach meinem Dafürhalten nichts Komisches an sich. Im Gegenteil scheint sich mir hier der Gestus der im Hals steckengebliebenen Klage in affektiv verstärktem Modus zu wiederholen. Die Reduktion der immerhin noch gut assoziierbaren Morpheme auf ein phonemisches Minimum signalisiert, ja, verkörpert Zorn und Verzweiflung. Dieser Rückgang auf die affektive Ebene – erklärtermaßen ging es BallBall, Hugo ja bei seiner „Buchstaben-Alchimie“, um die „emotional[e] Zeichnung“ – ist es letztlich, der auch die sprachübergreifende Struktur des Gedichts motiviert: Die sprachliche Reduktion des Einzelsprachlichen angesichts überwältigenden Affekts erzeugt eine gewisse Übergängigkeit zwischen den Sprachen – d.h., die Affektivität greift hier die Grundlagen der Einzelsprachigkeit selbst an. Es geht insofern vielleicht weniger um die Umsetzung einer primitivistischen Poetik, sondern eher um den Appell an vorsprachlich oder protosprachliche Gemeinschaft und Spiritualität.15
In seiner kulturpolitischen Schlagrichtung unterscheidet sich BallBall, Hugos Gedicht so von den bisher betrachteten Texten. Auch hier geht es zwar um die Aktivierung der Triebkräfte sprachlicher Kreativität, aber der Text ist zugleich sehr viel mehr ‚Ausdruck‘, wenn auch nicht-semantisierter: Er versucht nicht nur, den Affekthaushalt der Rezipienten freizusetzen bzw. zu befreien, sondern appelliert zugleich an bestimmte Affekte, die wiederum in vor-sprachige Sprache gefasst werden sollen. Diese konkrete Orientierung auf ein neues Ziel hin, die sich ihren Konsequenzen nicht, wie bei HuelsenbeckHuelsenbeck, Richard, durch den Rückzug in den Unsinn verweigert, ist vielleicht auch allgemein ein Moment, in dem sich BallBall, Hugo von seinen Mitstreitern, von deren Aktivitäten er sich ja auch schon kurze Zeit später distanzierte, unterscheidet.
4 Dada als Kulturpolitik
Alles in allem scheinen für die Kulturpolitik von Dada folgende Punkte entscheidend zu sein – unter der Voraussetzung, dass die hier in den Blick genommenen Texte einigermaßen repräsentativ sind: Erstens wehren sich die Texte gegen die Einschränkungen und die kulturpolitischen Konsequenzen von Einzel- und Muttersprachlichkeit und streben eine Aktivierung von Sprachkreativität an, die in den Bereich der dada-Muttersprachlichkeit zurückgeht. Dieses Streben richtet sich zweitens gegen die nicht nur für die Semantik der Muttersprache, sondern insbesondere auch für die kriegführenden Nationen charakteristische Ausblendung der Differenz zwischen triebhafter Selbstorganisation (nebst zugehöriger Gewalt und zugehörigem Leiden) und Zweckrationalität. In diesem Zusammenhang werden drittens unterschiedliche Formen literarischer Mehrsprachigkeit ausgetestet, die Sprachigkeiten kontrastieren, graduieren oder ganz auflösen.
Im Einzelnen bestehen klare Unterschiede zwischen den Texten: Das Simultangedicht bezieht sich sehr unmittelbar auf die Bigotterie des Militärs, relativiert durch klangliche Interferenzen zwischen den Sprachen die Eindeutigkeit der Sprachzuordnung und dekonstruiert so die Bedingungen der Möglichkeit von Kriegsbereitschaft. Mit anderen Techniken erreicht HuelsenbeckHuelsenbeck, Richards Gedicht eine ähnliche Verunsicherung der Sprachigkeiten, betreibt aber unter anderem durch die Nutzung von Afrikanismen eine primitivistische Verflachung der für die Moderne kennzeichnenden Kulturhierarchien, die allerdings ihrerseits in den Unsinn zurückgenommen wird. Diese Selbstrelativierung im Zeichen des Unsinns fehlt wiederum bei BallBall, Hugo, dessen Poetik des Lautgedichts, wie gesehen, zwar auf einen ‚Rückzug‘ ausgerichtet ist, aber gerade darin an eine konkretere, bestimmte Affektstruktur appelliert.1
BallBall, Hugo ist wahrscheinlich derjenige Vertreter des Dada, der noch am ehesten mit einer positiven Form von Kulturpolitik in Verbindung gebracht werden könnte – also mit konkreten Zielen und Programmen, denen sich die anderen konsequent verweigern. Von Beginn an gibt es diesen Kontrast zwischen BallBall, Hugo und den übrigen Mitgliedern des Zürcher Dada, die in ihrer Abwehrhaltung gegenüber jeder Form von Pathos und Bedeutsamkeitsgesten weitergehen und sich klarer gegen jegliche kulturpolitische Hypostasierung von Signifikanz stellen. Damit soll der in der Forschung verbreiteten Tendenz, das Alleinstellungsmerkmal von Dada gegenüber anderen Avantgarden in der absoluten Gegnerschaft zu Kunst und Kultur zu sehen und dem Dada so kulturpolitischen Nihilismus zu unterstellen, nicht das Wort geredet sein.2 Die konstruktive Dimension des Dada, wie sie beispielsweise auch HuelsenbeckHuelsenbeck, Richards, TzaraTzara, Tristans und JancoJanco, Marcels Schaffen prägt, sollte man nicht unterschlagen – immerhin geht es allen diesen Künstlern um die Entzündung von Kreativität.3 Dennoch muss man sehen, dass Dada zugleich ostentativ darauf verzichtet, kulturpolitische Konsequenzen aus dem eigenen Tun und Schaffen abzuleiten. So hat die Freisetzung sprachlicher Kreativität bei HuelsenbeckHuelsenbeck, Richard, TzaraTzara, Tristan und anderen zwar durchaus eine Form des ‚ursprünglicheren‘ Umgangs mit Sprache zum Ziel, dies aber entspringt weder – und hier bin ich bei BallBall, Hugo dann nicht so sicher – dem Wunsch nach kultureller Regression, noch lässt es sich in irgendeine Form von Ursprünglichkeitspathos übersetzen. Was die Autoren des Dada vermeiden wollen, ist, dass aus den qua Dada erweckten Affekten und der ihnen inhärenten Kreativität konkrete Kulturpolitik abgeleitet wird, wie das beispielsweise für viele Formen des Expressionismus der Fall gewesen ist. Dem verweigert man sich – und darin besteht der vierte und wichtigste Punkt von Dada als Kulturpolitik: Man will zwar Affekte erzeugen, diese aber, anders, als das gerade im Namen des Muttersprachennarrativs geschieht, weder nutzen noch mit ihnen identifiziert werden. Dada will die Kreativität, verzichtet aber auf kulturpolitische Konsequenz. Wenn es Dada um die Provokation von Affekten geht und dazu auf Bereiche jenseits von Sprachigkeit zugegriffen wird, dann ist die eigentliche Pointe aber doch die, dass zugleich programmatisch ausgeschlossen wird, dass daraus etwas folgen könnte.
Vielleicht liegt darin zumindest der Ansatz einer Erklärung für die Tatsache, dass die jeweiligen Dada-Bewegungen so kurzlebig gewesen sind bzw. in Bewegungen aufgegangen sind, die ein sehr viel dezidierteres kulturpolitisches Programm vertreten haben – wie zum Beispiel der Surrealismus. Jedenfalls aber liegt in Dadas Verzicht auf kulturpolitische Konsequenz eine gewisse Parallele zu SaussureSaussure, Ferdinand de. Nicht nur war die Geste des Rückzugs und des Verzichts auf kultur- oder wissenschaftspolitische Konsequenz für SaussureSaussure, Ferdinand de als Person charakteristisch. Vielmehr scheint de SaussureSaussure, Ferdinand des Konzentration auf die Beschreibung der Grundmechanismen sprachlicher Kreativität ihn geradewegs in den wissenschaftlichen Vorruhestand geführt zu haben. Er konnte la langue zwar als kreativen und vielleicht sogar als potentiell mehr- oder vor-sprachigen Mechanismus denken, leitete daraus aber kein operationalisierbares Forschungsprogramm ab. Die langue-Linguistik hat genau dies getan – aber eben um den Preis einer Hypostasierung des Muttersprachlers mit all seinen kulturpolitischen Begleiterscheinungen. Es wäre zu diskutieren, ob die Ummünzung der Impulse, die Dada gegeben hat, in konkrete Kulturpolitik durch anschließende Avantgarden ähnliche Einseitigkeiten zur Folge gehabt hat.
„Viersprachig verbrüderte Lieder in entzweiter Zeit“. Mehrsprachigkeit und ihre affektive Dimension bei Rose Ausländer und Paul Celan
Jürgen Brokoff
1 Einleitende Bemerkung
Für die Reflexion von Elementen einer ‚Poetik der Mehrsprachigkeit‘ wäre neben der theoretischen Betrachtung des Zusammenhangs von Literatur und Mehrsprachigkeit und einer diesbezüglichen Begriffsbildung die Bedeutung historisch-politischer Konstellationen zu ermessen, in die literarische Mehrsprachigkeit eingebunden ist. Es geht dann um die Überlagerungen, Konkurrenzen und Verflechtungen mehrerer Sprachen, die ein gleichermaßen konflikthaftes wie produktives Potential zu entfalten vermögen. Das Nebeneinander, Gegeneinander und Ineinander der Sprachen bildet eine relationale Struktur. Diese spezifiziert sich zeitlich wie räumlich, letzteres vor allem in regionaler Hinsicht. Dabei sind Formen der Konkurrenz und des Konflikts zweier Sprachen in Grenzlagen (etwa in Kärnten oder im Elsass) von Gemengelagen mit mehr als zwei Sprachen zu unterscheiden.
Mit Blick auf die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts sind hier unter anderem die sogenannte Prager deutsche Literatur bis zum Einmarsch der Nationalsozialisten 1939 und die Literatur deutschsprachiger Juden in der Bukowina bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs anzuführen. Bevor auf Texte von Rose AusländerAusländer, Rose und Paul CelanCelan, Paul eingegangen wird, die sich zumindest in Teilen in die Konstellation der Literatur der Bukowina und deren Struktur der Mehrsprachigkeit einfügen lassen, ist ein Zitat an den Anfang zu stellen, das dem Kontext der Literatur der deutschsprachigen Prager Juden entstammt. Der Schriftsteller und Sprachphilosoph Fritz MauthnerMauthner, Fritz (1849–1923), der als Sohn einer jüdischen Gelehrten- und Kaufmannsfamilie in Prag aufgewachsen ist und wichtige Werke zur Sprachkritik verfasst hat, schreibt 1918 in seinen Erinnerungen:
[M]ein Sprachgewissen, meine Sprachkritik wurde geschärft dadurch, daß ich nicht nur Deutsch, sondern auch Tschechisch und Hebräisch als die Sprachen meiner „Vorfahren“ zu betrachten, daß ich also die Leichen dreier Sprachen in meinen eigenen Worten mit mir herumzutragen hatte.1
MauthnerMauthner, Fritz differenziert hinsichtlich der Funktionen der drei Sprachen und weist diese als Soziolekte aus: „Deutsch als die Sprache der Beamten, der Bildung, der Dichtung“, „Tschechisch als die Sprache der Bauern und der Dienstmädchen“, „ein bißchen Hebräisch als die heilige Sprache des Alten Testaments“.2
An MauthnerMauthner, Fritzs Beschreibung fallen zwei Aspekte auf. Erstens, dass er die mitgeführten Sprachen „Leichen“ nennt. Sind sie, ließe sich fragen, eines natürlichen Todes gestorben oder gewaltsam zu Tode gekommen? Und zu Gunsten welcher anderen Sprache? Obwohl dies unklar bleibt, zeigt der Gebrauch des Wortes „Leiche“ eine affektiv aufgeladene Atmosphäre an, die mit dem in Prag am Ende des 19. Jahrhunderts stattfindenden „Sprachenstreit und Kulturkampf“3 zusammenhängt. MauthnerMauthner, Fritz schreibt im Jahr 1918, dass er „heute noch aufheulen“4 könnte, weil er auf einer vom Tschechischen umgebenen Sprachinsel des Deutschen und in der schwierigen Lage assimilationsbereiter Juden aufgewachsen sei, die aus kulturellen Gründen die deutsche Sprache gewählt haben. Er sei ohne die „Kraft und die Schönheit einer Mundart“5 groß geworden. So formuliert kein neutraler Beobachter, sondern ein von „Sprachenstreit und Kulturkampf“ affizierter Teilnehmer. In anderem Zusammenhang spricht Michail BachtinBachtin, Michail später in seiner an der Dialogizität orientierten Poetik der Sprachen-, Stimmen- und Redevielfalt von der „dialogisch erregte[n] und gespannte[n] Sphäre der fremden Wörter“6 und betont ebenfalls die affektive Dimension der Polyphonie.
Zweitens ist an MauthnerMauthner, Fritzs Beschreibung auffällig, dass er die „Leichen“ der Sprachen Deutsch, Tschechisch und Hebräisch „in [s]einen eigenen Worten“ herumträgt. Es geht also um latent anwesende Formen von Mehrsprachigkeit. Der Hinweis auf die in den Worten ‚leichenhaft‘ verborgene Mehrsprachigkeit bezieht sich erkennbar nicht auf manifeste Formen von Mehrsprachigkeit, wie sie etwa durch das abwechselnde Schreiben von Texten in verschiedenen Sprachen (‚Sprachwechsel‘), durch das situative Umschalten zwischen verschiedenen Sprachen (code switching) oder durch die Integration fremdsprachiger Elemente in die zugrunde gelegte Sprache (‚Anderssprachigkeit‘) entstehen.7 Vielmehr lässt sich annehmen, dass damit subkutane, unsichtbare, implizite Formen einer in sich mehrsprachig verfassten Sprache gemeint sind. Mit dieser in sich mehrsprachig verfassten Sprache kommen Literatur und Poesie ins Spiel. Zwei Zitate von Autoren der Gegenwartsliteratur, deren Werke aus den Kontexten der rumäniendeutschen Literatur erwachsen sind, mögen dies verdeutlichen. Die Schriftstellerin Herta MüllerMüller, Herta, die ihre Texte von Beginn an auf Deutsch verfasst, hat darauf hingewiesen, dass in diesen deutschsprachigen Texten das Rumänische „mitschreibe“:
Ich habe in meinen Büchern noch keinen Satz auf Rumänisch geschrieben. Aber selbstverständlich schreibt das Rumänische immer mit, weil es mir in den Blick hineingewachsen ist.8
Diese Formulierung lässt sich mit einer Denkfigur von AusländerAusländer, Rose in Beziehung setzen, derzufolge die Sprache das federführende Subjekt ist und nicht ein Individuum, das die Sprache als Mittel zum Zweck benutzt.9
Eine ‚Poetik der Mehrsprachigkeit‘, die aufgrund der vielfältig beteiligten Sprachen in sich plural ist, lässt sich, zweitens, an einem Zitat aus Oskar PastiorsPastior, Oskar Poetikvorlesung Das Unding an sich von 1994 verdeutlichen. Auch hier geht es um implizite Mehrsprachigkeit, die – wenngleich nur in ‚Spurenelementen‘ nachweisbar – Bedingung des literarischen Schreibens ist:
Warum nicht […] die Schiene der Einsprachigkeit durchbrechen? Warum eigentlich nicht bedenkenlos und ohne Rücksicht auf die Philologen diese eingefahrene und, weil man doch mehr im Kopf hat, immer auch zensierende literarische Gewohnheit lyrisch beiseiteschieben und alle biographisch angeschwemmten Brocken und Kenntnisse anderer Sprachen, und seien es auch nur Spurenelemente, einmal quasi gleichzeitig herauslassen? Konkret, wie ich zu sagen pflege: die siebenbürgisch-sächsische Mundart der Großeltern; das leicht archaische Neuhochdeutsch der Eltern; das Rumänisch der Straße und der Behörden; ein bissel Ungarisch; primitives Lagerrussisch; Reste von Schullatein, Pharmagriechisch, Uni-Mittel- und Althochdeutsch; angelesenes Französisch, Englisch … alles vor einem mittleren indoeuropäischen Ohr … […].10
Die affektive Qualität dieser Poetik ist im Durchbrechen der Routinen und Gewohnheiten von Einsprachigkeit zu erkennen, also in einer kämpferischen Sprachgeste, die durchaus gewaltsame Züge besitzt. Pastior stellt sich damit in eine Tradition, die etwa die Mehrsprachigkeit literarischer Übersetzungen als das Aufbrechen der Grenzen von Einsprachigkeit versteht. So heißt es in Walter BenjaminsBenjamin, Walter berühmter Abhandlung Die Aufgabe des Übersetzers von 1923, dass der Übersetzer die „morschen Schranken der eigenen Sprache bricht“11 und deren Grenzen dadurch erweitert.
Gemessen an der forcierten Experimentalästhetik eines PastiorPastior, Oskar, der im Gedichtband Mein Chlebnikov die russische und deutsche Sprache vereint, dessen Gedichte in den 1980er Jahren verborgene rumänische Sprachsplitter als Form der Ideologiekritik an der Ceaușescu-Diktatur einsetzen, und der in seinem Gesamtwerk ein Pluriversum schwirrender Mehrsprachigkeit evoziert und in Szene setzt, nehmen sich die Texte der Lyrikerin Rose AusländerAusländer, Rose vergleichsweise traditionell aus. Aber hier soll es auch nicht um die Suche nach möglichst avancierten Formen von Mehrsprachigkeit gehen, sondern um die Erkundung der Grundlagen von Mehrsprachigkeit in literarischen Texten einer bestimmten historisch-politischen und kulturellen Konstellation. Von hier aus lässt sich, bei allen sonstigen Unterschieden, eine Verbindung zwischen der Lyrik von AusländerAusländer, Rose und CelanCelan, Paul herstellen.