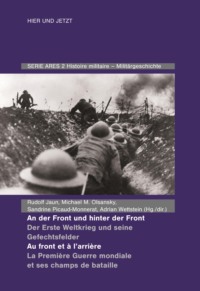Kitabı oku: «An der Front und Hinter der Front - Au front et à l'arrière», sayfa 5
Aussereuropäische Mächte greifen ein
Die Mobilisierung aussereuropäischer Ressourcen war ein Aspekt des Weltkriegs. Mindestens ebenso wichtig war aber das Eingreifen von Mächten ausserhalb Europas. Da war zunächst einmal das Japanische Kaiserreich. Am 23. August 1914 erklärte die japanische Regierung dem Deutschen Reich den Krieg. Seit dem Jahr 1902 war man mit Grossbritannien verbündet. Doch der japanischen Regierung ging es weniger darum, den Bündnisverpflichtungen nachzukommen, als vielmehr den Krieg in Europa zu weiterer Expansion in Ostasien zu nutzen. Erstes Angriffsziel war die deutsche Kolonie in China, Tsingtau. Am 2. September 1914 griffen japanische Truppen mit britischer Unterstützung an. Die deutschen Verteidiger wehrten sich heftig, was ihnen die Achtung ihrer Gegner einbrachte. Doch abgeschnitten von jeglichem Nachschub, mussten die Deutschen am 7. November kapitulieren. Unterdessen besetzten japanische Soldaten kampflos einen grossen Teil der deutschen Pazifikinseln. Darunter waren auch die Karolinen und das dort gelegene Atoll Truk, welches im Zweiten Weltkrieg eine der wichtigsten Basen der japanischen Flotte im Pazifischen Ozean wurde.
Zum Jahresende 1914 waren die Kämpfe für die Japaner bereits vorbei. Die Verluste betrugen nur 2000 Mann. Doch die expansionistische Politik wurde nun gegen China fortgesetzt. Im Januar 1915 präsentierten Premierminister Okuma und Aussenminister Kato der chinesischen Regierung die berüchtigten «Einundzwanzig Forderungen», welche darauf hinausliefen, China zu einer Art japanischem Protektorat zu degradieren. Die japanische Regierung spekulierte darauf, dass die anderen Grossmächte wegen des Kriegs in Europa diesen Coup hinnehmen würden, was sich aber als Irrtum erwies. Die britische und vor allem die US-amerikanische Regierung intervenierten und erzwangen ein Einlenken der japanischen Regierung. Nach dem Scheitern ihrer Pläne mussten Okuma und Kato zurücktreten. Dies war der Beginn jener Spannungen zwischen Japan und den angelsächsischen Grossmächten, die später in den Zweiten Weltkrieg münden sollten.
Japan war zwar nur am Rand am Ersten Weltkrieg beteiligt, doch waren die wirtschaftlichen Auswirkungen gravierend. Das traditionell eher arme Land erlebte durch den Krieg einen regelrechten Boom. Japanische Exporte eroberten die von Europäern verlassenen Märkte und versorgten die Verbündeten. Die Industrialisierung Japans schritt nun schneller voran. Nicht nur die grossen Familien profitierten, sondern auch die Mittelschicht wuchs. Aber der Boom schlug bald in Spekulation, Korruption und Inflation um. Die Reallöhne der Arbeiter sanken. Bis zum Sommer 1918 verdoppelte sich der Preis für Reis. Es kam zu schweren Unruhen, die vom Militär brutal niedergeschlagen wurden. Das Beispiel Japans zeigt, welche enormen Konsequenzen der Weltkrieg auch für relativ periphere Staaten besass.27
Das Osmanische Reich war im Ersten Weltkrieg alles andere als peripher. Es war sogar eine besonders wichtige Macht in diesem Krieg. Die Gründe, welche Kriegsminister Enver Pascha und den inneren Zirkel der Jungtürken zum Kriegseintritt an der Seite der Mittelmächte bewegten, waren komplex. Vor allem aber fürchteten sie, dass das Reich unter den Siegermächten aufgeteilt werden würde, wenn man neutral blieb. Die Arroganz und Kurzsichtigkeit der britischen, französischen und russischen Politik taten ein Übriges. Militärisch verlief der Krieg für die Osmanen zunächst miserabel. Im Winter 1915 endete eine Offensive im Kaukasus in einer Katastrophe. Als russische Truppen bei ihrer Gegenoffensive von Armeniern besiedeltes osmanisches Territorium betraten, wurden sie zum Teil begeistert als Befreier empfangen. Aus der Sicht der Jungtürken war dies der endgültige Beweis für die Illoyalität der christlichen Armenier. So wurde die «Evakuierung» der armenischen Bevölkerung in die syrische Wüste befohlen. Über eine Million Menschen wurden dabei ermordet, verhungerten oder starben auf Todesmärschen. Es handelte sich um den einzigen systematischen Völkermord des Ersten Weltkriegs.28
Der Völkermord an den Armeniern stand wie vorher schon der Massenmord an den Herero und Nama am Beginn eines Jahrhunderts der Genozide. Aber er war auch ein Rückgriff auf die osmanische Tradition der Massaker an unbotmässigen Völkerschaften. Auch deswegen sprach man in Europa schon lange vom «kranken Mann am Bosporus». Gleichwohl war es erstaunlich, dass dieses angeblich zerfallende Staatswesen fast vier Jahre eines beinahe totalen Kriegs durchhielt. Natürlich erhielten die Osmanen finanzielle, logistische, waffentechnologische, personelle und militärische Hilfe seitens der Mittelmächte. Doch dieser Umstand reicht nicht aus, um die Zähigkeit des Osmanischen Reiches in seinem letzten Krieg zu erklären. Auch die Forschung hat hierfür bislang kaum überzeugende Erklärungen gefunden.
Zweimal griffen osmanische Truppen den Suezkanal an, wenn auch erfolglos. Bei Gallipoli verteidigten osmanische Truppen mit Bravour die Meerengen gegen britische, australische und neuseeländische Truppen, die schliesslich unter hohen Verlusten abziehen mussten. Bei Kut-al-Amara in Mesopotamien besiegten die Osmanen im Frühjahr 1916 sogar eine britisch-indische Armee. Die Gefangenen wurden auf einen Todesmarsch geschickt. Inzwischen standen 800 000 osmanische Soldaten unter Waffen. Aber die Bevölkerung litt entsetzlich unter Hunger und Seuchen, die Desertionsraten in der Armee waren hoch. Nun wendete sich auch das militärische Blatt. Ab 1917 eroberten britische Truppen Palästina, Syrien und Mesopotamien. Die arabische Revolte tat ein Übriges, um die Osmanen endgültig aus diesem Teil des Nahen Ostens zu vertreiben. Das Osmanische Reich zerbrach, woran auch die Besetzung Bakus im Jahr 1918 nichts mehr ändern konnte. Doch wenigstens konnte der Held von Gallipoli, General Mustafa Kemal, später bekannt als Atatürk, die Einheit der Türkei vor den imperialistischen Aufteilungsplänen der Siegermächte retten.29
Der ganze Nahe Osten bis hinein nach Persien hatte in Flammen gestanden. Mindestens zwei Millionen Menschen fanden in dieser eher dünn besiedelten Region den Tod. Britische Repräsentanten vor Ort machten arabischen Nationalisten alle möglichen Versprechungen, während die Regierungen in Paris und London die Aufteilung des Nahen Ostens unter den Siegern planten. Obendrein versprach der britische Aussenminister Balfour im November 1917 den Zionisten eine Heimstätte in Palästina. Mit dem Ersten Weltkrieg begannen die Probleme des Nahen Ostens, die bis in die Gegenwart hinein weiterwirken.30
Der Kriegseintritt der USA am 4. April 1917, einem Karfreitag, brachte die entscheidende Wende im Ersten Weltkrieg. Die deutsche Oberste Heeresleitung hatte die Kriegserklärung der USA durch die Wiederaufnahme des unbeschränkten U-Boot-Kriegs in der irrigen Annahme provoziert, die USA würden auf dem europäischen Kriegsschauplatz militärisch keine ernsthafte Rolle spielen können. Das dummdreiste Zimmermann-Telegramm, welches Mexiko ein Bündnisangebot machen sollte und deutsche Hilfe bei der Rückeroberung der an die USA verlorenen Gebiete versprach, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. In einer Hinsicht waren die Einschätzungen der Obersten Heeresleitung jedoch richtig: Die USA waren schon längst nicht mehr wirklich neutral. Aufgrund der britischen Seeblockade war der deutsch-amerikanische Handelsaustausch auf 1 % des Vorkriegsniveaus gesunken. Stattdessen boomten die Exporte der USA zu den Alliierten. Produkte aller Art, gerade auch Agrarprodukte, fanden den Weg über den Atlantik. In den USA stieg die Eisen- und Stahlproduktion um 76 %. Gleichzeitig verschuldeten sich die Alliierten gegenüber den USA in exorbitanter Weise.31 Vor diesem Hintergrund wäre eine Niederlage der Alliierten für die USA einer wirtschaftlichen und finanziellen Katastrophe gleichgekommen. Selbst die vage Aussicht auf einen Kompromissfrieden wirkte abschreckend. Die Friedensinitiative von Präsident Woodrow Wilson löste im Dezember 1916 an der Wall Street einen Crash aus.

Türkische MG-Truppen bei Tel esh Sheria (Gaza-Stellung) im Jahr 1917. (Library of Congress)
Aber eine aktive Teilnahme am Weltkrieg war in den USA alles andere als populär. Im November 1916 errang Wilson seine Wiederwahl als Präsident mit dem Slogan: «He kept us out of war». Doch die Provokationen von deutscher Seite liessen ihm dann keine andere Möglichkeit, als in den Krieg einzugreifen. Allerdings vermieden die USA ein offenes Bündnis mit den Alliierten und traten nur als «Assoziierte Macht» in den Krieg ein.
Im Sommer 1917 landete General John J. Pershing mit einer kleinen Expeditionsarmee in Frankreich. Anschliessend besuchte er die Front. Was er dort sah, erschreckte ihn sehr. Die französischen und die britischen Truppen waren am Ende ihrer Kraft. Pershing verlangte deshalb von seiner Regierung die Entsendung von Millionen amerikanischer Soldaten nach Europa, und er bekam diese Männer. Dafür wurde in den USA die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Zudem mobilisierten neue Behörden die Wirtschaft für den Krieg. Massive Propaganda stimmte die Bevölkerung auf den Krieg ein. Gleichzeitig wurden die bürgerlichen Freiheiten rücksichtslos eingeschränkt und jegliche Opposition brutal eingeschüchtert. Es kam zu willkürlichen Verhaftungen und grotesken Verurteilungen. Die deutsche Minderheit sah sich extremen Repressalien ausgesetzt.32 Doch der Kriegseinsatz wurde trotz der 126 000 gefallenen Soldaten ein Erfolg. Die USA waren am Ende die einzige wirkliche Siegermacht und stiegen endgültig zur Weltmacht auf.33

Kolonialtruppen aus Französisch-Indochina beim Aussteigen im Lager Saint-Raphael. (Bibliothèque Nationale de France)
Kriegsschauplätze
Europa war zwischen 1914 und 1918 der Hauptkriegsschauplatz. Dort spielte sich vier Jahre lang ein erschütterndes Drama ab, das Millionen von toten und verwundeten Soldaten forderte. Schlachten, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte, welche teilweise Monate andauerten, wurden zum Kennzeichen des Kriegs in Europa. Doch darüber gerät allzu leicht in Vergessenheit, in welchem Ausmass und mit welch gravierenden Folgen auch in anderen Teilen der Welt gekämpft wurde. Schon die Kämpfe in Osteuropa gelten mitunter als «vergessene Front».34 Das trifft erst recht für die Kämpfe ausserhalb Europas zu. Dabei waren sie wichtig. Auf den Weltmeeren herrschte Krieg, was den internationalen Handel störte. Der amerikanische Kontinent blieb zwar von grösseren Kampfhandlungen verschont, ebenso wie weite Teile Asiens, Afrikas und Ozeaniens. Aber die indirekten Auswirkungen des Kriegs, vor allem wirtschaftlicher Natur, waren auch ausserhalb der unmittelbaren Kampfzonen massiv. Zudem wurden von dort Millionen von Soldaten und Arbeitern zu den Kriegsschauplätzen verschickt.
Letztere lagen eben nicht nur in Europa. Der ganze Nahe Osten stand in Brand. In Ostasien wurde zumindest kurzzeitig gekämpft. Zentralasien wurde durch den Aufstand von 1916 zum Schauplatz einer humanitären Tragödie. In Afrika dauerten die Kämpfe um die deutschen Kolonien zum Teil Jahre. Dies galt besonders für Ostafrika. Hier brach General Paul von Lettow-Vorbeck befehlswidrig einen harten Krieg vom Zaun, für den Hunderttausende von Afrikanern, vor allem als Träger und Arbeiter, von beiden Seiten zumeist zwangsrekrutiert wurden. Womöglich mehr als 300 000 Träger kamen auf den brutalen Märschen infolge schlechter Ernährung, Krankheiten und des ungesunden Klimas ums Leben. In manchen Regionen Ostafrikas starben bis zu zehn Prozent der Bevölkerung, sogar ausserhalb der Kampfzonen.35 Soldaten aus verschiedenen Kontinenten waren im Einsatz. Die Kämpfe dauerten bis Ende 1918 und verwüsteten weite Teile Deutsch-Ostafrikas, Nordrhodesiens und Mozambiques. Das war die grausame Realität hinter Lettow-Vorbecks «Heia Safari».36
Mit dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 waren die Kämpfe keineswegs beendet. Russland versank für Jahre in einem schauerlichen Bürgerkrieg, dem ein Krieg gegen das wiedererstarkte Polen folgte. Auch anderswo in Europa gab es Aufstände und Bürgerkriege. Im Nahen Osten folgten zum Teil massive militärische Auseinandersetzungen um das Erbe des Osmanischen Reiches. In Libyen wurde mit extremer Gewalt die im Weltkrieg geschwächte Kolonialherrschaft Italiens wiederhergestellt. Die Pariser Vorortverträge und der neu gegründete Völkerbund erwiesen sich als ungeeignet, eine dauerhafte Friedensordnung zu etablieren. Zwanzig Jahre später stand die Welt erneut in Flammen. Die Weltkriege des 20. Jahrhunderts waren ein hoher Preis für den Prozess der Globalisierung, welcher die Welt vernetzt hatte.
Fazit
Die Publikationen im Hinblick auf den hundertsten Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs haben eine Auseinandersetzung über die Ursachen dieses Kriegs ausgelöst, die in ihrer Heftigkeit schon fast an die Fischer-Debatte der 1960er-Jahre erinnert. Christopher Clark wollte in seinem Bestseller eigentlich nur der Frage nachgehen, wie Europa in diesen Krieg geriet. Die durch Polemik und Propaganda belastete Kriegsschuldfrage wollte er bewusst ausklammern.37 Doch das erwies sich letztlich als unmöglich, weil sich eben die Frage nach den Verantwortlichkeiten für Millionen von Toten dennoch stellt.38 Dabei nahmen die Entscheidungsprozesse im Sommer 1914 mitunter geradezu absurde Züge an.39 Doch die Entscheidungsträger handelten nicht in einem Vakuum. Vielmehr standen sie unter dem Druck struktureller Rahmenbedingungen, die man als langfristige Kriegsursachen begreifen kann. Die strukturellen, langfristigen Kriegsursachen gegeneinander abzuwägen ist eine äusserst schwierige Aufgabe, die hier nicht weiter verfolgt werden soll. Häufig werden in diesem Zusammenhang allerdings der Imperialismus, die Rivalität der europäischen Mächte in Übersee und die sich daraus entwickelnden Konkurrenzkämpfe erwähnt. Sicherlich spielte all dies in der internationalen Politik vor 1914 eine erhebliche Rolle. Doch im Licht der Forschung der letzten Jahre kann man wohl nicht davon sprechen, dass die Auseinandersetzungen um Kolonien und Märkte zu den entscheidenden Ursachen des Ersten Weltkriegs gehörten. Zwischen dem Deutschen Reich und Grossbritannien zeichnete sich sogar eine kolonialpolitische Annäherung ab.40
So lagen denn die Kriegsursachen primär in Europa. Doch angesichts der bereits weit vorangeschrittenen Globalisierung und der Effekte der europäischen Expansion konnte dieser Krieg nicht auf Europa beschränkt bleiben. Wie schon um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert resultierte ein allgemeiner Krieg in Europa zwangsläufig in einem Weltkrieg. Damit war dieser Krieg aber auch keineswegs mehr eine rein europäische Veranstaltung. Die Entwicklungen in Aussereuropa wirkten mittelbar und unmittelbar auf Europa zurück: politisch, wirtschaftlich, militärisch und auch kulturell. Letztlich veränderte dieser Krieg in zahlreichen Wechselwirkungen die Welt. Es war auch bezeichnend, dass nach jahrelangem entscheidungslosem Ringen, in dem sich Europa zugrunde richtete, es des Eingreifens einer aussereuropäischen Macht, nämlich der USA, bedurfte, um dem blutigen Treiben ein Ende zu setzen. Und es mag kein Zufall sein, dass gerade die Führungen jener Mächte, die es nicht schafften, diesen Krieg global zu führen, sondern primär regional fixiert blieben – also Russland, das Osmanische Reich, Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich –, zu den unmittelbaren Verlierern gehörten. Frankreich und vor allem die angelsächsischen Mächte mit ihrem direkten Zugang zum Weltmarkt waren hier in einer ungleich besseren Position.
Vor diesem Hintergrund und angesichts des begrüssenswerten Trends zu einer transnationalen Geschichtsschreibung ist eine auf Europa fixierte Historiografie des Ersten Weltkriegs nicht mehr adäquat. Sie war es eigentlich nie, denn dieser Krieg ist ohne seine globale Dimension gar nicht zu verstehen. Damit aber eröffnen sich neue Forschungsfelder und neue Kooperationsmöglichkeiten mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus vielen Teilen der Welt. Der Anfang ist gemacht, und die Zukunft verspricht noch viele neue Einsichten und Erkenntnisse zu liefern. Man darf darauf gespannt sein.
Wandel der Streitkräfte 1914–1918
Am 6. September 1916 landete auf dem Schreibtisch Franz Conrad von Hötzendorfs, des langjährigen Generalstabschefs Österreich-Ungarns, ein ausführlicher Bericht des Vertreters des Armee-Oberkommandos (AOK) der Habsburgermonarchie bei der deutschen Obersten Heeresleitung (OHL). Thema des Schreibens war der Sturz Erich von Falkenhayns als Chef der OHL. Alois Klepsch-Kloth von Roden versuchte aus all dem Tratsch, der ihm zugetragen wurde, ein Bild der Gründe für die Entlassung Falkenhayns zu formen. Vermutlich nahm Klepsch-Kloth an, beim AOK würde eine möglichst kritische Beurteilung des Geschassten gerne gelesen, hatte es doch immer wieder starke Spannungen zwischen Conrad und Falkenhayn gegeben, die nach dem Zerwürfnis über die Frage nach der Zukunft Montenegros in eine regelrechte Funkstille zwischen den Köpfen der verbündeten Armeeführungen gemündet hatten. Den Hinweis darauf, dass eklatantes Scheitern auf dem Feld militärischer Führung die missliche Kriegslage und damit letztlich den Sturz Falkenhayns herbeigeführt hätte, quittierte Conrad mit einer lakonischen Randbemerkung. Die ungünstige Kriegslage sei «Resultat des Kräfte-Missverhältnisses zwischen uns und unseren Gegnern.» Er schloss kurz und knapp: «C’est tout!»1
Es liegt nahe, in dieser Einschätzung aus der Feder Conrads auch eine Formel zu vermuten, die bei der Suche nach einer Entschuldigung für jene Rückschläge nützlich war, die Österreich-Ungarns Streitkräfte unter der Führung Conrads seit August 1914 immer wieder erlitten hatten. Die im Vergleich zum Gegner mangelhafte Ausstattung mit – angemessen ausgebildeten – Soldaten und mit Rüstungsmaterial gehörte denn auch nach 1918 bei Conrad und anderen Mitgliedern der früheren Militärelite zu den Standard-Topoi der Verteidigung. Der Beitrag von Martin Schmitz in diesem Band bietet Gelegenheit, die Rechtfertigungsstrategien dieser Kreise in der Zwischenkriegszeit näher kennenzulernen.2 Der Hinweis auf die Rüstungsdefizite und das strategische Ungleichgewicht bildete eine Waffe zur Verteidigung der eigenen Reputation, im Krieg selbst und noch darüber hinaus. Unberechtigt jedoch, das gilt es hier festzuhalten, war die Einschätzung keineswegs. Sie legte durchaus den Finger in die Wunde: Strategisch war die Lage der Mittelmächte eben von Beginn an ungünstig, und die weitere Entwicklung des Kriegs brachte nur kurzfristige Verbesserungen der Situation mit sich; kurzfristig nicht zuletzt deshalb, weil sich immer neue Gegner am Krieg beteiligten. Die Streitkräfte der Habsburgermonarchie standen damit bereits ab Herbst 1914 der Herausforderung gegenüber, sich trotz gravierender Rückschläge und gewaltiger Verluste an Material, an Mannschaften und nicht zuletzt an Offizieren in einem Mehrfrontenkrieg zu behaupten, auf den Truppe und Führung, aber auch Staat und Gesellschaft nur unzureichend vorbereitet waren. Von der Wirklichkeit des modernen Kriegs überrascht wurden auch die Gegner und Verbündeten der Donaumonarchie, aber die strategische Lage Österreich-Ungarns war besonders prekär und liess wenig Spielraum, um Fehler wettzumachen und Verluste auszugleichen. Insgesamt hatte die Militärführung Österreich-Ungarns immer wieder mit mangelnden Ressourcen zu kämpfen – mangelhaft vor allem im Hinblick darauf, dass zumindest bis zum Herbst 1917 die Lage an den Fronten prekär blieb, auch wenn bedeutende militärische Teilerfolge errungen worden waren. Und als nach Serbien und Rumänien auch Russland faktisch geschlagen und die Italiener bis zum Piave zurückgedrängt waren, reichten weder der Nachschub an Waffen, Munition und vor allem Nahrungsmitteln aus noch die Ersatzmannschaften, die die Lücken unter den Fronttruppen stopfen sollten.
Die letzte grosse Offensive am Piave zeigte dann deutlich, wie geschwächt die k. u. k. Armee bereits war. Schliesslich brach die Italien-Front im Herbst 1918 zusammen und die Armee zerfiel in oftmals von ethnisch-nationaler Identität bestimmte Teile. Nach dem Hinweis auf die Rüstungsmängel spielte denn auch vor allem die zentrifugale Kraft der Nationalismen eine entscheidende Rolle bei der Suche nach Erklärungen dafür, dass Österreich-Ungarn den Krieg verloren hatte. Die österreichische Variante der Dolchstosslegende sollte daher die mangelhafte Kohärenz der unterschiedlichen Nationen in den Streitkräften betonen – jenseits der Verratsrhetorik ehemaliger Offiziere, deren Entlastungsfunktion offenkundig ist, wirft die Geschichte der Streitkräfte in «Österreich-Ungarns letztem Krieg»3 die Frage auf, ob multinationale Armeen in der Moderne nicht grundsätzlich besonders verletzlich sind. So einfach, wie es die «kakanische» Variante der Dolchstosslegende suggeriert, lagen die Dinge dabei allerdings nicht. Das lässt sich gut am wichtigsten Belegstück dieser Denkschule zeigen, den Tschechen. Christian Reiter und Richard Lein haben detailliert nachgewiesen, dass von einer besonderen Unzuverlässigkeit tschechischer Soldaten keine Rede sein konnte. Führungsfehler oder schlechte Versorgung erklären die Fälle von Desertion, massenweiser Kapitulation oder Meuterei zumeist hinreichend. Nationale oder nationalistische Motive standen hingegen deutlich im Hintergrund, auch wenn der Mythos tschechischer Insubordination oder gar tschechischen Überläufertums als Massenphänomen sowohl der tschechischen Nationalbewegung als auch der Führung der k. u. k. Armee mehr als gelegen kam – aus entgegengesetzten Gründen, aber mit dem gleichen, die Erinnerungskultur lange prägenden Resultat.4 Rudolf Kucera hat allerdings auch konzise herausgearbeitet, dass die nationale Perspektive die Kriegserfahrung vieler tschechischer Soldaten doch immer stärker prägte, je länger der Krieg dauerte, je häufiger Diskriminierungserfahrungen wurden und natürlich auch je schlechter die Kriegslage erschien.5 Auch wenn es bei Soldaten aus den nichtprivilegierten Nationen der Doppelmonarchie immer wieder zu einzelnen Problemfällen kam, so blieben doch die Einsatzfähigkeit und der Gehorsam der Truppen über Jahre hinweg bemerkenswert stabil. Die Angst, die multiethnische Armee könnte rasch auseinanderbrechen, die mit dazu beigetragen hatte, 1914 den Krieg zu wagen, solange die Nationalisierung der Streitkräfte noch nicht weiter vorangeschritten war, erwies sich als unbegründet – zweifellos ein Fall von Ironie der Geschichte. Erst in der Schlussphase des Kriegs, als es auf eine erneute moralische wie materielle Mobilmachung anzukommen schien, erwies sich Österreich-Ungarn als vergleichsweise schwach, die Armee als nationalistischer Propaganda gegenüber zumindest teilweise anfällig. Mark Cornwall konnte jedoch zeigen, dass dieser Wandel eben wirklich erst sehr spät manifest wurde, trotz der antiösterreichischen Propagandakampagnen vor allem an der italienischen Front.6
Das ist umso bemerkenswerter, als die Versorgungslage sich im Laufe des Kriegs, vor allem aber seit Herbst 1917 dramatisch verschlechterte. Dies galt nicht nur für das Hinterland, wo vor allem in der österreichischen Reichshälfte der Hunger immer schärfere Formen annahm, sondern es betraf zunehmend auch die Truppen der Habsburgermonarchie. Weder die militärisch abgestützte Ausplünderung der Ukraine, mit der sich etwa Wolfram Dornik befasst hat, noch die konsequente und in Massen auch erfolgreiche Exklusivnutzung des besetzten Serbiens als Speisekammer der Armee, wie Jonathan Gumz gezeigt hat, boten hier ausreichende Abhilfe.7 In der letzten Kriegsphase wurden die Lebensmittel so stark rationiert, dass an der Südwestfront Kampftruppen in Gefahr gerieten zu verhungern. Dass sich solche Bedingungen auch auf die Schlagkraft und schliesslich auf die Kampfmoral auswirkten, ist nachvollziehbar. Die Zerfallserscheinungen der k. u. k. Armee gegen Kriegsende waren mit grosser Sicherheit nicht nur von der Ungewissheit über den Fortbestand des Imperiums und von der Politisierung ethnisch-nationaler Konflikte verursacht, sondern auch der Erschöpfung der mangelhaft ernährten, bekleideten und mit Waffen, Munition und Transportmitteln versorgten Truppe geschuldet. Als Begründung für die Niederlage eignete sich der Topos von der entscheidenden Wirkung der ethnisch-politischen Konfliktlinien in Heer und Imperium, und er wurde von ehemaligen Offizieren der k. u. k. Armee gerne bemüht, aber selbst in der offiziellen Kriegsgeschichtsschreibung bestand die Einsicht: «Der grösste Feind des guten Geistes im Heere war – das muss immer wieder betont werden – die wirtschaftliche Verelendung der Soldaten. […] Hunger, Mangel am Nötigsten auf allen Gebieten und Krankheiten unterschiedlichster Art öffneten nur zu leicht den erdenklichsten [sic] Einflüssen die Türe zu den Soldatenseelen.»8
Scheidet also die Schwächung durch nationalistische Strömungen als direkte Ursache für die vielen Rückschläge aus, die die k. u. k. Armee über den Gesamtverlauf des Kriegs hinweg erlitt, so harrt die Frage nach den Ursachen der gerade im Vergleich zum deutschen Verbündeten wenig erfolgreichen Kriegführung Österreich-Ungarn einer schlüssigen Antwort. Die ökonomischen Rahmenbedingungen, Probleme der zivilen Verwaltung oder die Koordinationsprobleme zwischen dem Königreich Ungarn und Österreich waren für die defizitäre Versorgungslage, die gegen Kriegsende in Teilen Österreichs und, wie erwähnt, selbst bei den Truppen an der Front katastrophale Züge annehmen konnte, in erster Linie verantwortlich. Die k. u. k. Armee und ihre Führung hatte darauf eher indirekten Einfluss, etwa im Hinblick auf die Anforderung von Arbeitskräften oder die Beanspruchung von Transportkapazitäten. Zur Erklärung der vielen militärischen Misserfolge vor dem letzten Kriegsjahr ist die Lebensmittelversorgung ohnehin nicht geeignet. Die Rüstungswirtschaft der Habsburgermonarchie wies Schwächen auf und konnte den Bedarf nicht immer decken. Dies galt in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht. Bei Kriegsbeginn fehlte es an Gewehren, bald gab es auch Engpässe beim Munitionsnachschub für die Artillerie, und vor allem in der Anfangsphase galt es, möglichst schnell zur Ausstattung der gegnerischen Truppen mit Feldgeschützen aufzuschliessen.9 Unter dem Zeitdruck des Kriegs wurde dem raschen Schliessen von Rüstungslücken der Vorzug vor technischen Innovationen gegeben, etwa bei der Wahl der Geschütze oder der Bereitstellung von leichten Maschinengewehren.10 Wie Christian Ortner gezeigt hat, liess sich allerdings relativ bald gerade die Geschütz- und Munitionsproduktion steigern. Die katastrophale Unterlegenheit bei der Bestückung der Verbände mit Feldartillerie, die zu Anfang vor allem an der Galizien-Front verheerende Folgen zeitigte, konnte behoben werden. Mit 2600 Geschützen rückte das Feldheer 1914 aus; Ende 1915 waren bereits über 4500 Geschütze vorhanden, davon allein 2300 im Südwesten; Ende 1916 waren es insgesamt 6200, bei Kriegsende sogar 8500 Geschütze. Auch die Ausstattung mit Maschinengewehren war von Beginn an gut und umfasste Ende 1915 2800 Stück. Erst die letzten eineinhalb Kriegsjahre führten dann wieder zu neuen Engpässen.11
Anders als im Fall der Lebensmittelversorgung bestand vor allem bei der Artillerierüstung auch schon in den ersten Kriegsmonaten ein gravierender Nachteil für die Operationsfähigkeit der k. u. k. Armee und nicht erst im letzten Kriegsjahr. Die Verantwortung für das Fehlen moderner Feldhaubitzen und die geringe Ausstattung mit Feldkanonen trugen keineswegs nur die sparsamen Politiker der Vorkriegszeit, sondern auch die Militärführung, die bei der Ressourcenallokation andere Prioritäten gesetzt hatte, die sich nicht zuletzt aus der Absicht erklären lassen, auf einen Krieg gegen Italien vorbereitet zu sein.12 Für das zweite, dritte und selbst für das vierte Kriegsjahr waren die so bereits vor 1914 angelegten Defizite der Artillerierüstung aber weniger entscheidend. Bei der Personalrüstung lagen die Dinge zwar anders, aber auch hier galt, dass zumindest bis zur Wehrreform 1912 den Politikern die Schuld für das geringe Kräfteaufgebot 1914 zugesprochen werden konnte – ganz im Sinn Conrads und der früheren Armeeelite urteilte Maximilian Ehnl in einem Ergänzungsheft zum offiziellen österreichischen Weltkriegswerk daher:
«Die zur Bewilligung des Rekrutenkontingents berufenen Volksvertretungen beider Reichshälften haben in unverantwortlicher Kurzsichtigkeit und Verständnislosigkeit nie die volle Ausnützung der Volkskraft auch schon im Frieden ermöglicht. Mit einem jährlichen Ersatz von 159 500 Mann für das k. u. k. Heer, von 7200 Mann für die bosnisch-herzegowinischen Truppen, von 24 717 Mann für die k. k. Landwehr und von 25 000 Mann für die k. u. Honvéd war an eine Erhöhung der Stände nicht zu denken; man musste froh sein, wenn das Bestehende erhalten und die für zeitgemässe Gestaltung notwendigen Neuaufstellungen an schwerer Feldartillerie und technischen Truppen durchgeführt werden konnten.»13
Die – durchaus zutreffend geschilderten – Folgen der verspätet einsetzenden und nicht sehr weitreichenden Verstärkung der Personalrüstung erwiesen sich in der Tat als schwerwiegende Belastung für die Kriegführung der Habsburgermonarchie, und zwar mindestens für die ersten drei Kriegsjahre. Allerdings waren die niedrigen Stände auch darauf zurückzuführen, dass sich Österreich-Ungarn bereits im Frieden verhältnismässig (zu) viele Verbände leistete.14 Dementsprechend wurden während des Kriegs im Vergleich zu Deutschland nur spät und in geringem Umfang neue Divisionen aufgestellt. Bei der relativ überdehnten Organisationsstruktur führte die geringe Anzahl ausgebildeter Rekruten auch dazu, dass Österreich-Ungarn über keine zweite Linie verfügte.15 Erst die Wehrreform von 1912 eröffnete überhaupt die Aussicht, auch mit einer so grossen Zahl von ausgebildeten Reserven rechnen zu können, dass sich schon bald die Frage nach einem entsprechenden Organisationsrahmen stellte. Conrad forderte denn auch die Schaffung einer Reservearmee. Bei den Planungen zeigte sich der Generalstab zurückhaltender als die zuständige 10. Abteilung des Kriegsministeriums, die bereits für 1915 die Aufstellung von Reservetruppen ins Gespräch brachte, während der Generalstab im Januar 1914 davon ausging, ab 1918/19 erste Feldformationen und ab 1925 voll ausgestaltete Reservedivisionen bereitstellen zu können.16 Noch nach den ersten Feldzügen, Anfang November 1914, regte der Kriegsminister an, aus Besatzungen der Donaubrückenköpfe zwei bis drei Reservekorps zu bilden. Conrad lehnte dies ab, weil es ihm «viel rationeller erschiene, alles, was wir an Offizieren und Mannschaften verfügbar hätten, in die bestehenden Formationen einzureihen, um diese auf möglichst hohem Stande zu erhalten und deren grosse, durch Gefechts- und Krankheitsverluste verursachte Abgänge zu decken.»17