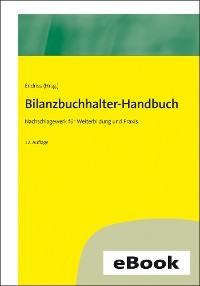Kitabı oku: «Bilanzbuchhalter-Handbuch», sayfa 11
§ 251 HGB
1538
1539Einzelunternehmen und Personengesellschaften dürfen die Haftungsverhältnisse in einem Betrag angeben. Die Verpflichtungen sind auch dann anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
1540Das Haftungsrisiko aus der Begebung und Übertragung von Wechseln ist anzugeben, und zwar das Gesamtobligo ohne Rücksicht auf die Bonität der Akzeptanten. Alle Wechsel, aus denen das Unternehmen als Aussteller oder Indossant haftet, sind einzubeziehen. Wertmäßig ist von den Wechselsummen ohne Nebenkosten auszugehen.
1541Die besondere Angabe des Wechselobligos gegenüber verbundenen Unternehmen kann schwierig werden, wenn nicht bekannt ist, ob der Wechsel sich am Bilanzstichtag noch in Händen des verbundenen Unternehmens befindet. Hier muss eine Abstimmung im Rahmen der Konsolidierung erfolgen.
1542Anzugeben sind alle Arten von Bürgschaften, wie Rück-, Nach-, Ausfall-, Kredit-, Mit-, Höchstbetrags-, Zeitbürgschaften ohne Rücksicht darauf, ob es sich um selbstschuldnerische Bürgschaften handelt oder nicht. Bürgschaften für eine zukünftige oder eine bedingte Verbindlichkeit (§ 765 Abs. 2 BGB) sind nicht angabepflichtig.
1543Angabepflichtig sind vertragliche Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen für eigene und für fremde Leistungen.
1544Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten können durch alle möglichen Pfandrechte und ähnliche Rechte gegeben werden. Häufig anzutreffen sind Grundpfandrechte, wie Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden (§§ 1113 ff. BGB) und Pfandrechte an beweglichen Sachen und Rechten (§§ 1204 ff. BGB) sowie der Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB). Angabepflichtig ist der Betrag der Hauptschuld am Bilanzstichtag.
1545Die aufgeführten Eventualverbindlichkeiten haben gemeinsam, dass
 | es sich um Haftungsverhältnisse für fremde Verbindlichkeiten handelt, | |||
 | diese erst dann auf den Bilanzierenden zukommen, wenn bestimmte Bedingungen eintreten, z. B. derjenige, für den die Bürgschaft übernommen wurde, zahlt nicht. | |||
1546Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften sind nicht angabepflichtig. Ebenfalls nicht angabepflichtig sind:
 | Haftungen kraft Gesetzes, z. B. aus Kfz-Haltung, aus Tierhaltung, für Betriebsunfälle usw. | |||
 | Haftungen und Bestellungen von Sicherheiten für eigene Verbindlichkeiten, z. B. Verpflichtungen zur Leistung von Vertragsstrafen, branchenübliche Garantiezusagen u. ä. | |||
 | Haftungen aus treuhänderischen Übereignungen. | |||
1547Der Ausweis muss so lange erfolgen, wie mit dem Eintritt der Bedingung gerechnet werden kann. Auch strittige Haftungsverhältnisse sind anzugeben (ADS, § 160 Rdn. 169). Angabepflichtig sind allein die am Bilanzstichtag bestehenden Haftungsverhältnisse.
1548Ist die Bedingung eingetreten, liegt keine Eventualverbindlichkeit mehr vor, sondern eine drohende Verpflichtung. Für drohende Verpflichtungen muss eine Rückstellung gebildet werden (§ 249 Abs. 1 HGB). Steht die Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis fest, wird die Verpflichtung als Verbindlichkeit passiviert. Eine Angabe im Anhang entfällt.
1549Eventualverbindlichkeiten sind auch dann anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen, d. h. wenn am Bilanzstichtag keinerlei Risiko erkennbar ist.
1550Publizitätspflichtige Gesellschaften, Kapitalgesellschaften und Genossenschaften müssen die Beträge jeweils gesondert nach den in § 251 HGB aufgeführten Kategorien ausweisen (§§ 268 Abs. 7 und 336 Abs. 2 HGB; § 5 Abs. 1 PublG). Sie müssen außerdem die gewährten Pfandrechte und sonstigen Sicherheiten für die vier Kategorien unter der Bilanz oder im Anhang gesondert angeben. Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind zusätzlich als „Davon-Posten” anzugeben (§ 268 Abs. 7 HGB).
1551In der Bilanz der mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften muss zu den einzelnen Verbindlichkeitspositionen gem. § 268 Abs. 5 Satz 1 i. V. mit § 266 Abs. 3 HGB jeweils der Betrag der darin enthaltenen Verbindlichkeiten angegeben werden, deren Laufzeit bis zu einem Jahr beträgt. Diese Aufgliederung wird im Anhang ergänzt durch die Angabe des Gesamtbetrags der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sowie des Gesamtbetrags der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte, Eigentumsvorbehalte oder sonstige branchenübliche Sicherheiten gesichert sind. Dabei sind Art und Form der Sicherheiten anzugeben (§ 285 Nr. 1 HGB). Kleine Kapitalgesellschaften sind von der Aufgliederung der Verbindlichkeiten befreit (§ 288 HGB), mittelgroße Kapitalgesellschaften brauchen die Aufgliederung nicht offenzulegen (§ 327 HGB). Anzugeben ist jeweils die verbleibende Restlaufzeit. Wenn die Tilgung in Raten über einen längeren Zeitraum erfolgt, muss die Verbindlichkeit in Teilbeträge aufgeteilt werden.
1552Kapitalgesellschaften müssen den Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, im Anhang angeben, sofern diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist. Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind als „Davon-Posten” gesondert anzugeben (§ 285 Nr. 3a HGB). Die Angabe soll das sich aus Bilanz bzw. GuV ergebende Bild ergänzen bzw. korrigieren.
1553Sonstige finanzielle Verpflichtungen sind z. B.:
 | mehrjährige Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen, | |||
 | Verpflichtungen aus begonnenen Investitionsvorhaben, | |||
 | aus künftigen Großreparaturen, | |||
 | aus notwendig werdenden Umweltschutzmaßnahmen, | |||
 | Verpflichtungen aus Vertragsstrafen, | |||
 | Verpflichtungen zur Leistung noch ausstehender GmbH-Anteile (§§ 19 ff. GmbHG). | |||
1554Außerdem können
 | die Delkrederehaftung des Kommissionärs (§ 394 HGB), | |||
 | die Haftung aus Konsortialgeschäften, | |||
 | die Haftung für ein unwiderrufliches Bankakkreditiv, | |||
 | die Haftung bei der Übernahme fremden Vermögens oder bei Erwerb eines Unternehmens (§ 75 AO) | |||
im Einzelfall einen Vermerk im Anhang erforderlich machen.
1555Anzugeben sind nur Verpflichtungen, die finanzieller Natur sind und zu Belastungen des Bilanzgewinns führen. Dabei handelt es sich um konkrete, unausweichliche zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die allein wegen eines Passivierungsverbots oder eines Passivierungswahlrechts nicht passiviert worden sind, jedoch die derzeitige Finanzlage des bilanzierenden Unternehmens verändern oder den finanziellen Spielraum für die Zukunft einschränken.
1556Beispiele für sonstige finanzielle Verpflichtungen, die aufgrund eines Passivierungsverbots nicht in der Bilanz erscheinen, sind Aufwandsrückstellungen, die über den Umfang des § 249 Abs. 1 HGB hinausgehen und nicht rückstellungsfähige Verluste aus zukünftigen Geschäften, denen sich das Unternehmen nicht entziehen kann. Beispiel für Angaben aufgrund eines Passivierungswahlrechts sind Pensionszusagen (Altzusagen gemäß Art. 28 EGHGB).
1557Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen muss unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nur dann angegeben werden, wenn die Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers müssen nur die mehrjährigen Verpflichtungen angegeben werden. Kleine Kapitalgesellschaften sind von der Angabe befreit (§ 288 HGB). Für mittelgroße Kapitalgesellschaften sieht das Gesetz keine Erleichterung vor.
1558Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung umfassen auch die Rechnungslegung der Haftungsverhältnisse. Auf sie treffen insbesondere der Grundsatz der Vollständigkeit (§ 246 Abs. 1 HGB) und die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB zu. Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse (§§ 251 und 268 Abs. 7 HGB) sind also systematisch aufzuzeichnen, es besteht Inventarisierungspflicht. Hierzu bedarf es einer Einzelaufgliederung und des Einzelnachweises durch geeignete Unterlagen.
1559Das Vollständigkeitsgebot wird bei den Haftungsverhältnissen eingeschränkt durch den Grundsatz der Wesentlichkeit. Unbedeutende oder verkehrs- bzw. branchenübliche Haftungsverhältnisse, wie gesetzliche Haftpflichten, gesetzliche Pfandrechte, Haftung aufgrund steuerlicher Vorschriften, branchenübliche Eigentumsvorbehalte u. ä., sind nicht vermerk- oder angabepflichtig.
1560Eventualverbindlichkeiten werden in der Praxis nur selten buchmäßig erfasst. Das Wechselobligo bildet dabei wegen der Eintragungen in das Wechselkopierbuch eine Ausnahme. Der Nachweis von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen und eventueller Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten kann aus den sonstigen Unterlagen und Verträgen erbracht werden, wie Satzung oder Gesellschaftsvertrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Beschlüsse der Gesellschaftsorgane, Kredit- und Prozessakten, Grundbuchauszüge und Saldenbestätigungen.
1561Wegen der Ausweispflicht empfiehlt es sich, zumindest Bürgschaften schon während des Geschäftsjahres auch buchhalterisch zu erfassen, wenn solche Fälle im gegebenen Unternehmen oft vorkommen.
1562 1562 Die A-GmbH übernimmt für ihren Kunden B (Hauptschuldner) eine Bürgschaft für einen Kredit von 100 000 € gegenüber der C-OHG (Gläubiger). Die GmbH bucht:
| a) | bei Begründung der Bürgschaft: | |||

| Hauptschuldner und Gläubiger nehmen bei der Begründung der Bürgschaft keine Buchung vor. | ||||
| b) | wenn die Bürgschaft erlischt: | |||

| c) | Im Falle der Inanspruchnahme durch die Bürgschaftsgläubigerin C-OHG wird aus der Bürgschaftsforderung eine echte Rückgriffsforderung. | |||
| Buchung: | ||||

| Die Bürgschaftsforderung wird am Jahresende aktiviert: | ||||

1563Besteht das Haftungsverhältnis noch zum Geschäftsjahresschluss, eine Inanspruchnahme ist jedoch nicht zu erwarten, ist lediglich ein Vermerk oder im Anhang erforderlich. Die Konten können zum Schlussbilanzkonto abgeschlossen werden.
1564 1564

1565Im Folgejahr können die Konten wieder entsprechend eröffnet werden.
1566Kapitalgesellschaften können die Angaben derzeit noch wahlweise unter der Bilanz oder im Anhang machen (§ 268 Abs. 7 HGB). Gem. § 268 Abs. 7 HGB i. d. F. des BilRUG sind die im Rahmen des § 251 HGB erforderlichen Angaben für Geschäftsjahre beginnend ab 2016 stets im Anhang zu machen.
1567Da § 265 Abs. 2 Satz 1 HGB sich allein auf Posten der Bilanz bezieht, nicht aber auf Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, ist die Angabe von Vorjahreswerten nicht vorgeschrieben.
1568Der Ausweis muss sich am Grundsatz der Stetigkeit bei den angewandten Bewertungsmethoden (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) orientieren und mit eindeutigen Bezeichnungen erfolgen.
1569 1569
Angaben im Anhang:
| k) | Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen | |||
Zum 31. 12. 01 bestanden die folgenden Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB:

Außerdem bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sowie Investitionsvorhaben und künftigen Großreparaturen in folgender Höhe:

1701Zum Zwecke der periodengerechten Abgrenzung des Jahresergebnisses werden transitorische Posten, antizipative Posten und Rückstellungen gebildet:
ABB. 21: Posten zur zeitlichen Abgrenzung

1702Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sind erfolgsmäßig dem Wirtschaftsjahr zuzuordnen, in dem sie wirtschaftlich verursacht worden sind. Im Jahresabschluss wird das Ergebnis der Abrechnungsperiode (Geschäftsjahr) ermittelt. Wie die Abschreibungen und die Rückstellungen haben die Rechnungsabgrenzungsposten die Funktion der zeitlich richtigen Erfolgsermittlung (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB; § 5 Abs. 5 EStG).
1703Transitorische Rechnungsabgrenzungsposten liegen vor, wenn die drei folgenden Kriterien erfüllt sind:
 | Es handelt sich um Einnahmen oder Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (R 5.6 Abs. 1 EStR). | |||
 | Die Einnahmen oder Ausgaben wirken sich erst nach dem Abschlussstichtag erfolgswirksam (als Aufwand oder Ertrag) aus (R 5.6 Abs. 1 EStR). | |||
 | Der Erfolg (Aufwand oder Ertrag) muss eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag betreffen (R 5.6 Abs. 2 EStR). | |||
1704 1704 Werbeaufwendungen können nicht abgegrenzt werden, weil sie nicht einem Werbeerfolg für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag zugerechnet werden können. Schaukästen, Werbefilme usw. sind zu aktivieren und über die Zeit der Nutzung abzuschreiben.
1705Nach der Rechtsprechung des BFH stellen Rechnungsabgrenzungsposten keine Wirtschaftsgüter, sondern Posten der Aufwands- und Ertragsverteilung dar. Sie scheiden deshalb für eine Bewertung nach § 6 EStG aus, d. h. Teilwertabschreibungen kommen nicht in Betracht.
1706Typische Fälle transitorischer Posten sind im voraus gezahlte bzw. erhaltene Mieten, Zinsen, Honorare, Beiträge, Gebühren, Versicherungsprämien, Provisionen, Kraftfahrzeugsteuer, Abfindungen, Entschädigungen u. ä.
1707Aktiv abzugrenzen sind ferner
 | vor dem Bilanzstichtag gezahlte Vermittlungsgebühren für Leistungen nach dem Bilanzstichtag, | |||
 | Diskontspesen und Diskontzinsen auf Akzepte, soweit die Laufzeit des Wechsels über den Bilanzstichtag hinausgeht, | |||
 | Mietvorauszahlungen einschließlich Vormieten bei degressiven Leasingraten beim Leasingnehmer. | |||
1708Im Fall der Abschlussgebühren einer Bausparkasse hat der BFH im Urteil vom 11. 2. 1998 entschieden, dass kein RAP-Posten zu bilden ist. Die Bausparkasse hatte die Erträge aus den Abschlussgebühren des Sparvertrags auf die Laufzeit des Vertrags per passiver Abgrenzung verteilt. Das Gericht sah aber eine ökonomische Zuordnung in voller Höhe im Jahr der Vereinnahmung der Gebühr an, da sie tatsächlich etwa der Abschlussprovision des Vertreters entsprach, die ja auch einmaliger Aufwand im Jahr des Vertragsabschlusses war. Dagegen werden bei Wartungsverträgen Abgrenzungen vorgenommen, wenn z. B. die Wartungsfirma einen Einmalbetrag erhalten hat und dafür verpflichtet ist, in einem bestimmten Zeitraum der Zukunft Wartungsarbeiten durchzuführen, sofern sie anfallen. Daran ändert die Tatsache nichts, dass ggf. Material- und Arbeitskosten der tatsächlichen Arbeitseinsätze extra vergütet werden.
1709Der steuerliche Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten unterscheidet sich vom handelsrechtlichen im Grundsatz nicht (vgl. § 250 Abs. 1 und 2 HGB versus § 5 Abs. 5 Satz 1 EStG).
Gem. § 250 Abs. 3 HGB darf ein Disagio/Damnum auf die Laufzeit des Darlehens mithilfe eines aktiven RAP abgegrenzt werden (wobei die Verteilung nicht festgelegt ist, also linear aber auch in ungleichen Beträgen oder degressiv/digital erfolgen könnte). Im Steuerrecht gibt es eine derartige Sonderregelung nicht: dort gilt der Grundsatz des § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG, nach dem in einem solchen Fall ein aktiver RAP gebildet werden muss.
Darüber hinaus enthält § 5 Abs. 5 Satz 2 EStG zwei Sonderregelungen, die nach dem BilMoG in der jetzigen Fassung des HGB nicht mehr enthalten sind: gem. § 5 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 EStG müssen als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern aktiv abgegrenzt werden, soweit sie auf am Abschlussstichtag noch auf Lager befindliche Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens entfallen.
Die A-AG handelt mit Spirituosen. Für die noch auf Lager liegende Ware wurde bereits vor dem Abschlussstichtag die Alkopop-Steuer bezahlt und als Aufwand gebucht.
Lösung:
Die Steuer ist aktiv abzugrenzen, da sie Vertriebskosten des Folgejahres darstellt. Denn dort wird die Ware ja verkauft.
Außerdem ist ein aktiver RAP für als Aufwand berücksichtigte USt auf Anzahlungen auszuweisen (§ 5 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 EStG).
Die A-AG hat vom Kunden eine Anzahlung auf eine im Folgejahr auszuführende Leistung i. H. v. 100 000 € zzgl. 19 % USt erhalten.
Lösung:
Handelsrechtlich müsste lediglich gebucht werden:
Geldkonto 119 000 € an erhaltene Anzahlungen (Verbindlichkeit, die handelsrechtlich zum Erfüllungsbetrag auszuweisen ist) 100 000 € und USt 19 000 €.
Steuerrechtlich dagegen müsste gebucht werden:
Geldkonto 119 000 € an erhaltene Anzahlungen 119 000 € (Ausweis der Verbindlichkeit zum Nennbetrag), aktiver RAP 19 000 € an USt 19 000 € (§ 5 Abs 5 Satz 2 Nr. 2 EStG).
Im Folgejahr müsste der aktive RAP dann bei Erfüllung der Leistung aufgelöst werden.
In der Praxis wird – entgegen der Gesetzeslage – die steuerliche Variante kaum beachtet; es wird meist handelsrechtlich gebucht.
1710Die transitorischen Posten können buchungstechnisch unterschiedlich erfasst werden:
| a) | Sie können sofort im Zeitpunkt des Zahlungsvorgangs auf den Konten Aktive (Aktiver RAP) bzw. Passive Rechnungsabgrenzung (Passiver RAP) erfasst werden mit der Buchung „Aktive Rechnungsabgrenzung an Bank”. Dieses Verfahren empfiehlt sich nur für kleine Betriebe, in denen alle Arbeiten in der Hand nur eines Buchhalters liegen. | |||
| b) | Sie können im Zeitpunkt des Zahlungsvorgangs zunächst auf dem zugehörigen Erfolgskonto gebucht werden, z. B. „Zinsaufwendungen an Bank”. Dann ist im Rahmen der vorbereitenden Abschlussbuchungen eine Korrekturbuchung erforderlich: „Aktive Rechnungsabgrenzung an Zinsaufwendungen”. | |||
1711 1711
Die Zahlung betrifft nur eine Abrechnungsperiode
Sachverhalt: A hat die Miete für die Geschäftsräume für Januar 02 in Höhe von 1 000 € bereits im Dezember 01 an B überwiesen.
A bucht:
bei Überweisung:

Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen:

oder sofort:

Buchung im Januar 02:

B bucht:
bei Zahlungseingang:

Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen:

oder sofort:

Buchung im Januar 02:

Die Zahlung betrifft zwei Abrechnungsperioden
Sachverhalt: A überweist die halbjährlich fälligen Darlehenszinsen in Höhe von 600 € am 1. 10. 01 für ein halbes Jahr im voraus.

A bucht:
bei Überweisung:

Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen:

oder sofort:

Buchung im Folgejahr:
Im Januar 02

oder monatlich im Januar, Februar und März 02

B bucht:
bei Zahlungseingang:

Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen:

Im Folgejahr:
Im Januar 02

oder monatlich im Januar, Februar und März 02

1712Bei den sonstigen Forderungen und den sonstigen Verbindlichkeiten geht es darum, Aufwendungen und Erträge in dem Geschäftsjahr zu erfassen, in dem sie wirtschaftlich verursacht worden sind, auch wenn der Zahlungsvorgang (Einnahme oder Ausgabe) erst im Folgejahr stattfindet.
1713Typische Fälle antizipativer Posten sind noch zu erhaltende bzw. zu zahlende Mieten, Zinsen, Provisionen, Gebühren, Honorare, Steuern, Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge, Dividenden u. Ä.
1714 1714
Die Zahlung betrifft nur eine Abrechnungsperiode
Sachverhalt: Y überweist die am 31. 12. 01 fälligen Zinsen in Höhe von 900 € für Juli bis Dezember 01 erst am 3. 1. 02 an X.
Y bucht:
Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen für 01:

Bei Überweisung im Folgejahr 02:

X bucht:
Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen:

Bei Zahlungseingang im Folgejahr:

Die Zahlung betrifft zwei Abrechnungsperioden
Sachverhalt: Der Darlehensnehmer A begleicht die halbjährlich an B zu zahlenden Zinsen für Oktober 01 bis März 02 in Höhe von insgesamt 300 € erst nachträglich am 31. 3. 02.

Aufwand für A, Ertrag für B
A bucht:
Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen:

Bei Zahlung Ende März 02

B bucht:
Innerhalb der vorbereitenden Abschlussbuchungen:

Ende März 02

1715Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag dem Grunde nach feststehen, aber unbestimmt sind hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit. Die handelsrechtlichen Vorschriften für alle Kaufleute enthält § 249 HGB.
1716Rückstellungen werden immer gebildet mit dem Buchungssatz:

1717 1717
Bildung einer Rückstellung von 10 000 € für Prozesskosten:

Bei der Auflösung bzw. Inanspruchnahme im Folgejahr oder einem späteren Geschäftsjahr sind zu unterscheiden:
| a) | Die Rückstellung wird nicht in Anspruch genommen: | |||

| b) | Die Rückstellung wird nur teilweise in Anspruch genommen: | |||

| c) | Die Rückstellung reicht nicht aus: | |||

Einzelunternehmen und Personengesellschaften buchen i. d. R.:

1718Kapitalgesellschaften weisen periodenfremde Aufwendungen bzw. Erträge innerhalb der jeweils in der GuV nach § 275 HGB genannten Aufwands- bzw. Ertragsposition (bzw. auf dem im IKR genannten Aufwands- oder Ertragskonto) aus. Soweit die Beträge nicht bei den betroffenen Aufwands- bzw. Ertragsarten zu erfassen sind (§ 277 Abs. 4 Satz 3 HGB), fallen sie unter die Position
 | Sonstige betriebliche Erträge,Konto „549 periodenfremde Erträge” des IKR | |||
bzw.
 | Sonstige betriebliche Aufwendungen,Konto „699 periodenfremde Aufwendungen” des IKR. | |||
1719Unter die außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge (§ 277 Abs. 4 HGB) fallen bei Kapitalgesellschaften nur solche, die
 | außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, d. h. des going concern (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), anfallen, | |||
 | ihrer Art nach ungewöhnlich sind, | |||
 | selten vorkommen, | |||
 | für das Unternehmen von materieller Bedeutung sind. | |||
1720Dafür sind vorgesehen die GuV-Positionen (§ 275 HGB):
| 15. außerordentliche Erträge, | ||||
| 16. außerordentliche Aufwendungen, | ||||
| 17. außerordentliches Ergebnis, | ||||
und die Kontengruppen des IKR:
| 58 außerordentliche Erträge, | ||||
| 76 außerordentliche Aufwendungen. | ||||
1721§ 266 Abs. 3 HGB sieht für Kapitalgesellschaften die folgende Gliederung in der Bilanz vor:
| B. Rückstellungen | ||||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen; | ||||
| 2. Steuerrückstellungen; | ||||
| 3. sonstige Rückstellungen. | ||||
1722Handelsrechtlich sind Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Künftige Preis- und Kostensteigerungen bis zum tatsächlichen Anfall der Aufwendungen müssen berücksichtigt werden. Für die künftigen Preis- und Kostensteigerungen müssen ausreichende objektive Hinweise vorliegen. Es gilt der Grundsatz der Maßgeblichkeit der HB für die StB (§ 5 Abs. 1 EStG).
Steuerrechtlich erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten oder zum höheren Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b, c, d EStG; R 6.11 EStR und H 6.10 EStH). Künftige Preis- und Kostensteigerungen dürfen aber nicht in die Steuerbilanz übernommen werden. Das Gleiche gilt für die Berücksichtigung künftiger Karriere- und Gehaltstrends bei den Pensionsrückstellungen.
1723Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind
 | mit laufzeitkongruenten durchschnittlichen Marktzinssätzen der vergangenen sieben Jahre (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB) oder | |||
 | mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre, der pauschal auf einer Laufzeit von 15 Jahren beruht (Vereinfachungsregel § 253 Abs. 2 Satz 2 u. 3 HGB für Rentenverpflichtungen und gleichartige Verpflichtungen) zu diskontieren. Das Abzinsungsgebot gilt sowohl für Geld- als auch für Sachleistungen. | |||
 | für ab dem 1. 1. 2016 beginnende Wirtschaftsjahre: Renten- und Pensionsverpflichtungen können mit Durchschnittszinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst werden, der sich ebenfalls aus einer Tabelle ergibt, die von der Deutschen Bundesbank herausgegeben wird. Der Gesetzgeber reagierte mit der Neuregelung auf die anhaltende Niedrigzinsphase. Diese führte dazu, dass die Marktzinssätze immer geringer wurden, damit auch der Durchschnittszinssatz der letzten sieben Jahre. Dies führte zu immer geringeren Abzinsungen der Pensionsrückstellungen der Unternehmen, damit zu immer höheren Schuldbeträgen in den Bilanzen. | |||
Die in der Handelsbilanz verpflichtend anzuwendenden Zinssätze werden zu Beginn eines jeden Monats von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht und auch auf den Internetseiten der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben (§ 253 Abs. 2 Satz 4 HGB). Diese Zinssätze sind Durchschnittssätze der vergangenen sieben Jahre. Für Pensionsrückstellungen ist ein einheitlicher von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebener Zinssatz für eine 15-jährige Laufzeit anzuwenden.
Erträge und Aufwendungen aus der Diskontierung von Rückstellungen sind „sonstige Zinsen” (§ 275 Abs. 2 Nr. 11 und 13 HGB).
1724In der Steuerbilanz erfolgt die Diskontierung der Rückstellungen mit einem Zinssatz von 5,5 %. Pensionsrückstellungen werden ohne Berücksichtigung ihrer Laufzeit und erwarteter Karrieretrends und Gehaltssteigerungen mit einheitlich 6 % diskontiert (§ 6a EStG).
1725 ABB. 22: Passivierungspflichten, -wahlrechte und -verbote bei Rückstellungen



*) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (R 5.7 Abs. 1 Nr. 1 EStR) sind z. B. solche für Gewährleistungen mit rechtlicher Verpflichtung, für Prozesskosten, Abschlusskosten, Steuern und Abgaben, Wechselobligo, für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, für den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters nach § 89b HGB (H 5.7 Abs. 4 EStH: In der StB erst ab dem Ausscheiden des Handelsvertreters zulässig), für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands eines Grundstücks, für Rabatte und Boni im abgelaufenen Geschäftsjahr, für Pensionen u. a.
1726Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund entfallen ist, aus dem sie gebildet worden sind (§ 249 Abs. 2 Satz 2 HGB, R 5.7 Abs. 13 EStR).
1727Rückstellungen, die von Anfang an zu Unrecht gebildet worden sind oder bereits zu früheren Bilanzstichtagen hätten aufgelöst werden müssen, sind in der ersten Schlussbilanz, in der dies noch geschehen kann, gewinnerhöhend aufzulösen (BFH v. 12. 4. 1989, BStBl 1989 II S. 612).
1728Pensionsrückstellungen sind zu bilden für laufende Pensionen und für Anwartschaften auf Pensionen, wenn rechtsverbindliche Zusagen vorliegen oder ein faktischer Leistungszwang besteht, dem sich das Unternehmen auch ohne rechtliche Verpflichtung nicht entziehen kann. Grundsätzlich muss eine vertraglich zugesagte zukünftige Versorgungsleistung vorliegen (s. auch BStBl 1984 I S. 495). Eine rechtsverbindliche Zusage liegt vor bei
 | einzelvertraglicher Regelung, | |||
 | entsprechender Betriebsvereinbarung, | |||
 | betrieblicher Übung oder nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung (§ 1 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung/Betriebsrentengesetz vom 19. 12. 1974). | |||
1729Neuzusagen sind unmittelbare vertraglich zugesagte künftige Versorgungsleistungen, die nach dem 31. 12. 1986 erteilt worden sind. Für diese Zusagen besteht Passivierungspflicht.
1730Die grundsätzliche Passivierungspflicht aus § 249 Abs. 1 HGB wird eingeschränkt durch das Wahlrecht des Art. 28 EGHGB für die sog. Altzusagen, nämlich
 | laufende Pensionen und Anwartschaften aufgrund unmittelbarer Zusagen, wenn der Rechtsanspruch vor dem 1. 1. 1987 erworben worden ist, | |||
 | Erhöhungen zu diesen Altzusagen, die nach dem 31. 12. 1986 zugesagt worden sind. | |||
1731Ähnliche Verpflichtungen sind Überbrückungsgelder bis zur eigentlichen Pensionszahlung, Sterbegelder sowie Treueprämien, Tantiemen, die vom Erreichen der Altersgrenze, Invalidität oder Tod abhängen und sonstige Personalaufwendungen. Für diese besteht sowohl bei Altzusagen als auch bei Neuzusagen ein Passivierungswahlrecht. Da die „ähnlichen Verpflichtungen” nicht im Gesetz definiert sind, besteht hier hinsichtlich der Angabepflichten zu Fehlbeträgen ein zusätzlicher bilanzpolitischer Ermessensspielraum.
1732Passivierungspflicht besteht nur für unmittelbare (direkte) Zusagen. Sie liegen dann vor, wenn das Unternehmen im Falle der Inanspruchnahme die Leistung selbst erbringen muss.
1733Bei mittelbaren Zusagen werden die Leistungen von einem Versorgungsträger, z. B. Unterstützungskasse, erbracht (Direktversicherung). Sofern das Unternehmen nicht für Fehlbeträge einstehen muss, ist die Bildung einer Rückstellung ausgeschlossen. Die laufenden Zahlungen an die Versorgungskasse sind im Zeitpunkt der Ausgabe als Aufwand zu buchen: Sonstige soziale Abgaben an Bank. Der Übergang von einer mittelbaren zu einer unmittelbaren Zusage gilt als Neuzusage.