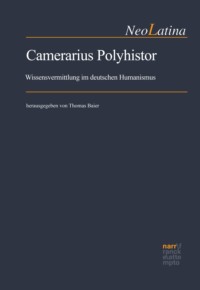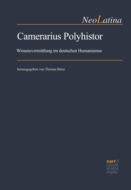Kitabı oku: «Camerarius Polyhistor», sayfa 11
Camerarius als Gräzist und Übersetzer
Joachim Camerarius als Defensor Herodoti: Die Widerlegung Plutarchs und der Zweck der Geschichte*
Anthony Ellis (Bern)
Für die nachfolgende herodoteische Wissenschaft gilt Joachim Camerarius zusammen mit Henri EstienneEstienne, Henri als einer der wirkmächtigsten Wissenschaftler des sechzehnten Jahrhunderts. Der Einfluss von Camerarius’ Vorwort zu seiner griechischen Herodot-AusgabeCamerarius d.Ä., JoachimProoemium in Historias Herodoti, die im Jahr 1541 erschien, sowie die Apologia pro HerodotoEstienne, HenriApologia pro Herodoto des EstienneEstienne, Henri wirkten bis ins frühe 19. Jh. auf die Rezeption HerodotsHerodot ein.1HerodotHistoriaeHerodotHistoriaeEstienne, HenriEstienne, HenriEstienne, PaulusHerodot Arnaldo Momigliano legte dar, dass beide Werke einen wesentlichen Beitrag leisteten, HerodotsHerodot schlechten Ruf zu verbessern.2 Doch während die Forschung Estiennes Apologia große Beachtung geschenkt hat, ist Camerarius’ ProoemiumCamerarius d.Ä., JoachimProoemium in Historias Herodoti, das in mehreren Aspekten der Apologia vorgreift, nur wenig untersucht worden. In meinem Beitrag soll Camerarius’ Beitrag zur Verbesserung der Reputation HerodotsHerodot und die darin ausgedrückte Geschichtsauffassung untersucht werden.
I. HerodotsHerodot Ruf vor Camerarius’ Wirken
Zunächst werfen wir einen kurzen Blick auf den Ruf HerodotsHerodot in der Renaissance, um den ursprünglichen Kontext des Werks Camerarius’ zu verstehen. Bekanntlich war die Zuverlässigkeit HerodotsHerodot schon in der Antike stark umstritten. Zu seinen Kritikern, deren Abhandlungen gar nicht oder nicht vollständig auf uns gekommen sind, zählen unter anderem Ctesias, Manetho, Valerius Pollio, Aelius Harpocration und Libanios. Das Urteil Ciceros erfasst gänzlich den zwiespältigen Ruf HerodotsHerodot: et apud Herodotum patrem historiae et apud Theopompum sunt innumerabiles fabulae (legCiceroleg..1, 5).1HerodotHerodot
In Renaissance und früher Neuzeit jedoch war die einzige Schmähschrift gegen HerodotHerodot eine kleine unter Plutarchs Namen überlieferte Abhandlung: De Herodoti malignitatePlutarchHerod. (oder Über Herodots Böswilligkeit). Hier verurteilte PlutarchPlutarch HerodotsHerodot angebliche Schwächen und Fehler, unter anderem seine Böswilligkeit, Betrügerei und Pietätlosigkeit. Plutarch war zu HerodotsHerodot Unglück einer der beliebtesten griechischen Autoren im 16. Jh. und bis ins 17. Jh. wurden Plutarchs Vitae zwei- bis viermal so häufig gedruckt wie HerodotsHerodot HistoriaeHerodotHistoriae.2 Die Autorität Plutarchs lastete schwer auf HerodotsHerodot Reputation.3PlutarchHerod.HerodotHistoriaeHerodot Der Pater Historiae brauchte daher – zumindest aus Sicht seiner Herausgeber – einen Verteidiger gegen Plutarchs beunruhigende Anklagen. Wenngleich nicht der erste Humanist, der eine Verteidigung HerodotsHerodot formuliert hat, so war Camerarius doch der erste Autor einer sorgfältigen Verteidigung, die ein breites Publikum erreichte.
Unter den wenigen erhaltenen Texten früher italienischer Humanisten, die HerodotHerodot explizit behandeln, gibt es keinen detaillierten Versuch, Herodot gegen seinen Ankläger PlutarchPlutarch zu verteidigen. Zwar kennt Guarino von Verona (1374–1460) HerodotsHerodot Werk wohl schon in den Jahren 1414/15 und rühmt den griechischen Autor in einem 1427 geschriebenen Brief an Panormita (Antonio BeccadelliBeccadelli, Antonio (Panormita)) überschwänglich, doch findet dessen beschädigter Ruf als Historiker hier keinerlei Erwähnung.4 Ähnlich ist die Lage bei Matteo Maria BoiardoBoiardo, Matteo Maria (gest. 1494), der die erste italienische Übersetzung der HistoriaeHerodotHistoriae HerodotsHerodot – mit einem Ercole d’Este (Herzog von Ferrara) gewidmeten Vorwort – schrieb, die erst lange nach seinem Tod gedruckt wurde (1533, Vendig: Giovanni Antonio di Nicolini di Sabbio).5Boiardo, Matteo MariaHerodot Für BoiardoBoiardo, Matteo Maria ist Herodot der Principe e padre unter den Historikern und seine asiatische Herkunft unterstütze die Glaubwürdigkeit seiner Erzählungen. Von den Angriffen Plutarchs und den von CiceroCicero erwähnten herodoteischen fabulae ist jedoch nirgendwo die Rede. HerodotsHerodot Tendenz, fiktive Geschichte zu erzählen, wird in einem kurzen Satz von Giovanni Giovano PontanoPontano, Giovanni (1426–1503) anerkannt. In einem Brief vom 1. Januar 1460 an Pere Salvador Valls und Joan Ferrer gibt Pontano der Zeit (anstatt dem Historiker selbst) die Schuld an seiner Ungenauigkeit.6Valla, Lorenzo Ein 1463 verfasstes Vorwort zu Herodot von Mattia PalmieriPalmieri, Mattia (gest. 1483), der die HistoriaeHerodotHistoriae auf Latein übersetzte, wurde nie gedruckt und verbleibt noch immer Manuskript.7 In diesen so unbekannten Schriften fand Herodot keinen Verteidiger, der seinen guten Ruf in der republica litteraria hätte wiederherstellen können.
Lorenzo VallaValla, Lorenzo, der erste Übersetzer der gesamten HistoriaeHerodotHistoriae, verfasste vermutlich aufgrund seines Todes im Jahre 1457 kein Vorwort zu seiner berühmten lateinischen Übersetzung, die zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht gänzlich vollendet war.8 Die Übersetzung wurde erstmals im Jahre 1474 veröffentlicht und war bis zu Aldus ManutiusManutius, Aldus’ editio princeps des griechischen Textes (1502) die einzige gedruckte Version des Textes HerodotsHerodot.9Valla, LorenzoValla, LorenzoGesta Ferdinandi regis AragonumHerodot Die kurzen Widmungsbriefe der ersten drei gedruckten Ausgaben von VallasValla, Lorenzo Übersetzung zeigen keine Spuren von HerodotHerodot-Kritik, weder der von PlutarchPlutarch noch von anderen. Benedictus BrognolusBrognolus, Benedictus’ siebenseitiger Widmungsbrief an Nicolaus DonatusDonatus, Nicolaus, der am Anfang der editio princeps von VallasValla, Lorenzo Übersetzung (Jacobus RubeusRubeus, Nicolaus: Venedig 1474) steht, konzentriert sich darauf, Donatus zu loben und für das größere Vorhaben zu werben, die literarischen Reste der Antike zu konservieren. Herodot wird erstmals auf der vorletzten Seite erwähnt, auf der ihn BrognolusBrognolus, Benedictus ‚Vater der Geschichte’ nennt, bevor er HerodotsHerodot Süße, Sanftheit und Beredtheit erwähnt10Brognolus, BenedictusHerodot und damit auf die Topoi der Antike zurückgreift.11QuintilianHerodotValla, LorenzoManutius, AldusThukydidesHerodotHerodotMelanchthon, Philipp Die zweite Ausgabe des VallaValla, Lorenzo-Textes (Pannartz: Rom 1475) enthält, abgesehen vom Text selbst, nur ein kleines lateinischen Epigramm. Die dritte VallaValla, Lorenzo-Ausgabe (Johannes & Gregorius de Gregoriis: Venedig 1494) umfasst einen Widmungsbrief vom Herausgeber des Textes, Antonius MancinellusMancinellus, Antonius, an Nicolaus RubeusRubeus, Nicolaus, in dem Herodot nicht einmal erwähnt wird.
Mit dem 1502 veröffentlichten Vorwort von Aldus ManutiusManutius, Aldus zu seiner editio princeps des griechischen Textes der HistoriaeHerodotHistoriae wurde zum ersten Mal ein Text gedruckt, der auf HerodotsHerodot Kritiker – d.h. vor allem auf PlutarchPlutarch – zu antworten suchte und breite Bekanntheit erlangte. In zwei Sätzen setzt sich Aldus mit den Verunglimpfungen HerodotsHerodot auseinander: Derjenige, der die HistoriaeHerodotHistoriae genau lese, bemerke unschwer, dass sich HerodotHerodot immer rechtfertigt, wenn er etwas Unglaubwürdiges schreibt, entweder durch eine Quellenangabe oder indem er sagt, dass er selbst dem aufgezeichneten Bericht nicht glaubt:12Manutius, Aldus
[…] cum accurate musas ipsas perlegeris, facile cognosces, nam quoties indignum quid creditu scribit HerodotusHerodot, se ferè semper excusat, vel οὕτω λέγουσι dicens, uel ὡς ἀκήκοα, vel ὅπερ ἐμοὶ οὐ πιστὸν, vel ἅ γ᾽ἐμοὶ ἄπιστα et id genus quid aliud.
[…] wenn man [Herodots] Musen mit Genauigkeit liest, erkennt man dies leicht, denn jedes Mal, wenn HerodotHerodot etwas Unglaubwürdiges schreibt, verteidigt er sich, indem er sagt „so sagen sie“ oder „so habe ich gehört“ oder „was mir unglaubwürdig scheint“ oder „welchem ich nicht glaube“ oder etwas anderes dieser Art.
Überraschenderweise bestreitet Aldus den Großteil seiner Beweisführung über HerodotsHerodot Zuverlässigkeit unter Rekurs auf eine Analogie zu den Kretern, die ebenfalls einen unverdienten schlechten Ruf als Lügner hätten.13 Solche kurze Bemerkungen von Aldus ManutiusManutius, Aldus und seinen Vorgängern genügten jedoch nicht, HerodotsHerodot guten Namen wiederherzustellen. Viele Humanisten, darunter Rudolph Agricola (gest. 1485), ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius (1466–1536), Guillaume BudéBudé, Guillaume (1467–1540) und Adrien TurnebusTurnebus, Adrianus (1512–1565), sind dem Urteil von HerodotsHerodot Kritikern gefolgt, nicht dem seiner Verteidiger.14HerodotBudé, GuillaumeErasmus von Rotterdam, DesideriusTurnebus, AdrianusVives, Juan Luis Die knappste Formulierung stammt wohl vom Spanier Juan Luis VivesVives, Juan Luis, der 1531 im Zuge seiner Abhandlung über die Unzuverlässigkeit der griechischen Historiker HerodotHerodot Pater mendaciorum („Vater der Lügen“) statt Pater historiae titulierte.15Vives, Juan LuisHerodotHomerHesiodHerodot
II. Camerarius und HerodotHerodot
Wenden wir uns Camerarius’ Werk über HerodotHerodot zu, d.h. seiner 1541 erschienenen Ausgabe der HistoriaeHerodotHistoriae samt einführendem Vorwort. Trotz der einmaligen Existenz eines von Camerarius annotierten Herodot-Exemplars (vgl. unten) und trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, dass Camerarius über Herodot Vorlesungen gehalten hat, muss unsere Einschätzung seiner Herodotstudien nahezu ausschließlich auf der Grundlage des im Jahre 1541 veröffentlichten ProoemiumCamerarius d.Ä., JoachimProoemium in Historias Herodoti erfolgen. Wir haben keine Spur des Herodot-Exemplars, das Camerarius in diesem Vorwort erwähnt.1 Möglicherweise wurde das Buch zusammen mit vielen anderen Büchern der Bibliothek der Camerarius-Familie während der Einäscherung der Stadt Heidelberg durch französische Truppen im Jahre 1693 zerstört.2
Meines Wissens gibt es keinen sicheren Beweis dafür, dass Camerarius an den Universitäten Wittenberg, Tübingen oder Leipzig je über HerodotHerodot las. Die akademischen Aufzeichnungen der Universität Leipzig, an der Camerarius von 1541 (kurz nach der Veröffentlichung seiner Herodot-Ausgabe) bis zu seinem Tode im Jahr 1574 lehrte, sind äußerst spärlich. In der Regel beweisen sie, dass Camerarius utriusque linguae („beide Sprachen“, d.h. Griechisch und Latein) lehrte; die antiken Autoren, die gelesen wurden, werden selten genannt. Ab und an fällt ein Name (z.B. HomerHomer oder Xenophons KyropädieXenophonCyr.), der HerodotsHerodot aber ist nicht zu finden.3 In Tübingen ergibt sich dasselbe Bild. Während Camerarius dem Leser in seinem Homer-Kommentar mitteilt, dass das Buch auf seiner Homer-Vorlesung aus dem Jahr 1537 basiert,4 bietet Camerarius keine vergleichbare Ätiologie in seinem Vorwort zu Herodot. In seinen Kommentaren zu IliasCamerarius d.Ä., JoachimCommentarius explicationis primi libri Iliados Homeri 1 (1538) und IliasCamerarius d.Ä., JoachimIn Homeri Iliados librum secundum 2 (1540) bezog sich Camerarius mehrmals auf Herodot, auch in Zusammenhängen, in denen man es nicht erwartet hätte.5Herodot Dies ist aber kein sicheres Anzeichen dafür, dass Camerarius damals Herodot lehrte: Plausibel ist, dass sich Camerarius bereits mit der Herodot-Ausgabe beschäftigte, die im Jahr darauf erscheinen sollte.
Nun zu den vorhandenen Belegen: Ich beginne mit einem biographischen Hinweis. Am Anfang seines ProoemiumCamerarius d.Ä., JoachimProoemium in Historias Herodoti schreibt Camerarius, dass er HerodotHerodot zuerst in privatem Rahmen, und zwar in Leipzig im Haus des englischen Gräzisten Richard CrokeCroke, Richard (ca. 1489–1558), gelesen habe. CrokeCroke, Richard scheint vom Sommersemester 1515 bis 1517 (d.h. während des Großteils der Studienzeit des Camerarius in Leipzig)6Croke, RichardPlutarchHerodotCroke, RichardCroke, Richard Deutschlands erster bezahlter Professor für Griechisch gewesen zu sein. Der Professor habe, sagt Camerarius, zusammen mit den Studenten das erste Buch HerodotsHerodot (und Teile des zweiten) gelesen; nach Abschluss des Kurses sei Camerarius so verliebt in die Süße und Eleganz HerodotsHerodot gewesen (erneut der Topos aus QuintilianQuintilian), dass er allein mit der Herodot-Lektüre fortgefahren habe. Dabei habe er von seinem Lehrer, vermutlich Georg HeldHeld, Georg, ein Herodot-Exemplar bekommen, das mit zahlreichen Marginalien versehen gewesen sei. Mit typischer Bescheidenheit erzählt Camerarius die Geschichte auf folgende Weise:
Cumque Crocus statuisset domi suae quibusdam privata opera Herodoti historias explicare, nos etiam tum ad hunc autorem cognoscendum à Magistro sumus missi. Etsi autem Crocus vix pervenit ad secundum illius autoris librum enarratione sua, ego tamen captus dulcedine et elegantia atque etiam facilitate scriptorum, cum celeriter diversitatem quandam sermonis, quam διάλεκτον vocant, percepissem, ita postea semper in illo legendo haesi atque perseveravi, ut qualemcunque (sentio enim quàm exigua haec sit.) facultatem Graecae linguae consecuti sumus, eam magna ex parte Herodoti lectione acceptam referre debeamus. Itaque et nunc eum quorum usus fui acceptum à Magistro Herodoti codicem, tactatum versatumque a me plurimum, omnibus in pagellis notatiunculis et scriptura nostra insignem, inter alios omnes et diligo maximè, et, quoties forte aspexi, non unquam ferè temperare mihi possum, quin aperiam et in eo aliquid legem.7
Hieraus lässt sich folgern, dass Camerarius HerodotHerodot erstmals in Leipzig zwischen September 1515 (als er nach einem Krankenaufenthalt in Bamberg nach Leipzig zurückkehrte) und Ostern 1517 (als er, neuerlich erkrankt, für etwa fünf Monate nach Hause ging und CrokeCroke, Richard während seiner Abwesenheit an die Universität Cambridge wechselte) las.8 Camerarius’ späterer Biograph Melchior AdamAdam, Melchior beschreibt ein Vorkommnis des Jahres 1516, wobei Camerarius aufgrund von Unruhen in Leipzig sein Herodot-Exemplar sub veste („unter seiner Kleidung“) getragen habe, um es zu schützen, sollten die Spannungen in Gewalt übergehen (hier scheint AdamAdam, Melchior eine frühere Erzählung des Sohnes Joachim Camerarius d.J.Camerarius d.J., Joachim ausgearbeitet zu haben).9 Erst etwa 25 Jahre später wurde Camerarius’ erstes und einziges Werk über Herodot veröffentlicht: Im März 1541, ein halbes Jahr vor seinem Wechsel von der Universität Tübingen an die Universität Leipzig, wurde die Herodot-Ausgabe in Basel bei Johann HerwagenHerwagen d.Ä., Johann gedruckt. Für die Zwischenzeit gibt es kaum einen Hinweis darauf, dass sich Camerarius mit Herodot beschäftigte.10Melanchthon, PhilippMelanchthon, PhilippMelanchthon, PhilippHerodotHerodotIsokratesMelanchthon, Philipp
Nun zum Vorwort. Früh im ProoemiumCamerarius d.Ä., JoachimProoemium in Historias Herodoti nennt Camerarius sein Ziel: Er wolle den Kritikern, die gegen HerodotHerodot schreiben, „antworten“. Trotz der Tatsache, dass er am Anfang keinen Kritiker nennt, wird die Gestalt Plutarchs sogleich greifbar – hinter Camerarius’ Paraphrase ist der Vorwurf gegen Herodot: malignitatis crimen („der Frevel der Böswilligkeit“) leicht erkennbar.
Camerarius’ Verteidigungsrede beschreibt HerodotsHerodot Werk mit folgenden Worten:11
Narrationes sunt disertae: Indicationes expressae et speciosae: Explicationes accuratae & evidentes: […] Accurata compertorum relatio, dubiorum coniectura fugax, fabulosorum verecunda commemoratio. Mira ubique simplicitas, et eximius quidam candor.
Die Erzählungen sind wortgewandt, die Einschätzungen klar und schön, die Berichte genau und deutlich […] [Er bietet] einen genauen Bericht dessen was er gelernt hat, vermeidet Spekulation über zweifelhafte Dinge und erzählt Märchenhaftes mit Schamgefühl. Überall ausgezeichnete Einfachheit und außerordentliche Freimütigkeit.
Nachdem Camerarius mehrere Eigenschaften HerodotsHerodot aufgeführt hat – darunter Genauigkeit, Schlichtheit und Aufrichtigkeit – thematisiert er Plutarchs wichtigste Anklage: HerodotsHerodot Verlogenheit. Dass Aldus ManutiusManutius, Aldus schon darüber geschrieben hat, bemerkt Camerarius als erstes.
Ich möchte mich hier auf diejenigen Argumente konzentrieren, die Camerarius bezüglich HerodotsHerodot „sagenhafter Geschichtchen“ (fabulosas narratiunculas) vorbringt. Dass er dies thematisiert, hat seinen wahrscheinlichsten Grund darin, dass er die von CiceroCicero erwähnten fabulae HerodotsHerodot im Hinterkopf hat. Camerarius behauptet, dass HerodotHerodot für viele der unglaubwürdigen Aspekte seines Werkes nicht kritisiert, sondern gelobt werden solle, weil sie nicht nur charmant geschrieben seien, sondern dem Leser auch Belehrung und Beratung für das Leben brächten.12 Damit allerdings niemand irregeführt werde, führe Herodot – so Camerarius – fast immer relativierende Äußerungen an, z.B. „so sagen sie“, „so habe ich gehört“ oder „was mir unwahrscheinlich scheint“.13 Die Nähe zu Aldus’ Vorwort ist erkennbar (vgl. oben Anm. 14). Hier ist zu bemerken, dass Camerarius offensichtlich aus apologetischen Gründen etwas zu weit geht. In Teilen seines Werkes achtet Herodot sehr stark auf seine Quellen und gibt oft ehrlich die Grenzen seines Wissens zu. Die Mehrheit der von Camerarius zitierten Beispiele („so sagen sie“ usw.) stammen aus Passagen, wo Herodot sich öffentlich als Forscher darstellt, dessen Wissen auf das beschränkt ist, was er sieht, hört und davon ableitet. Diese erzählerische Tendenz findet sich jedoch in der Regel nicht in den vielen Abschnitten der HistoriaeHerodotHistoriae, wo sich Herodot als allwissender Erzähler darstellt, der seine Geschichten mimetisch, ohne Quellenangabe und ohne Hinweis auf ihre sagenhafte und fiktive Natur erzählt.14Herodot
In diesem Zusammenhang führt Camerarius einen wichtigen herodoteischen Satz an, der besagt, dass es die Aufgabe des Historiker sei, was gesagt werde zu überliefern, jedoch nicht alles, was er überliefere, zu glauben (Hdt. 7, 152). Camerarius gibt folgende Übersetzung: Ego, inquit, quae fando cognovi exponere narratione mea debeo omnia, credere autem esse vera omnia, non debeo.15 Diese Aussage wurde ebenfalls von späteren Humanisten betont: von Henri EstienneEstienne, Henri in seiner Apologia pro HerodotoEstienne, HenriApologia pro Herodoto (die im Jahr 1566 erschien)16Estienne, Henri und von David ChytraeusChytraeus, DavidDe lectione historiarum recte instituenda (der 1541 bei Camerarius in Tübingen studierte) in seiner De lectione historiarum recte instituendaChytraeus, DavidDe lectione historiarum recte instituenda.17Chytraeus, David Jahrzehnte später schreibt Joseph ScaligerScaliger, Joseph diesen Satz auf das Titelblatt seines HerodotHerodot-Exemplars.18Herodot
Der Ruf HerodotsHerodot wird danach durch einen Vergleich mit dem zweiten großen griechischen Historiker ThukydidesThukydides aufgebessert, dessen Geschichte des Peloponnesischen Krieges Camerarius kurz zuvor im Jahr 1540 herausgegeben hatte.19 Thukydides habe wie HerodotHerodot Reden erfunden und in seine Geschichten eingesetzt. Auf keinen Fall dürfe man glauben, dass die Reden wirklich so gehalten wurden, wie Thukydides sie dargestellt hat. Das sei allerdings kein Nachteil. Camerarius bringt sein Argument in einem Frauenvergleich zum Ausdruck: Geschichte solle nicht schmucklos und nackt sein, sondern verziert, bekleidet und vollkommen:
Itaque non inornatam, non nudam, non contractam, sed splendidam, vestitam, explicatam, dummodo integram, et, ut ita dicam, probam et incorruptam decet esse historiam.20
Später im Prooemium verteidigt Camerarius das Sagenhafte in HerodotsHerodot HistoriaeHerodotHistoriae noch ausdrücklicher: Das Ziel der Geschichte liege nicht nur darin, unser Wissen um die Realien zu vermehren, sondern auch darin, unsere Seele oder unseren Geist (animus) auszubilden (non solum delectationem cognitionis, sed instructionem etiam animorum), damit Geschichte dem Leser sowohl Freude als auch Nützlichkeit (voluptas et utilitas) bringe. Wenn etwa HerodotsHerodot fiktive fabulae nützliche Warnungen und vieles Wertvolles enthalten, so sollen wir ihn dafür schätzen, nicht kritisieren.
Als Beispiel führt Camerarius die Geschichte des Lyderkönigs Candaules an, der von seinem Speerträger Gyges ermordet wird. Niemand, schreibt Camerarius, zweifle daran, dass die Realien der Wahrheit entsprächen. Die Details der Erzählung wiederum seien für HerodotHerodot gar nicht erkennbar, etwa dass Candaules so sehr in seine Frau verliebt gewesen sei, dass er sie, als sie nackt war, heimlich dem Gyges gezeigt habe, um ihn zu überzeugen, dass er, Candaules, die schönste Frau auf der Welt habe, oder dass die Königin, nachdem sie den Komplott entdeckt hatte, Gyges gezwungen habe, entweder gleich zu sterben oder seinen König Candaules zu töten. Die genauen Einzelheiten der Geschichte, die sich im Geheimen und unter Menschen zugetragen hat, die Jahrhunderte vor Herodot in einem weit entfernten Land lebten, dürften erfunden sein, so Camerarius, aber sie enthielten doch viele ausgezeichnete Sprüche oder sententiae und zeigten die Gefahren einer pervertierten Seele auf.21
Dieses Vorgehen ist eine ingeniöse Methode der Verteidigung. In Antike und Renaissance war Wahrheit (d.h. Fakten, nicht die Erzeugnisse der Phantasie) eine wesentliche Eigenschaft der Geschichtsschreibung, zumindest in der Theorie; freie Erfindung der Ereignisse hingegen entspricht der Rolle des Historikers nicht.22Ciceroorat. In der Renaissance hat man der Gewohnheit antiker Autoren, Reden zu erfinden, große Aufmerksamkeit beigemessen und über das Für und Wider argumentiert. In dieser Debatte waren die Stimmen, die für erfundene Reden eintraten (aufgrund der rhetorischen Natur und der pädagogischen Aufgabe der Geschichte) weit zahlreicher als die, welche die Reden kritisierten.23 Durch seinen Appell für eine ausgedehnte Praxis dieses Prinzips – dem sowohl von zeitgenössischen Geschichtstheoretikern als auch von ThukydidesThukydides selbst (an dessen Zuverlässigkeit es nie Zweifel gegeben hatte) Folge geleistet wurde – sprach sich Camerarius auch für eine Verteidigung des herodoteischen Bestrebens aus, ausführlich von Ereignissen, die in grauer Vorzeit lagen und von denen er keine detaillierten Erkenntnisse gehabt haben konnte, zu berichten. Durch seine Betonung der pädagogischen Funktion der Geschichte gelang es Camerarius, HerodotsHerodot Laster in Tugend zu verwandeln. Die Idee, dass der moralische Unterricht wichtiger sei als die wissenschaftliche Äquivokation, verbindet Camerarius eng mit seinem Freund und ehemaligen Fachkollegen in Wittenberg (und früheren Kommilitonen an der Universität Heidelberg) Philipp MelanchthonMelanchthon, PhilippChronicon Carionis, dessen Chronicon Carionis stark von einem ähnlich moralisierenden Blickwinkel geprägt ist.24
Diese Auffassung hat Camerarius nicht nur willkürlich aus apologetischen Gründen vertreten. Eine ähnliche Beweisführung findet sich in Camerarius’ posthum veröffentlichter Historica narratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis in Bohemia, Moravia, & PoloniaCamerarius d.Ä., JoachimHistorica narratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis (Heidelberg 1605). Hier sieht Camerarius offenbar eine enge Verbindung zwischen Werken, die als Geschichte (historia) bezeichnet werden können, und solchen, die zu anderen Gattungen (genus) gehören.25 Hinter dieser Unterscheidung liegt möglicherweise AristotelesAristoteles’ Erörterung über den Unterscheid zwischen Geschichte (historia) und Dichtung (poiesis), der zum allgemeinen Fundus der Geschichtstheoretiker der Renaissance gehörte.26 In seiner PoetikAristotelesPoet. behauptet Aristoteles, es sei Aufgabe der Geschichtsschreibung, zu berichten, was geschehen ist (τὰ γενόμενα), während es Aufgabe der Dichtung sei, zu sagen, was geschehen könnte (οἷα ἂν γένοιτο). Damit ist Dichtung „philosophischer und schwerwiegender als Geschichtsschreibung, weil Dichtung mehr vom Allgemeinen, Geschichtsschreibung hingegen vom Besonderen spricht“.27AristotelesPoet. Die PoetikAristotelesPoet. war Camerarius gut bekannt. In seinem Argumentum Fabulae, das Camerarius seinem 1534 veröffentlichten Kommentar zum Oedypus TyrannusCamerarius d.Ä., JoachimCommentarii Thebaidos fabularum Sophoclis als Vorwort voranstellte, stützte er sich bei der Erörterung des Tragödienbegriffs auf die aristotelischen Ideen von Furcht und Mitleid (metus et misericordia) und die Vorstellung der hamartia.28 Während Aristoteles HerodotsHerodot Werk als reine historia bezeichnet hatte (d.h. ein Werk, welches sich ausschließlich damit beschäftigt, „was geschehen ist“), gibt Camerarius zu – vermutlich aufgrund Ciceros Äußerungen über HerodotHerodot sowie Camerarius’ Kenntnis des Werks –, dass Herodot auch fabulae miteinbezogen habe, die wenig oder überhaupt nicht auf sachlicher Basis beruhen. Nach Camerarius’ und Aristoteles’ Definition von Tragödie gelten solche schöpferischen Erzählungen nicht als Geschichte. Anstatt HerodotsHerodot HistoriaeHerodotHistoriae als teilweise „unhistorisch“ zu bezeichnen, versucht Camerarius im ProoemiumCamerarius d.Ä., JoachimProoemium in Historias Herodoti jedoch mehrfach zu beweisen, dass Erzählungen, die in der Tat gar nicht historisch sind, immerhin eine nützliche pädagogische Rolle in der Geschichtsschreibung spielen können, und zwar so lange sie richtig komponiert sind (eine wichtige Bedingung).29Herodot Camerarius baut somit eine Verteidigung der dichterischen oder sagenhaften Elemente der Geschichtsschreibung wider die Theoretiker des 15. und 16. Jahrhunderts auf.
In der Historica narratioCamerarius d.Ä., JoachimHistorica narratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis bemerkt Camerarius, dass viele bedeutsame Werke gar nicht historisch sind, wobei er als Beispiel Xenophons KyropädieXenophonCyr. anführt, deren fiktive Natur von CiceroCicero in einem oft zitierten Satz bestätigt worden sei: Die KyropädieXenophonCyr. wurde non ad historiae fidem scriptus, sed ad effigiem justi imperi („nicht als historische Wahrheit geschrieben, sondern als Abbild eines gerechten Reiches“).30CiceroQ. fr.Bracciolini, PoggioChytraeus, DavidCicero Im Gegensatz zum explizit apologetischen Prooemium zu HerodotHerodot vermeidet Camerarius die explizite Aussage, dass vieles in HerodotsHerodot Werk nicht historisch ist. Camerarius deutet, wie oben erwähnt, vielmehr an, dass Herodot sehr wohl eine kritische Haltung seinen Quellen gegenüber gehabt habe.
Tatsächlich kommt HerodotsHerodot Geschichtsschreibungspraxis Camerarius’ eigener Geschichtskonzeption erheblich näher als der des AristotelesAristoteles, die alles, was auf allgemeine Wahrheit zielt, der Dichtung zuordnet. Wie Stephan Kunkler treffend bemerkt hat, behauptet Camerarius, dass auch die christliche Wahrheit einen wichtigen Platz in der Geschichte habe und dass die beste Art und Weise, diese Wahrheit auszusprechen, nicht immer die der sorgfältigen Wiedergabe sachlicher Einzelheiten sei.31XenophonCyr.
Zurück zum 1541 veröffentlichen Vorwort: Nachdem er die Frage der Zuverlässigkeit HerodotsHerodot ausführlich diskutiert hat,32HerodotHomerHerodotHomerHesiod nennt Camerarius zum ersten Mal PlutarchPlutarch, wobei er sagt, dass er gegen Plutarch und für HerodotHerodot (pro Herodoto) schreiben werde. Er beginnt in respektvollem Ton,33 aber das ad hominem kommt schnell: Als Plutarch Herodot der Böswilligkeit bezichtigte, habe er seine eigene Böswilligkeit zu erkennen gegeben. Plutarchs Parteilichkeit wird angeführt: Plutarch schreibe nicht aus Liebe zur Wahrheit, sondern aus Rachlust (non veritatis sed ultionis cupiditas), weil Herodot Plutarchs Landsmänner, die Böotier, als Verräter im Perserkrieg dargestellt habe.34 Eben dieser Punkt wird von Isaac CasaubonCasaubon, Isaac am Anfang seiner Herodot-Vorlesungen in Paris im Winter 1601/2 wiederholt werden.35Casaubon, Isaac CasaubonCasaubon, Isaac las sicherlich Camerarius’ Prooemium, wie man aus den Marginalien seines Herodot-Exemplars ersehen kann.36Casaubon, IsaacHerodot Hier sieht man einmal mehr, wie Camerarius’ Verteidigung für HerodotsHerodot spätere Verteidiger einschlägig war.