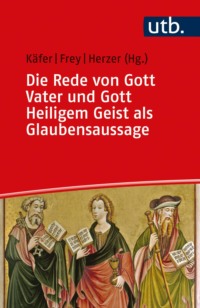Kitabı oku: «Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage», sayfa 10
[Zum Inhalt]
|87|I. »Ich glaube an Gott Vater …«
Von urgründiger Liebe
Das Bekenntnis des christlichen Glaubens beginnt mit dem Bekenntnis zu Gott dem »Vater«. Damit wird nicht nur irgendeine allgemeine Rede von Gott aufgenommen, sondern ein biblisches Bild davon, wie Gott sich in Jesus Christus und dessen Geschichte erwiesen und geoffenbart hat, nämlich als ein zugewandter Gott, dem seine Geschöpfe nicht gleichgültig sind und der über alle Brüche hinweg seine Treue erweist. Mit der Aussage »Ich glaube« bringt der Bekennende also zum Ausdruck: Ich weiß mich durch Christus von der Sünde befreit und durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft der Glaubenden gestellt. Was im zweiten und im dritten Glaubensartikel beschrieben ist, ist der Erkenntnis Gottes als des Vaters vorausgesetzt.
Aus der biblischen Tradition steht hier die ganze Beziehungsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel und der Menschheit im Hintergrund, in der Gott in vielfältigen anthropomorphen Metaphern als Vater (Ex 4,22; Jer 31,30; Jes 64,7–8) und Mutter (Jes 49,15; 66,13) erkannt und bekannt wurde. In der Verkündigung und Geschichte Jesu Christi wurde manifest, dass sich Gottes »Vatersein« in Unterscheidung von allen menschlichen Vorstellungen durch eine urgründige und uneingeschränkte Liebe auszeichnet und dass darin letztlich Gottes Wesen besteht (1 Joh 4,16), das alle Ambivalenzen im Gottesbild (die Annahme eines zornigen oder verborgenen Gottes im Gegensatz zu einem gnädigen Gott) überwindet.
|89|Referenzen und Konnotationen der Vaterschaft Gottes im frühen Christentum
Christiane Zimmermann
Einführung
»Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.« Das Apostolische Glaubensbekenntnis beginnt mit dem Bekenntnis zu Gott. »Gott« ist zunächst nicht mehr als eine Gattungsbezeichnung, die noch nichts spezifisch Christliches an sich hat. Das Bekenntnis kennzeichnet diesen »Gott« dann sogleich mit einer dreigliedrigen Apposition, die Gott in seinen für die Bekenner wichtigsten Wesenszügen metaphorisch beschreibt: Er ist der Vater, er ist der Allmächtige und er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Die metaphorischen Appositionen, die Gott mit Bildern darstellen, die den Betenden vertraut sind und besondere Konnotationen aufrufen,[1] gipfeln im Schöpfertum Gottes, in dem zugleich seine anderen Wesenszüge, seine Vaterschaft und seine Allmacht begründet zu sein scheinen: Der Schöpfer hat die Macht über das von ihm Geschaffene und er tritt zum Geschaffenen in eine besondere Beziehung, für deren Beschreibung die Vater-Metapher offenbar zutreffend war.
Mit der Vater-Bezeichnung Gottes rekurriert das Apostolikum auf die schon für das früheste Christentum zentrale Vorstellung Gottes als Vater. Bereits in einem der ersten christlichen Bekenntnistexte, den Paulus in 1 Kor 8,6 überliefert, ist die Trias des Apostolikums, nämlich die Verbindung von Vaterschaft, Herrschaft und Schöpfertum erkennbar. Der Vers betont, dass es für die Christen und Christinnen im Unterschied zur paganen Welt nur einen einzigen Gott und einen einzigen Herrn gibt: Gott, den Vater, aus dem alles ist, und Jesus Christus, den Herrn, durch den alles ist:
| |90|ἀλλ’ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατὴρ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ. | Für uns aber gibt es einen einzigen Gott, den Vater, aus dem alles ist und wir auf ihn hin und einen einzigen Herrn, Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. |
Zwar ist hier der Aspekt der Macht durch die κύριος-Bezeichnung mit Jesus Christus verbunden, jedoch hat dieser die κύριος-Würde nach frühchristlicher Vorstellung (Phil 2,9–11) von Gott übertragen bekommen und wird sie Gott nach 1 Kor 15,28 auch wieder zurückgeben bzw. sie mit Gott teilen. Das Schöpfertum Gottes wird in dem an die Vatermetapher angeschlossenen Relativsatz »aus dem alles ist« ebenfalls klar artikuliert und um den Gedanken der Schöpfungsmittlerschaft Jesu (»durch den alles ist«) ergänzt. Klar erkennbar ist auch in diesem frühen Bekenntnistext die zentrale Vorstellung Gottes als Vater; die Apposition »der Vater« entspricht hier der Stellung des Eigennamens »Jesus Christus« im zweiten Teil des Verses. Durch diese Stellung deutet sich bereits ein Übergang von einer reinen Vatermetapher in einen eigennamen-ähnlichen Gebrauch der Vater-Bezeichnung an. In diesem Bekenntnis stellt sich nun ebenso wie im Apostolikum eine grundsätzliche Frage, und zwar die der Referenz der Vater-Bezeichnung. Wessen Vater ist Gott? Und was konnotiert die Vater-Bezeichnung für die frühen Christinnen und Christen?
Im Folgenden sollen nun zunächst die verschiedenen Referenzen von »Vater« im antiken Judentum und frühen Christentum behandelt werden (1.). In einem weiteren Schritt soll die Frage beantwortet werden, welche spezifischen Konnotationen der Vaterschaft Gottes in den biblischen Schriften erkennbar sind (2.), bevor auf die weitere Institutionalisierung der Vater-Bezeichnung in den ersten christlichen Jahrhunderten kurz eingegangen werden soll (3.), um abschließend einen Blick auf die Funktion der Vater-Bezeichnung im Apostolikum zu werfen (4.).
1. Die Referenz der Vater-Metapher oder: Wessen Vater ist Gott?
»Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.« Zunächst liegt es nahe, die Vater-Anrede in dieser Glaubens-Aussage des Apostolikums auf Gott als Vater |91|des bekennenden Subjekts zu beziehen, im Sinne von »ich glaube an Gott, meinen Vater«. Dabei ist die metaphorische Dimension dieser Vater-Bezeichnung vorausgesetzt. Die Vater-Bezeichnung kann sich jedoch auch auf Gott als Vater Christi beziehen, also christologisch referieren. Dies wird durch die spätere Einspielung des Bekenntnisses zum eingeborenen Sohn Gottes im zweiten Artikel des Textes des Apostolikums nahegelegt (»ich glaube an Gott, den Vater […] und an seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn«). Schließlich könnte jedoch auch eine schöpfungstheologische Verwendung der Vater-Metapher im Blick sein, wie sie im gerade bereits zitierten Text aus 1 Kor 8,6 erkennbar wurde (»Gott, der Vater, aus dem alles ist […]«). Gott ist hier der Vater der Schöpfung, aber auch Vater im Sinne der kontinuierlichen Fokussierung der Glaubenden auf ihn als Lebensspender und -erhalter (»und wir auf ihn hin«). Die kreatorische Referenz der Vater-Bezeichnung scheint allerdings aus Gründen der Synonymik für das Apostolikum nicht primär im Blick zu sein, da die einleitende Appositionskette mit dem expliziten Bekenntnis zu Gott als Schöpfer endet, auch wenn dieses Schöpfertum mit der Vater-Bezeichnung korrelierbar ist.
1.1 Gott als Vater der Glaubenden: Die ekklesiologische[2] Referenz der Vater-Metapher
Aller Wahrscheinlichkeit nach sprach bereits Jesus von Gott als Vater: Das Vater-Gebet in der Version von Lk 11,2–4, in dem Jesus seine Nachfolger und Nachfolgerinnen lehrt, Gott als Vater anzusprechen (ὅταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου), spiegelt |92|vermutlich authentische Jesus-Rede wider, ebenso wie die Anrufung Gottes als »Vater« im Gebet in Gethsemani (Mk 14,36 parr.), wo sich die Vateranrede im markinischen Text auch in ihrer aramäischen Form, aber in griechischer Umschrift findet (αββα). Auch Paulus zitiert diese aramäische Form in Gal 4,6 und Röm 8,15 und memoriert damit vermutlich die authentische Gebetsanrede Gottes durch Jesus. Mit dieser abba-Anrede wendet sich der glaubende Jude Jesus als Mitglied des Gottesvolkes an seinen Gott als »Vater« und lehrt auch seine Nachfolger und Nachfolgerinnen ebensolches zu tun.
Die im vergangenen Jahrhundert von Joachim Jeremias vertretene, breit rezipierte These, dass die jesuanische Anrede Gottes als abba kindersprachlich und für das »Empfinden der Zeitgenossen Jesu unehrerbietig, ja undenkbar« erschienen sei[3] und damit das ganz besondere Verhältnis Jesu zu Gott formuliere, hat inzwischen vor allem durch die Arbeiten von Angelika Strotmann und Georg Schelbert eine gründliche Revision erfahren.[4] Jesus war nicht der erste Jude, der Gott als »Vater« ansprach. Gott wurde im Judentum zur Zeit Jesu durchaus auch sonst »Vater« genannt, wenngleich die Belege nicht besonders zahlreich sind. Auch in den Religionen des Alten Orients[5] und im griechisch-römischen Glauben war die Vater-Bezeichnung für Götter verbreitet;[6] in der Selbstdarstellung der römischen Kaiser war sie über deren Anspruch, pater patriae, Vater des Vaterlandes, respektive des römischen Weltreiches zu sein, ebenfalls präsent.[7] Der Jude Jesus rekurrierte daher mit der abba-Vater-Anrede auf eine |93|im Judentum seiner Zeit stetig populärer werdende Metapher mit großem interreligiösen Potential.
1.1.1 Gott als Vater der Glaubenden im antiken Judentum
Die atl. Schriften verwenden die Vater-Bezeichnung noch selten (ca. 17-mal): Der Gott-Vater ist hier vor allem der Vater seines Bundesvolkes, das er für sich erwählt hat.[8] Wie das Bundesvolk vom göttlichen Vater Vergebung für seine Sünden erhoffen kann, so erwartet der göttliche Vater von seinen erwählten Kindern gleichermaßen Gehorsam.
In hellenistischer Zeit gewinnt die Vater-Bezeichnung an Popularität.[9] Zwar kann der göttliche Vater auch strafen,[10] aber nun dominiert der Aspekt des väterlichen Erbarmens und von Seiten der Glaubenden das Vertrauen auf die Gebetserhörung durch den sich sorgenden, schützenden und seine Kinder rettenden Vater-Gott die Verwendung der Metaphorik.[11] Gott ist seinem Volk nah geworden, die Glaubenden können mit großer Zuversicht auf die Rettung durch den Vater in schwieriger Lage vertrauen.[12] Dies ist auch das Konnotationsspektrum, in dem die jesuanische Vater-Anrede Gottes zu verorten ist.[13]
Zugleich beinhaltet die Vater-Metapher bereits im antiken Judentum einen deutlich integrativen Aspekt: Für Proselyten, die durch ihren Glaubenswechsel möglicherweise in Konflikt mit ihren Familien kamen, konnte Gott als »neuer Vater« gelten. So versteht sich die |94|Ägypterin Aseneth durch ihre Hinwendung zum Judentum als »verwaist« und sieht Jhwh als »Vater der Verwaisten und Verfolgten«, auf dessen Rettung und Schutz sie vertrauen kann (JosAs 11,13; 12,8.13).
1.1.2 Gott als Vater der Glaubenden im frühen Christentum[14]
Im frühen Christentum erfährt die Vater-Bezeichnung im Vergleich mit ihrer Verwendung im vorausgehenden und im zeitgenössischen Judentum nun allerdings eine bemerkenswerte Entwicklung. Mehr als 260-mal sprechen die im Neuen Testament zusammengeschlossenen Texte von Gott als »Vater«. Während sich in den frühjüdischen Gottesbezeichnungen vor allem die Vorstellung von Gott als »Herr« spiegelt und die Vater-Bezeichnung im Vergleich selten erscheint, wird Gott für die ersten Jesus-Nachfolger, die frühen Christinnen und Christen, zunehmend der »Vater«, und zwar der »Vater«, an den sie sich im Gebet vertrauensvoll und in Hoffnung auf Erfüllung ihrer Bitten wenden können, da Gott ihnen wie ein Vater wohlwollend gegenübersteht. Der himmlische »Vater« sollte jedoch grundsätzlich von irdischen »Vätern« unterschieden werden: Die Apposition »der in den Himmeln« im Matthäus-Evangelium sowie die Ablehnung der abba-Anrede für irdische Lehrer in Mt 23,9 weisen darauf hin, dass etwa die matthäische Gemeinde den göttlichen »Vater« als alleinige, auch den irdischen Vätern übergeordnete Autorität benennen wollte.
Diese zunehmende Bevorzugung der Vater-Bezeichnung für Gott erklärt sich vor dem Hintergrund der bereits im zeitgenössischen Judentum ebenso wie im paganen Bereich zu beobachtenden wachsenden Popularität der Vater-Metaphorik für Gott bzw. Götter oder auch den deifizierten römischen Kaiser. Diese Bevorzugung erklärt sich jedoch vor allem durch die historische Verwendung der Bezeichnung durch Jesus, sein eigenes Gebet und durch die in Lk 11,2 erhaltene explizite Gebetsanweisung: »Wenn ihr betet, so sprecht: ›Vater, Dein Name werde geheiligt.‹« Und diese Entwicklung erklärt sich vor dem Hintergrund der Überzeugung von der hoheitlichen Gottessohnschaft Jesu, mit der über die Aussage seiner Partizipation an der |95|Vater-Relation als Mitglied des auserwählten Bundesvolkes hinaus der Vorstellung von einer göttlichen Herkunft und göttlichen Qualität Jesu Ausdruck verliehen wird.
1.2 Gott als Vater des Gottessohnes: Die christologisch-hoheitliche Referenz der Vater-Metapher
Neben der abba-Anrede Gottes in Mk 14,36 findet sich die Bezeichnung Gottes als Vater durch Jesus auch in einigen vermutlich alten Spruchtraditionen der Evangelien. Abgesehen von der Einleitung des Vater-Gebets in Lk 11,2 apostrophiert Jesus Gott als Vater, als Herrn des Himmels und der Erde, der den Unmündigen Offenbarung zuteilwerden ließ, in Lk 10,21: »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen, Unmündigen (aber) offenbart hast. Ja, Vater, weil es dir so wohlgefallen hat.« Während die Vater-Anrede in diesem möglicherweise historischen Jesus-Logion noch absolut gehalten ist und ebenso wie Lk 11,2 als Vater-Anrede des glaubenden Juden Jesus verstanden werden kann, wird sie in Lk 10,22, also im sich anschließenden, vermutlich ursprünglich unabhängigen Spruch[15] konkret auf die Beziehung zwischen Gott und Jesus hin ausgelegt: »Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch, wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.« Die von Jesus vermittelte Offenbarung erscheint hier als die des Wissens um die besondere, persönliche Beziehung zwischen Vater und Sohn. Die in Lk 10,21 absolut gehaltene Vater-Bezeichnung wird in diesem Vers durch die Verwendung des Possessivpronomens »mein« und das epistemologische Geheimnis zwischen Vater und Sohn auf eine exklusive Beziehung hin konkretisiert.[16] Der Vers dokumentiert damit die allmähliche Etablierung der Gottessohnschaft Jesu im deklaratorischen und dann auch genealogischen Sinne im frühen Christentum, wie sie etwa die Tauf- und Geburtsgeschichten in den synoptischen Evangelien belegen und wie sie in der Anrede Gottes als »meinem Vater« zum Ausdruck kommt.[17] Entsprechend findet sich bereits bei Paulus die |96|Eulogie Gottes als des »Vaters unseres Herrn Jesus Christus« (2 Kor 1,3; 11,31; als Doxologie in Röm 15,6; vgl. auch Eph 1,3).
Der oder die Verfasser des Johannes-Evangeliums gestalten die Überzeugung vom besonderen Sohnschaftsverhältnis Jesu zum göttlichen Vater dann erzählerisch und theologisch weiter aus: Als μονογενής ist Jesus als inkarnierter Logos der einzige »leibliche« Sohn Gottes,[18] der in Wesens- und Wirkeinheit mit dem Vater diesen irdisch offenbart und diese Einheit mit den Worten »Ich und der Vater sind eins« (ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν, Joh 10,30) beschreibt. Der Sohn ist eins mit dem Vater, kommt von ihm und kehrt zu ihm zurück. Der Vater offenbart sich im inkarnierten Sohn, der den Vater als einziger »gesehen« hat und ihn der Welt exegisiert (Joh 1,18).
1.3 Die Verbindung von ekklesiologischer und christologisch-hoheitlicher Referenz der Vater-Metapher
Wenngleich die Vorstellung von der Gottessohnschaft der Glaubenden durch ihre jüdische Tradition als prioritär zu denken ist, setzen die frühesten christlichen Schriften die hoheitliche Gottessohnschaft Jesu jedoch bereits ebenfalls voraus und bringen sie in einen Zusammenhang mit der Gottessohnschaft der Glaubenden. Es lässt sich also von frühester Zeit an bereits eine Verbindung von ekklesiologischer und christologisch-hoheitlicher Referenz der Vaterschaft Gottes erkennen.
Bereits in den paulinischen Briefen basiert die Vaterschaft Gottes gegenüber den Glaubenden auf seiner Vaterschaft dem Gottessohn gegenüber. Paulus macht deutlich, dass die Anrede Gottes als abba nur durch die Sendung des Sohnes und die Aufnahme des Geistes geschehen kann. So heißt es in Gal 4,4–6: »(4) Als aber die Erfüllung der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, (5) damit er die unter dem Gesetz freikaufe, damit wir die Sohnschaft empfangen. (6) Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft: ›abba, Vater‹.« Der Geist (Christi)[19] ermöglicht die Partizipation am |97|Göttlichen, die sich in der Konstitution der Vater-Kind-Beziehung konkretisiert, die hier wie ein Rechtsakt als Empfang der Sohn- bzw. Kindschaft (υἱοθεσία) beschrieben wird. Die Glaubenden werden vom göttlichen Vater auf der Basis der Sendung des Sohnes wie bei einer Adoption als Kinder angenommen. Der Geist gibt ihnen die Stimme, Gott ebenso wie Jesus als abba-Vater anzurufen. Möglicherweise rekurriert Paulus hier bereits auf eine frühe Tradition des Vatergebets, in dem Jesus Gott explizit als Vater anspricht (Lk 11,2: »Vater«) und die Jünger und Jüngerinnen lehrt, dies ebenso zu tun (Mt 6,9: »Vater unser«).[20]
Ähnlich, aber doch radikaler formuliert dies der Verfasser des Johannes-Evangeliums. Auch hier erscheint Christus als Vermittler der Gotteskindschaft der Glaubenden, nun aber nicht mehr im Rahmen eines rechtlichen Aktes. Die programmatischen Eingangsverse des Evangeliums beschreiben zunächst, dass der von Gott kommende Christus-Logos einem Teil der Schöpfung, nämlich denjenigen Menschen, die ihn »aufgenommen haben«, »denen, die an seinen Namen glaubten«, die Bevollmächtigung gab, »Kinder Gottes zu werden« (τέκνα θεοῦ γενέσθαι, Joh 1,12). Diese werden nun weiterhin gekennzeichnet als »die, die nicht aus menschlichem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind« (ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν, Joh 1,13). In Joh 3 legt Jesus im Gespräch mit Nikodemus dar, wie dieses »aus Gott Gezeugtwerden« zu denken ist: als ein »von oben«/»von neuem« (Joh 3,3)[21] bzw. »aus Wasser und Geist« (ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, Joh 3,5) Gezeugtwerden. Auch hier wieder vermittelt der Geist die Kindschaft; das Wasser referiert vermutlich auf das Taufgeschehen als Aufnahme des neuen Kindes in die Familie Gottes.[22] Das Johannes-Evangelium formuliert mit den Lexemen »aus Gott« bzw. »von oben/von neuem Gezeugtwerden« (Joh 3,3) den Neuanfang Gottes mit den Menschen in semantischer Radikalität, die das »grundlegende Anders-Sein«[23] dieses Lebens unter dem Aspekt der Partizipation am Göttlichen und |98|damit an der Hoheit in den Blick nimmt.[24] Bei Johannes wird die zuvor auf Jesus konzentrierte Aussage der göttlichen Herkunft also nun auch auf die Glaubenden übertragen:[25] Sie sind als Kinder Gottes durch das »Gezeugtwerden« in eine genealogische Relation zu Gott als Vater gestellt und damit partizipieren sie zugleich an der Erhöhung. Die Gefahr einer Gleichstellung der Glaubenden mit dem einzig »leiblichen« Gottessohn, dem inkarniertern Christus-Logos,[26] ist dennoch nicht gegeben: Dieser unterscheidet sich durch seine Prä- und Postexistenz bei Gott, seine Inkarnation und die im Evangelium ausgeführte Wesens- und Wirkeinheit mit dem Vater von den anderen Gotteskindern, die aber dennoch »aus Gott gezeugt« sind.
Der Verfasser des 1. Petrusbriefs parallelisiert die Vaterschaft Gottes gegenüber Jesus und gegenüber den Glaubenden ebenfalls (1 Petr 1,3: »Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns entsprechend seiner großen Barmherzigkeit neugezeugt hat«) und verwendet für die Vaterschaft Gottes den Glaubenden gegenüber das der johanneischen Semantik vom »von oben/von neuem Gezeugtwerden« (ἄνωθεν γεννάομαι) sehr nahestehende Lexem ἀναγεννάομαι (»neu gezeugtwerden«) für die Glaubenden (1,23; vgl. auch 1,3).
Die Metaphorik des »von oben« bzw. »von neuem Gezeugtwerdens« wird hier noch weiter ausgestaltet, insofern hier die Glaubenden mit neugeborenen Kindern auch bzgl. ihrer Glaubensreife verglichen werden, die mit dem Wort Gottes wie mit »unverfälschter, geistiger Milch« (2,2) gefüttert werden.
Das Bewusstsein der Verbundenheit mit Gott (und Christus) in der familia dei spiegelt sich nicht nur in der Tatsache, dass die Vater-Bezeichnung das Vater-Gebet epikletisch einleitet, sondern auch darin, dass die Rede von Gott als Vater der Christinnen und Christen ihren festen Platz im Eingang frühchristlicher Briefe gewinnt.[27] Die |99|Benennung Gottes als Vater erfolgt praktisch in allen brieflichen salutationes, fließt aber auch in Eulogien und Danksagungen ein. So lobt der Verfasser des 1. Petrusbriefs Gott als Vater. Und so gilt auch der Dank für die Glaubensfestigkeit der Gemeinde, Gott-Vater in Kol 1,3 und 1,12–14: Der Verfasser dankt Gott-Vater, »der euch dazu bereitet hat, Anteil am Los der Heiligen im Licht zu haben. (13) Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe gestellt, (14) in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.«